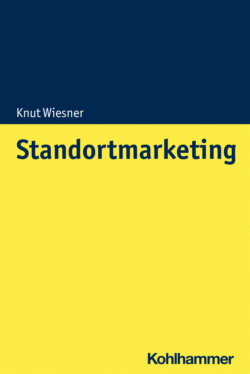Читать книгу Standortmarketing - Knut Wiesner - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Aktuelle Ausgangslage
ОглавлениеDer starke Wettbewerb der Gemeinden, Städte, Regionen und Metropolregionen um Menschen und Wohlstand wird immer wieder thematisiert. Standen Standorte bisher vor allem international in wachsender Konkurrenz zueinander, dürfte sich das Bild seit 2020 durch die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen verändern. Es zeigt sich, dass für Unternehmen nur dann internationale Standorte einen Sinn ergeben, wenn es dort ausreichend (kaufkräftige) Kunden gibt, ergänzt um nationale oder regionale Lieferketten. Angesichts vieler pandemiebedingter Beschränkungen erscheint es als sinnvoll, nicht allein auf internationale Lieferbeziehungen zu setzen, sondern die Belieferung mit Vorerzeugnissen ganz oder zusätzlich regional zu organisieren, damit es zu keinen Unterbrechungen kommt. Gerade in den Gesundheitsbranchen hat sich gezeigt, wie kritisch eine fehlende nationale Produktion ist.
Also ist damit zu rechnen, dass sich zumindest in kritischen Bereichen vermehrt eine regionale Produktion etabliert und Lieferketten regionaler organisiert werden, um Unwägbarkeiten zu reduzieren. Es wird eine gewisse Deglobalisierung der Wertschöpfungsketten erwartet. Und die Welt wird immer komplexer und volatiler, so dass es allen Akteuren schwerer fällt, langfristig zu planen und handeln. Es wird schwieriger, komplexe Zusammenhänge zu erkennen, und Mehrdeutigkeiten lassen strategisches Handeln und Planungen risikobehafteter werden. Aus diesem Grund schätzen immer mehr Menschen überschaubare, regionale Produkte und Angebote, die weniger komplex und vermeintlich ressourcenschonender sind. Der Wunsch der Bevölkerung nach Fairness und Nachhaltigkeit der Unternehmen wächst und erfordert von diesen die Übernahme von Verantwortung für ihre Lieferbeziehungen. Daher dürfte sich der Wettbewerb der Standorte wieder etwas mehr auf die Region und das eigene Land sowie auf die Nachbarländer der EU ausrichten. Es ist nicht nur ein Wettbewerb um Unternehmen oder Investoren, Finanzmittel und Infrastrukturen, sondern auch um Geschäftsreisende und Touristen, Erholungsuchende oder Kulturinteressierte, (Neu-)Bürger und Fachkräfte, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Organisationen oder Verbände. Angesichts ähnlicher Rahmenbedingungen im regionalen/mitteleuropäischen Umfeld unterscheiden sich zudem viele Standortfaktoren nicht oder nur wenig. Also werden die Attraktivität und Lebensqualität der Städte und Regionen zum erfolgsbestimmenden Faktor im Standortwettbewerb.
In den Jahren nach 2010 schwächte sich das weltweite Wirtschaftswachstum von mehr als 5 % auf ca. 3 % ab – in der EU liegt es schon seit Jahren nur etwa halb so hoch. Pandemiebedingt wird die Wirtschaftsleistung 2020/21 allerdings deutlich unter dem Niveau des Jahres 2019 liegen, trotz erwarteter Erholung 2021. Die Unsicherheit fördert eine hohe Sparneigung der Menschen. Besonders betroffen durch Beschränkungen sind die Gastronomie und Hotellerie, die Airlines und Flughäfen, Busse und Bahnen, der Tourismus und die Kulturbranche, die Event-, Messe- und Veranstaltungswirtschaft einschließlich verbundener Wirtschaftsbereiche und einige Handelsbereiche. Aber es gibt auch Profiteure der Pandemie, allen voran die Pharmaindustrie, der Lebensmittel- und Möbelhandel, Bau- und Gartenmärkte, der E-Commerce und damit auch die Logistik.
Nach Angaben der United Nations World Tourism Organization (UNWTO) war noch 2019 weltweit jeder dreizehnte Beschäftigte in der Tourismuswirtschaft tätig, einem der weltweit führenden Wirtschaftsbereiche, 2020 brachte allerdings weltweit einen Einbruch von mehr als 70 % im Tourismus und es wird Jahre dauern bis wieder das bisherige Niveau erreicht wird. Auch in Europa wurde nach Angaben der European Travel Commission (ETC) direkt bis zu 5 % des Bruttonationalprodukts (BIP) von der Tourismusbranche erwirtschaftet, indirekt sogar bis zu 12 %. Also hing bisher auch in Europa jeder achte Arbeitsplatz ganz oder teilweise von der Tourismuswirtschaft ab. In Österreich und in der Schweiz war sogar jeder fünfte Arbeitnehmer in der Tourismuswirtschaft tätig, in Deutschland jeder fünfzehnte. Die Tourismusbranche hat also für Standorte eine hohe wirtschaftliche Bedeutung, indirekt sind auch der Einzelhandel, viele Dienstleister und Handwerker, Kultur- und Freizeitbetriebe von dieser abhängig. Der Erfolg der standortunabhängigen Internetbranchen macht es inzwischen stationären bzw. standortabhängigen Angeboten zusätzlich immer schwerer.
Eine gestiegene Mobilität und die unbegrenzten Kommunikationsmöglichkeiten in Echtzeit erweitern nicht nur den Horizont der Menschen und Unternehmen, sie verstärken den Wettbewerb insbesondere zwischen den weniger standortabhängigen Unternehmen. So nutzten die Menschen bisher die Angebote immer neuer Reiseerlebnissee und Zielgebiete, wodurch eine neue Qualität im Wettbewerb der touristischen Standorte untereinander entstand. Die aktuellen Veränderungen stellen erhöhte Herausforderungen dar, es geht nun um nichts Geringeres als um die Zukunftsfähigkeit der Orte, Städte und Regionen in Zentraleuropa.
Weitere Megatrends entfalten ihre Wirkung in Mitteleuropa, wie ein deutlicher Wertewandel, ein hoher Individualisierungsgrad sowie der demografische und soziale Wandel mit höherer Lebenserwartung, sinkenden Geburtenraten, Emigration, Immigration und Integration. Die weiter zunehmende Digitalisierung verändert Arbeitsformen (internationale Netzwerke, Heimarbeit), Wissensökonomie (Big Data) sowie technische Anwendungen (KI, IoT). Die Mobilität wird sich hinsichtlich der Verkehrs- und Transportmittel (intermodaler, multimodaler und kombinierter Verkehr), Antriebsarten (Emissionen, erneuerbare Energien) und Automatisierung verändern. Mitteleuropäische Standorte stehen daher gleichzeitig vor mehreren Herausforderungen:
• Wirtschaftlich fragile und volatile Zeiten,
• zunehmende Krisensituationen und disruptive Veränderungen,
• Kurzfristigkeit neuer und komplexer Einflüsse,
• Abhängigkeit von kritischen Infrastrukturen und Klimaveränderungen,
• knappe Finanzmittel der Öffentlichen Hand.
Standorte stehen im Wettbewerb um Kapital/Investitionen, Steuereinnahmen, qualifizierte Arbeitskräfte, öffentliche Investitionen (Bildung, Infrastruktur) und Fördermittel (Subventionen, Zuschüsse), Attraktionen, intakte Umwelt, Aufmerksamkeit und (Marken-)Image bei gleichzeitiger Verschonung vor unerwünschten öffentlichen Investitionen (Müllverbrennung, Kraftwerke, Endlagerstätten).
Standortorganisationen müssen daher die Zielgruppen(-Interessen) erforschen, Stakeholder einbinden und profilschaffendes Marketing realisieren. Kann ein Standort im Wettbewerb nicht mithalten, muss er zumindest mittel- oder langfristig steigende Arbeitslosigkeit, geringen bzw. sinkenden Wohlstand, wenn nicht sogar den wirtschaftlichen Niedergang befürchten. Ziele sind also höhere Einnahmen und Kaufkraft, Investitionen und Arbeitsplätze sowie Menschen, die ein attraktives Wohn-, Arbeits- und Urlaubsumfeld suchen.
Viele Gemeinden sind allerdings zu klein bzw. finanzschwach und schließen sich daher in regionalen Standortinitiativen zusammen – selbst attraktive Städte beteiligen sich an Metropolregion-Initiativen, um über die nationalen Grenzen an Strahlkraft zu gewinnen. Andererseits sind manche Bundesländer/Kantone/Provinzen nur bedingt geschlossene Wirtschaftsräume, die sich einheitlich und profiliert präsentieren lassen. Traditionell sind es staatliche Institutionen, die sich um die Attraktivität und Vermarktung der Standorte kümmern bzw. entsprechende Rahmenbedingungen setzen. Weichen Standort- und Verwaltungsgrenzen voneinander ab, werden meist partnerschaftliche Gemeinschaftsinstitutionen, meist als Vereine oder Kapitalgesellschaften, gegründet. Diese sind oftmals auch besser geeignet, unterschiedliche Akteure in Standortmarketingaktivitäten einzubinden.
Eine durch viele Medien sensibilisierte und kritischere Öffentlichkeit setzt auf mehr Nachhaltigkeit der Standorte, Fairness und moralisches Handeln der Verantwortlichen und erwartet die Einhaltung ethischer Standards sowie ein bürger- bzw. gesellschaftsorientiertes Agieren. Die Möglichkeiten des Web 2.0 erhöhen die Artikulationsmöglichkeiten vieler Stakeholdergruppen, die dadurch erhöhte Aufmerksamkeit und mehr Einfluss erhalten. So werden auch Standortverantwortliche zunehmend an ihre ökologischen und gesellschaftlichen Aufgaben und Versprechen erinnert – und die Ansprüche werden eher noch steigen (»Fridays for Future« etc.). Das Nichtbeachten gesellschaftlicher Erwartungen kann zu dauerhaften Reputationsschäden der Standorte führen. Der Aufbau eines nachhaltigen und attraktiven (Marken-)Images/Profils zählt daher zu den zentralen Aufgaben des Standortmarketings.