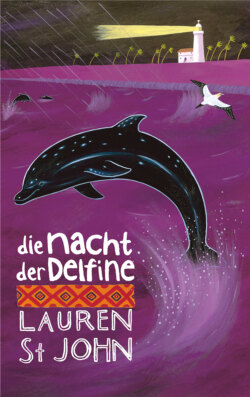Читать книгу Die Nacht der Delfine - Lauren St John - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
• 3 •
ОглавлениеDie Heimfahrt nach Sawubona war für Martine eigentlich das Beste an der Delfinrettung. Ihre Großmutter wusste, dass etwas geschehen war; doch sie wusste nicht genau was. Die unsichtbare Schranke zwischen ihnen, die mit schmerzhaften Erinnerungen an die Vergangenheit – vor allem in Zusammenhang mit Martines Mutter – zu tun hatte, war verschwunden, während sich ihre Gemeinsamkeit, die Tierliebe, gleichzeitig verstärkte. Immer wieder ahmte Gwyn Thomas Martine nach: «Und dann … dann ist er halt davongeschwommen.» Und immer wieder brachen beide in Gelächter aus.
Diese Nähe zwischen ihnen hielt sich genau bis 17:47 Uhr, als Martine in Jeans und Stiefeln aus ihrem Zimmer herunterkam und verkündete, sie werde einen Ausritt auf der weißen Giraffe machen.
Beinahe ohne von ihrer Zeitung aufzublicken, sagte die Großmutter beiläufig: «Nicht jetzt, Martine. Ich denke, für heute hast du genug Aufregung gehabt.»
«Aber ich kann doch nicht auf die Sardinenwanderung gehen, ohne mich von Jemmy zu verabschieden», sagte Martine, die nicht glauben konnte, dass ihre Großmutter es ernst meinte. «Ich muss ihn sehen. Unbedingt!»
«Dann hättest du das früher tun müssen», sagte Gwyn Thomas und wandte sich wieder ihrer Zeitung zu.
«Aber ich habe doch nicht gemerkt, dass es schon so spät ist», sagte Martine flehend.
Doch ihre Großmutter blieb unnachgiebig. «Martine, es ist schon bald dunkel, und du weißt, was ich von Ausritten nach Sonnenuntergang halte.»
Jetzt kochte Martine vor Wut. Dass sie nachts nicht mit Jemmy ausreiten durfte, war seit langer Zeit ein Zankapfel zwischen ihnen gewesen. Für Gwyn Thomas lauerten nachts zu viele Raubtiere im Reservat, als dass sie ihrer Enkelin erlauben würde, zu später Stunde auf der weißen Giraffe durch die Gegend zu reiten. Auch Martines Erklärung, sie sei auf Jemmys Rücken völlig sicher, weil die anderen Tiere sie so sahen, als sei sie eins mit der Giraffe, ließ sie nicht gelten.
«Abgesehen davon», fuhr sie fort, «hast du nicht einmal gepackt. Und schau mich bitte nicht so an. Ich weiß, dass du enttäuscht bist, aber ich verspreche dir, ich werde Jemmy einen Abschiedsgruß von dir ausrichten. Und damit hat sich’s. Du bist total übermüdet, und wenn du jetzt keine ordentliche Nachtruhe bekommst, bist du morgen nicht in der Verfassung, zu dieser fantastischen Reise aufzubrechen, die Miss Volkner für euch organisiert hat. Das wäre doch wirklich jammerschade.»
Martine wusste aus eigener schmerzhafter Erfahrung, dass ihre Großmutter kein Argument gelten ließ, wenn sie einmal diesen Ton angeschlagen hatte. Doch der Gedanke, zehn Tage wegzugehen, ohne auf Jemmy zu reiten oder sich von ihm zu verabschieden, war einfach unerträglich. Während des ganzen Abendessens kochte sie innerlich und schob das Brathähnchen lustlos auf dem Teller herum. Als Gwyn Thomas schließlich sagte, sie solle mit dem Schmollen aufhören, riss sie sich zusammen, setzte sich aufrecht hin und machte ein freundliches Gesicht. Innerlich schmiedete sie jedoch einen Plan. Schon seit Monaten hatte sie sich nie mehr nach Mitternacht davongeschlichen, um mit Jemmy auszureiten, und sie vermisste die Aufregung dieser Mondscheinritte sehr. Vor allem aber fehlte ihr das Gefühl, Afrika zu spüren. Auf ihren Streifzügen mit der weißen Giraffe und den anderen Wildtieren war es, als hätte sie eine Tür zu einem anderen Afrika aufgestoßen, das nur den allerwenigsten Menschen offen stand.
Während sie Soße über die Bratkartoffeln löffelte, genoss sie die Aufregung über ihren rebellischen Plan. Bisher war sie nie erwischt worden, nicht einmal, als sie noch nicht mit Sawubona und den Gewohnheiten ihrer Großmutter vertraut gewesen war. Jetzt kannte sie beide in- und auswendig. Also konnte gar nichts schiefgehen.
Die Vorfreude machte sie fast schwindlig. Um die Großmutter abzulenken, brachte sie das Gespräch wieder auf den Delfin und fragte, warum sich diese Tiere an den Strand und in den beinahe sicheren Tod spülen ließen.
Glücklich über diese Entspannung, war Gwyn Thomas nur zu gerne bereit, nochmals über das Stranden der Delfine zu sprechen. Sie sagte, sie wisse nicht, warum es immer wieder geschehe, aber es müsse damit zu tun haben, dass das Leben im Meer für sie unerträglich geworden sei. «Vielleicht hat es mit der Meeresverschmutzung oder dem vermehrten Seeverkehr zu tun», sagte sie. «Es gibt Gebiete der Weltmeere, die sind zu regelrechten Städten von Frachtschiffen, Trawlern und Marinebooten geworden.»
Martine hörte aufmerksam zu und versuchte, sich an alles zu erinnern, was sie je über die Intelligenz von Delfinen und über die heilsame Wirkung, die sie auf den Menschen ausübten, gehört hatte. Sie dachte an den elektrischen Strom, der durch sie hindurch gelaufen war, als sie den gestrandeten Delfin berührt hatte. Irgendwie und ohne ein Wort zu sagen, hatte das Tier sie darum gebeten, ihm zu helfen. Und irgendwie und ohne ein Wort zu sagen, war sie dazu bereit gewesen.
In der Regel erzählte Martine ihrer Großmutter, was diese wissen musste. Das Geheimnis der unhörbaren Hundepfeife, mit der sie die weiße Giraffe herbeirief, hatte sie allerdings für sich behalten. So konnte sie ohne Angst, entdeckt zu werden, im Fenster ihres Zimmers stehen und pfeifen, bis Jemmy bei dem kahlen Eukalyptusbaum am Wasserloch auftauchte.
Als das Licht im Schlafzimmer ihrer Großmutter ausging, zog sie ihren Schlafanzug aus und schlüpfte in Jeans, Stiefel, Sweatshirt und Anorak. Sie holte Messer und Taschenlampe aus dem Überlebensbeutel, den sie hinter dem Bücherregal versteckt hatte, und schlich die Treppe hinunter. Jemmy wartete beim Eingangstor zum Reservat auf sie. Sein weißes Fell leuchtete gespenstisch durch die dunkle Nacht. Er legte sich hin, damit sie auf seinen steilen, samtweichen Rücken klettern konnte. Als sie sicher saß, sagte sie: «Los Jemmy!» Darauf erhob er sich und galoppierte mit ihr davon.
Der Winterwind schlug Martine ins Gesicht. Aber das störte sie ausnahmsweise nicht. Die Aufregung über den verbotenen Ritt hatte sie in einen Rausch versetzt. Das Reiten während des Tages hatte zwar auch sein Gutes. Es war weit weniger gefährlich, und sie musste sich nicht aus dem Haus stehlen. Andererseits konnte sie tagsüber nicht so wild reiten. Ihre Großmutter wäre fassungslos gewesen, hätte sie gesehen, wie schnell Jemmy durch das Reservat preschte, wenn man ihn nur ließ. Aber tagsüber musste sie sich vor allem von Jemmys Refugium, dem Geheimen Tal, fernhalten, in das die weiße Giraffe als Waise von einem Elefanten gebracht und so vor Wilderern gerettet worden war.
Genau in dieses Geheime Tal wollte Martine heute Nacht mit Jemmy. Sie wusste nicht weshalb, aber sie musste die Höhle, die den Schlüssel zu ihrem Schicksal in sich barg, noch einmal sehen, bevor sie Sawubona verließ. Leider war die Höhle im Geheimen Tal schlecht zugänglich. Der Eingang zum Tal war eine von dornigen Kriech- und Schlingpflanzen verborgene Felsspalte hinter einem knorrigen Baum. Es gab nur eine Möglichkeit, durch die Spalte zu gelangen: Jemmy musste mit höchster Geschwindigkeit auf den Baum zureiten und dann genau im richtigen Winkel zu einem weiten Sprung ansetzen. Martine hatte immer die größte Mühe, sich während des Sprungs auf Jemmys Rücken zu halten. Auch dieses Mal war es nicht anders. Die Dornenranken kratzten und stachen sie, und sie hatte keine andere Wahl, als ihr Gesicht in Jemmys Mähne zu verstecken und sich an seinem Hals festzuklammern. Sie hoffte nur, dass die Dornen keine auffälligen Kratzwunden in ihrer Haut hinterlassen würden, für die sie am nächsten Morgen eine Erklärung erfinden müsste.
Im Tal hing immer noch der Duft von Orchideen, obwohl diese längst nicht mehr blühten. Durch eine enge Öffnung war ein kleines Stück Sternenhimmel zu sehen, das dem dunklen Grasboden einen gespenstisch bläulichen Schimmer gab. Martine rutschte von Jemmys Rücken hinunter und gab ihm einen Dankeskuss. Sie war erst zum dritten Mal im Tal, und der Gedanke, gleich in die gruselige Höhle zu kriechen, machte sie nervös. Jemmy blickte ihr mit zuckenden Ohren hinterher.
In dem engen Durchgang roch es nach Moder und Raubtier, als hätte noch vor Kurzem ein Leopard dort gehaust. Martines Taschenlampe warf einen dünnen, flackernden Strahl über die zerklüfteten Wände. Nach einer Weile wurde der Höhlengang breiter und machte einen Bogen. Jetzt wusste Martine, dass sie im Inneren des Berges war. Mit Mühe erklomm sie die steil ansteigenden, moosbewachsenen Stufen, die in die Vorkammer der großen Halle führten. Martine ärgerte sich über sich selbst, weil sie keinen Plan ausgeheckt hatte, um ihre Jeans sauber zu halten. Sie hätte ja Abfallsäcke um die Hosenbeine wickeln können. Sie besaß nur zwei paar Jeans, die sie beide am nächsten Morgen auf die Reise mitnehmen musste.
Kurz bevor sie oben ankam, schaltete sie ihre Taschenlampe aus. Beim ersten Mal in der Höhle hatte sie die mit gefalteten Flügeln von der Decke baumelnden Fledermäuse derart aufgescheucht, dass sich die klebrigen Tiere in ihren Haaren verfingen. Diesmal hatte sie Glück. Die Fledermäuse blieben regungslos hängen.
Als Martine die «Gedächtnishalle», wie sie von den Älteren genannt wurde, betrat, knipste sie die Taschenlampe wieder an und atmete tief ein. Sie mochte die Schwere der Luft. Es war, als könnte sie darin noch etwas von vergangenen Generationen spüren. Überall an den Wänden waren Malereien, die das Leben und die Erinnerungen eines untergegangenen Stammes von Buschmännern, den San, darstellten. Rote, schwarze und ockerfarbene Zeichnungen von großen Wildtierherden und Jägern mit Pfeil und Bogen erwachten im Lichtkegel ihrer Taschenlampe zum Leben, als seien sie erst gestern gemalt worden. Martine fühlte sich geehrt, die über die Wände galoppierenden Tiere bestaunen zu dürfen. Immer wenn sie in der Höhle war, hatte sie den Eindruck, ihre eigene, private Kunstgalerie zu besuchen.
Sie ging zu den Zeichnungen mit der weißen Giraffe. Obwohl sie die Darstellungen seit Monaten nicht mehr gesehen hatte, war es ihr, als trage sie sie immer in ihrem Herzen mit sich herum. Nur auf einer der drei Zeichnungen war das auf einer weißen Giraffe reitende Kind zu sehen. Dem Buschmann, der das Bild gemalt hatte, war eine so vollkommene Darstellung von Jemmys edlem Fell gelungen, dass es glänzte wie ein echtes.
In ihren Gedanken war sie oft in die Halle zurückgekehrt. Deshalb fiel ihr zunächst gar nicht auf, dass sich die Bilder etwas verändert hatten. Wie betäubt starrte sie auf die Höhlenwand. Es dauerte eine Weile, bis sie verstand, was sich ihren Augen darbot. Die Bilderfolge war um zwei Darstellungen ergänzt worden.
Martine überlegte sich, ob sie diese beiden Bilder bei ihren früheren Besuchen vielleicht einfach übersehen hatte. Nein, das konnte nicht sein. Sie waren zwar teilweise von einem pyramidenförmigen Steinbrocken verdeckt, doch sie hatte die Malereien schon zweimal eingehend und aus nächster Nähe betrachtet. Beim zweiten Mal war Grace mit ihr gewesen, und auch Grace hatte nichts bemerkt. Oder vielleicht doch?
«Die Antworten auf deine Fragen stehen hier an den Wänden», hatte die Sangoma gesagt. «Aber erst Zeit und Erfahrung werden dich lehren, sie zu sehen mit den richtigen Augen.»
Als Martine die Wand berührte, spürte sie eine seltsame Energie. Der Lichtschein ihrer Taschenlampe fiel auf ein Rinnsal, das aus einem Felsspalt lief. Vielleicht konnte das Wasser eine – wenn auch nicht vollends überzeugende – Erklärung liefern. Womöglich waren die Malereien von einem feinen Staub bedeckt gewesen, der mit der Zeit vom hinabströmenden Regenwasser weggewaschen wurde. So kam das darunterliegende Bild zum Vorschein. Das war zumindest eine Möglichkeit. Doch Martine mochte nicht daran glauben. Sie war eher geneigt, Grace zu vertrauen, dass erst Zeit und Erfahrung sie lehren würden, das zu sehen, was sie sehen musste.
Auf dem ersten Bild lagen einundzwanzig Delfine nebeneinander an einem Strand. Aus dem Ohr eines Delfins floss Blut. Das zweite Gemälde bestand eher aus einem Muster als einer Darstellung. Es zeigte unzählige Ringe von Delfinen – auf den ersten Blick waren es Hunderte –, die von einem größeren Ring von Haien umgeben waren. In der Mitte war noch etwas zu sehen. Martine hob die Taschenlampe und ging näher heran. Es war ein schwimmender Mensch. Ein schwimmender Mensch, umgeben von Haien und Delfinen.
Martines Herz geriet für einen schmerzhaften Augenblick ins Stocken. Sie befand sich inmitten einer uralten Weissagung. Das Schicksal, das die Vorfahren vorausgesagt oder geplant hatten (sie wusste nie, was eher zutraf), war einmal mehr in Bewegung geraten und riss sie wie ein Laubblatt auf einem reißenden Strom mit. Martine fragte sich, ob es möglich war, dem Schicksal zu entrinnen. Ihre Eltern hatten es versucht – mit katastrophalen Folgen. Aber vielleicht konnte sie ihm einfach ausweichen. Sie würde mitfahren, aber nicht schwimmen und das Wasser meiden – da konnten sich die anderen auf den Kopf stellen. Die Haie würden wohl kaum über die Reling klettern, um nach ihr zu schnappen.
Als würden sich die Vorfahren aus dem Grab melden, begann ihre Taschenlampe plötzlich zu flackern. Martine hatte sich vorgenommen, tapfer zu sein, als sie sich in die enge Höhle aufmachte, doch jetzt verlor sie die Nerven. Unvermittelt drehte sie sich um und rannte davon. In der Aufregung vergaß sie die Fledermäuse ganz. Sie stolperte laut die Stufen hinunter und der Lichtkegel ihrer Taschenlampe fuhr wild über die Wände. So wurden die Fledermäuse unsanft aus ihren Kopfüberträumen gerissen. Im Spiel der umherhuschenden Schatten sah es aus, als klebte eine Vampirtapete auf der Höhlenwand. Ein wütendes Gekreische, dessen Missklang vom Echo noch verstärkt wurde, verfolgte sie auf ihrem eiligen Rückzug.
Jemmy nahm ihre Angst sofort wahr, als sie ins Geheime Tal zurückkam. Er schoss davon, noch bevor Martine sicher auf seinem Rücken saß, sodass er sie fast abgeworfen hätte, als er durch den knorrigen Baum preschte. Während sie sich an Jemmys Mähne festklammerte, wurde Martine zum ersten Mal richtig klar, dass sie die weiße Giraffe nie wirklich unter Kontrolle hatte, dass sie sich vollständig auf ihre Beziehung verließ, auf ihr gegenseitiges Vertrauen, auf Jemmys gute Absichten. Ohne diese Sicherheiten wäre die Katastrophe abzusehen. Sie sagte sich aber mit Nachdruck, dass nichts dergleichen geschehen würde. Und so lehnte sie sich vorwärts und genoss den Rausch des gefährlichen Ritts, während die dunklen Umrisse einer grasenden Büffelherde an ihr vorbeischossen.
Als Jemmy schließlich im Wäldchen beim Wasserloch zum Stehen kam, rutschte Martine seinen Rücken hinunter und umarmte ihn. Sein Hals war schweißnass. Nun beugte er sich zu ihr herab und gab seine leisen, flatternden melodischen Laute von sich. Martine versuchte ihm – so gut es ging – zu erklären, dass sie für eine Weile weggehen müsse, dass sie ständig an ihn denken würde und ihn von ganzem Herzen liebte.
Dann sperrte sie das Tor zum Reservat hinter sich zu und rannte durch die Mangobäume und wohlriechenden Gardenien zum Haus. Als sie die Hintertür öffnete, kam es ihr vor, als würde die Stille des Hauses ins Freie dringen und sie einhüllen. Weil ihre Nerven vom wilden Ritt immer noch strapaziert waren, ahnte sie Schlimmes. Sie betrat die Küche. Ein Rest von Brathähnchenduft lag in der Luft. Fahles Mondlicht fiel in Streifen über die Bodenfliesen. Martine stahl sich am Schlafzimmer ihrer Großmutter vorbei und die Holztreppe hinauf. Mit jedem Knarren schoss ihr Puls in stratosphärische Höhen. In ihrem Zimmer angekommen, schaltete sie nicht einmal das Licht ein, sondern ließ sich nur auf das Bett fallen und atmete tief durch.
Als sie dabei war, ihre Stiefel aufzuschnüren, beschlich sie das Gefühl, nicht allein zu sein. Ein unterdrücktes Husten zerriss die Stille. Von Panik getrieben schoss Martine auf.
Im Korbstuhl saß eine gespenstische Gestalt.