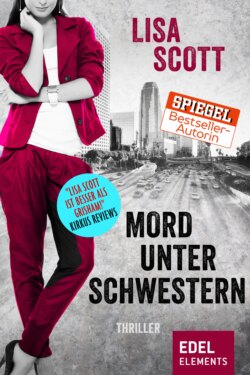Читать книгу Mord unter Schwestern - Lisa Scott - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеEin einziges Wochenende genügte, und das große Besprechungszimmer der Kanzlei hatte sich in den Tagungsraum eines Generalstabs verwandelt. Dokumente von St. Amien & Fils, fotokopierte Präjudizienfälle und beschriebene Notizblätter bedeckten den langen Nussbaumtisch, Gesetzbücher stapelten sich auf den Stühlen, und auf dem Eichenbord lagen die leer gegessenen Plastikbehälter vom Chinesen gegenüber. Die Kaffeemaschine brodelte unaufhörlich. Die Fenster an der Nordseite waren zu dieser Zeit, kurz vor neun Uhr abends, Vierecke aus schimmerndem Onyx, und vier erschöpfte Anwältinnen saßen immer noch um den Tisch herum.
»Also gut, ich weiß jetzt etwas mehr von Gruppenklagen, und ich traue mir schon fast zu, eine Klageschrift zu verfassen.« Bennie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Sie trug ein blaues Arbeitsshirt und Khakishorts, und ihr langes, gelocktes Haar war zusammengedreht und wurde auf dem Hinterkopf von einem Bleistift gehalten. Die Lage musste miserabel sein, wenn das einzige modische Accessoire, über das man verfügte, ein grüner Bleistift der Stärke 2B war. »Und das mit den Gebühren ist wirklich erstaunlich.«
»Wieso?« Über einen Berg juristischer Fachliteratur vor ihr auf dem Tisch sah Judy sie an. Ihr grellorangefarbenes T-Shirt war zerknittert, und die widerspenstigen Strähnen ihres bonbonfarbenen Haars wurden von ungefähr zweihundert Clips aus dem Gesicht gehalten. Ihre Augen waren von schwarzen Ringen umgeben, aber als sie sprach, wurden sie lebendig. »Sind sie so hoch?«
»Ja. Ein federführender Gruppenanwalt kann fünf- bis sechsmal so viel verlangen wie der Repräsentant der übrigen Gruppenmitglieder, wegen der Vorteile, die er für die Gruppe als Ganzes herausholen kann.« Bennie versuchte, ihre Stimme nüchtern klingen zu lassen. »Deshalb ist die federführende Position in der Gruppe so heiß umkämpft. Dieser Anwalt ist der Star unter lauter gewöhnlichen Sternen.«
Anne saß neben Bennie. Irgendwie schaffte sie es, auch unter Umständen wie diesen frisch und knackig auszusehen in ihrem weißen Baumwollkleid, mit einem langen, lässig geflochtenen kupferroten Zopf auf dem Rücken. »Wie hoch wären die Gebühren, in diesem Fall zum Beispiel?«
»Wenn wir Verluste in Höhe von sechzig Millionen zu Grunde legen, können wir von zwanzig Prozent Gebühren ausgehen. Das sind über zehn Millionen Dollar! Die Zahl nahm Bennie den Atem. Sie hatte nie gedacht, dass sie so gewinnsüchtig sein könnte, aber sie stand mit dem Rücken an der Wand, und da sah manches anders aus. »Wenn wir dreiβig Prozent rechnen, was durchaus noch im Rahmen des Üblichen ist, wären es noch mehr. Wenn wir die ganze Gruppe vertreten, kriegen wir nahezu automatisch jede Menge neuer Mandanten, und ich raste aus.«
»Yippie!«, rief Judy, und Bennie musste zustimmen.
»Zuerst muss man aber erst mal federführender Gruppenanwalt werden. Normalerweise machen es die Anwälte untereinander aus. Es heißt ›Eigenbestellung‹. In dem meisten Fällen wird es derjenige, der den dicksten Fisch vertritt. In unserem Fall sind wir das, mit St. Amien. Und wisst ihr, welche andere Methode es gibt, um den federführenden Anwalt auszuwählen?«
»Ich weiß es«, antwortete Anne und hob die Hand, als würde sie immer noch als Studentin vor ihrem Professor sitzen. »Es wird eine Auktion veranstaltet. Die in Frage kommenden Kanzleien geben geheim und in versiegelten Umschlägen ihre Gebührenforderungen bekannt, und der Richter sucht dann den preiswertesten Bieter aus.«
Judy sah zu ihr. »Ist das dein Ernst? Anwälte geben Angebote ab wie Baufirmen? Das ist absurd! Wie kann der Richter darüber entscheiden, wer irgendjemandes Anwalt sein soll? Wessen Prozess ist es dann überhaupt?«
Bennie schlürfte eiskalten Kaffee. »Es funktioniert bei Fällen wie dem von St. Amien. Der Gruppe bleibt mehr Geld, und Anwälte wie wir, für die Gruppenklagen nicht das tägliche Brot sind, bekommen wenigstens eine Chance. Das ist das Grundprinzip, aber es gibt ein wichtiges Urteil, das besagt, eine Auktion sollte nur abgehalten werden, wenn besondere Umstände vorliegen.«
»Auktionen sind reiner Kommerz.« Judy legte ihre hübsche Nase in Falten. »Sie haben nichts mit Recht zu tun. Das Recht sollte rein und wahrhaftig sein wie Kunst. Es muss entwickelt werden wie ein Gemälde, Schritt für Schritt, bis man die ganze Wahrheit sehen kann.«
Bennie lächelte. Diese jungen Anwältinnen waren oft so überraschend. Sie hatten alle an diesem Wochenende durchgearbeitet, vor allem Mary, die sich in ihrem Büro vergraben hatte, um den Brandolini-Fall zu recherchieren. Gelbe, orangerote und blaue Filzstifte lagen neben ihr auf dem Tisch, und sie hatte drei Schreibblöcke mit mehrfarbigen Notizen gefüllt. Sie trug ein Oxford-Shirt und Jeans, ihr Haar war zu einem straffen Pferdeschwanz gebunden, und sie hatte ihre üblichen Kontaktlinsen mit einer braunen Hornbrille vertauscht. Bennie wurde sich bewusst, dass der Arbeitseifer ihrer Angestellten sie rührte.
»DiNunzio?«, fragte sie. »Es ist spät. Du solltest jetzt wirklich aufhören. Wir sollten alle Schluss machen.«
»Wie bitte?« Die junge Frau sah sie mit einem leicht verwirrten Blick an. »Nein, warte ... Nur noch zehn Minuten.«
»Wir sind alle erschöpft. Morgen müssen wir wieder hier sein. Ihr habt euch alle völlig verausgabt diese zwei Tage, und ich weiß das zu schätzen. Jetzt solltet ihr euch ums Abendessen kümmern.«
Mary legte widerstrebend ihren Stift nieder und vermied es, die anderen anzusehen. Alle schwiegen.
Judy sah zu ihrer Freundin. »Hey, Mary. Ist was los?«
»Nein, nichts. Gar nichts. Wirklich.« Sie wandte sich zu Bennie. »Hast du eigentlich deinen Terminplaner schon gefunden?«
»Nein, aber Marshall hat die Karten sperren lassen. Machst du dir wirklich so große Sorgen um meinen Planer?« Sogar Bennie erkannte, dass Mary etwas auf dem Herzen hatte, aber sie war als Beichtmutter fast so schlecht wie als Kummerkasten. »Das ganze Wochenende hast du nichts gesagt. Ich weiß das durchaus zu schätzen, vor allem angesichts der nie erlahmenden Gesprächigkeit deiner Kolleginnen. Aber ist irgendwas nicht in Ordnung? Möchtest du darüber reden?«
Mary sah zur Seite. »Ich weiß nicht.«
Bennie fragte sich, ob Mary immer noch an ihre Mutter dachte. »Hör zu. Wir sind ein Team von vier Frauen. Bewundert viel und viel gescholten, so heißt es doch irgendwo. Wir sollten in der Lage sein, über alle Dinge zu sprechen, die uns angehen.«
Mary fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Na ja ... Also, ich wünschte, wir könnten darüber reden ...« Ihre weichen braunen Augen suchten Bennies teilnahmsvollen Blick. »Ich würde gern mit dir darüber reden, Bennie. Es geht um die Kanzlei, und um Geld.« Sie räusperte sich. »Ich meine, ich weiß doch, dass Caveson und Maytel zahlungsunfähig sind. Aber was genau hat das für Konsequenzen für uns, und werden St. Amien und Brandolini etwas daran ändern? Zum Beispiel habe ich am Freitag versucht, ein Ferngespräch zu führen, und das ging nicht. Ich habe bei der Störungsstelle angerufen, um die Leitung überprüfen zu lassen, aber sie haben gesagt, sie würden nicht mit mir reden, sondern nur mit dem Anschlussinhaber. Ist irgendwas mit den Rechnungen nicht in Ordnung?«
Anne nickte ernst. Von ihrem kunstvollen Make-up war nichts mehr übrig, wodurch sie nur noch attraktiver wirkte. »Und dass du letzten Monat Marie entlassen hast. Du hast sie doch gemocht, und sie war die Einzige, die wir außer Marshall je hatten. Das hättest du doch nie getan, wenn es keine zwingenden Gründe dafür gegeben hätte. Und diese ganzen anderen Maßnahmen. Keine Zeitschriftenabos mehr. Und Kopien nur noch doppelseitig. Mandanten dürfen wir nicht mehr zum Abendessen einladen, nur noch zum Mittagessen. Und alles wird geteilt, außer dem Klopapier.«
Judy klinkte sich ein. »Du hast den Prozess mit Ray Finalil gerade gewonnen, da sollten wir doch eigentlich gut bei Kasse sein. Wir sollten mal richtig feiern. Aber wenn man dich darauf anspricht, machst du ein richtig miesepetriges Gesicht. Was geht hier vor? Wir haben das Recht, es zu erfahren!«
»Wartet mal.« Bennie spürte, dass sie innerlich erstarrte. Sie wollte alles andere, als diese Dinge mit ihren Angestellten diskutieren. Irgendwie und irgendwann zwischen Annes Strumpfhose und der Bestellung beim Chinesen war ihr die richtige Distanz verloren gegangen. Es waren schließlich nicht die Mitinhaberinnen ihrer Kanzlei, sondern ihre Angestellten. »Ich bin nicht damit einverstanden, dass es euer Recht ist, es zu erfahren«, sagte sie. »Tatsache ist vielmehr, dass es keineswegs euer Recht ist. Es ist allein meine Sache. Basta.«
Judys Wangen wurden so rosarot wie ihre Haare, und Mary biss sich auf die Lippen. »Vielleicht haben wir dieses Recht nicht, Bennie. Aber wir wollen es einfach wissen. Wir wollen die Last gemeinsam tragen.«
»Genau«, stimmte Anne zu.
Bennie dachte widerstrebend darüber nach. »Okay«, sagte sie schließlich, »es stimmt, dass ich im Moment kein Geld habe. Ray Finalil steht vor dem Konkurs, und er hat weder uns noch die Sachverständigen bezahlt. St. Amiens Fall ist wunderbar, aber ich fürchte, er kommt zu spät. Ich habe keine Ahnung, ob ich in der Lage sein werde, so lange durchzuhalten, bis es zum Vergleich kommt, und es gibt immer noch die Möglichkeit, dass sich die Verhandlung ewig hinzieht.« Bennie raffte ihre Unterlagen zusammen, stand mit steifen Beinen auf und stopfte die Dokumente schnell in ihre Aktentasche. »In den nächsten zwei Monaten könnt ihr sicher sein, dass ihr weiterarbeiten könnt, aber mehr kann ich euch nicht zusichern. Ich kann nichts versprechen. Zwei Monate, das ist alles.«
Die drei jungen Frauen sahen aus wie vom Blitz getroffen. Bennie erkannte, dass bis zu diesem Augenblick keine von ihnen im Traum daran gedacht hatte, dass ihr Job gefährdet sein könnte. Sie sah vor sich auf den Tisch, fingerte am Verschluss ihrer Tasche herum und versuchte krampfhaft, den Knoten in ihrem Hals loszuwerden. Dann hob sie die Augen und zwang sich, ihren Blicken standzuhalten. Und sagte nicht das, was ihr auf der Zunge lag, sondern das, was ihnen am meisten nützen würde:
»Jetzt wisst ihr es also. Ich glaube, alles wird anders, wenn wir erst diesen Vergleich haben, aber ich habe an diesem Wochenende genügend Präjudizien studiert, um zu wissen, dass es sehr lange dauern kann. Ich habe volles Verständnis für jede von euch, die die Kanzlei verlassen will. Wer sich anderswo bewerben will, sollte es jetzt tun. Ich wünsche euch allen das Beste und werde euch hervorragende Zeugnisse mitgeben. Und ich werde es auch ohne euch schaffen. Also ... wenn ihr kündigen wollt, dann tut es, bitte.«
»Wir wollen nicht kündigen!«, brach es aus Judy heraus, und Anne schüttelte den Kopf.
»Nie und nimmer. Ich habe doch gerade erst angefangen.«
Mary sah mitgenommen aus. Ihre Lippen waren rissig. »So hab ich es doch nicht gemeint, Bennie. Lass uns essen gehen. Alles vergessen. Wir haben zwei großartige Fälle, die Gruppenklage und Brandolini. Wir können wirklich was daraus machen. Du musst nur die Zeit irgendwie überbrücken.«
»Nein. Ihr geht ohne mich essen.« Bennie schüttelte entschlossen den Kopf. »Ich bin erledigt. Wir sehen uns morgen früh. Nochmals danke für alles.« Sie brachte ein falsches Lächeln zustande und ging mit hastigen Schritten zur Tür. Ihr Gesicht fühlte sich heiß an. Worte, die sie an diesem Tag gehört hatten, hallten in ihr wider. Was hatte Anne über Amadeo Brandolini gesagt? Er hatte es nicht vermocht, seine Familie zu ernähren und zu beschützen. Er hatte versagt. Als Mann fühlte er sich zutiefst beschämt. Jetzt verstand sie genau, wie Brandolini sich gefühlt hatte. Das Gefühl war nicht auf Männer beschränkt. So schnell wie möglich und ohne ein weiteres Wort verließ sie ihre Angestellten.
Auf der Straße schlug ihr die dunkle, feuchte Nachtkühle entgegen. Nirgends war ein Mensch zu sehen, obwohl es noch nicht spät war. Ein leerer Bus zockelte schwankend die Chestnut Street hinunter und ließ ab und zu ein hydraulisches Pfeifen hören. An der Haltestelle an der Ecke wartete niemand, und er fuhr vorbei und spuckte graue Rauchwolken aus, als er beschleunigte. Bennie schlug den Weg in die engen Straßen der Altstadt ein. Gewöhnlich bevorzugte sie diese Straßen auf ihrem Nachhauseweg, weil sie einen abwechslungsreicheren Anblick boten als die großen Durchgangsschneisen. Aber heute war es etwas anderes. Sie hatte das Bedürfnis, sich zu verstecken. Vor ihren Angestellten und vor sich selbst.
Mit zügigen Schritten ging sie eine schmale, unbeleuchtete Nebenstraße entlang. Vor ihr lag die fast undurchdringliche Dunkelheit. Nur am Ende ihres Blickfelds sah sie den runden, nebligen Lichtkreis einer Straßenlampe. Es musste heftig geregnet haben, während sie über ihren Fällen gesessen hatten, und der Asphaltbelag glänzte schwarz und ölig. Ihre Joggingschuhe quietschten auf der Nässe. Dann hörte sie ein seltsames Geräusch in ihrem Rücken.
Sie drehte sich um, aber es war niemand da. Vielleicht war sie einfach nur müde. Gestresst. Doch sie begann, schneller zu laufen, und drückte ihre dicke Aktentasche enger an sich. Irgendetwas ließ sie noch einmal herumfahren. Aber so angestrengt ihre Augen auch die Dunkelheit zu durchdringen suchten, es war nichts zu sehen.
Plötzlich fühlte sich die sonst so furchtlose Bennie unbehaglich. So bald schon am Ende. Versagerin.
Sie straffte sich und atmete tief durch. In der feuchten Luft lag ein sonderbarer Geruch. Vielleicht ging nur wieder einmal ihre Fantasie mit ihr durch. Bratöl? Sie war in nordöstlicher Richtung gegangen und befand sich nun am Rand von Chinatown. Der Geruch heißen Fettes wehte um ihre Nase. Die Ventilatoren der Restaurants verbreiteten ihn im ganzen Viertel.
Hell erleuchtete Schilder mit roten Aufschriften – PEKINGENTE, DIM SUM, SHANGHAI GARDEN – umgaben sie, und sie erinnerte sich daran, dass sie zu Hause außer Getreideflocken nichts zum Essen hatte. Ihr Hund konnte ruhig noch ein wenig auf seinen Abendspaziergang warten; sie hatte das sonderbare Bedürfnis, unter Leute zu kommen. Das nächste größere Restaurant, das sie fand, betrat sie und sah sich nach einem Platz um.
Familien und Paare aus der Vorstadt drängten sich um die Tische, es ging laut und fröhlich zu, und das große Schaufenster war völlig beschlagen. Hier würde es kein friedliches Abendessen geben, wie sie es sich vorgestellt hatte. Sie wandte sich schon zum Gehen, als ein Kellner in schwarzem Frack ihren Ellbogen ergriff. »Bitte, an der Bar gibt es noch Platz«, sagte er mit einer einladenden Handbewegung.
»Bekomme ich etwas zu essen?«
»Ja, natürlich«, sagte der Kellner, und Bennie folgte ihm durch das Getümmel zu einem Barhocker. Es ging auch an der Bar lebhaft zu, denn es handelte sich um eines der wenigen chinesischen Lokale, das die Erlaubnis hatte, Alkohol auszuschenken. »Möchten Sie etwas trinken?«, fragte der Kellner.
»Ja, gern. Ein Glas Rotwein.« Er nickte und verschwand, und Bennie stellte ihre Aktentasche ab und sah sich um. Es war nicht sehr hell, aber an einem langen Tisch im hinteren Teil des Restaurants konnte sie ein paar vertraute Gesichter ausmachen. Dort saßen Richter William Tepper vom Bundesgerichtshof, dessen Brillengläser das Kerzenlicht vor ihm reflektierten; außerdem Richterin Lynne Maxwell, ebenfalls vom Bundesgerichtshof; ferner Richter Lucien Favate und Richter Ernest Calhoun Eadeh. Es war eine große Gesellschaft aus dem Östlichen Distrikt. Richter nahmen ihre Mahlzeiten oft in Chinatown ein, weil es zum Gericht nicht weit war, aber Bennie hätte nicht erwartet, sie an einem Sonntagabend hier zu sehen.
Verdammte Scheiβe. Sie sah in die entgegengesetzte Richtung, überlegte es sich dann aber anders. Einer von diesen Richtern würde die Klageschrift im St.-Amien-Fall in die Hand bekommen. Sie sollte versuchen, ein paar Fäden zu knüpfen, wenn sie als federführende Gruppenanwältin zugelassen werden wollte. Und ihr Hocker war ohnehin so nah an diesem Tisch, dass man sie früher oder später sehen musste. Und tatsächlich machte ihr Richterin Kathryn Kolbert bereits unmissverständlich Zeichen, sich zu ihnen zu setzen.
»Bennie, Bennie, kommen Sie!«, rief die Richterin. Sie war Ende sechzig, hatte eisgraues, modisch geschnittenes Kurzhaar und trug ihre Lachfalten mit Würde und Stolz. Bennie hatte sie immer bewundert. Diese Frau kam aus einer Epoche, als Frauen ihre BHs verbrannten und die Karriere anderer Frauen förderten – was ein echtes Fossil aus ihr machte.
Bennie gab sich einen Ruck. Sie stand auf und bahnte sich mit einem Lächeln auf den Lippen ihren Weg zum Tisch der Richter. »Nanu! So viele gelehrte Köpfe! Was führt Sie alle hierher? Wollen Sie das Atom spalten?«
Die Oberste Richterin Kolbert lachte und deutete mit ihrer gepflegten Hand zum Kopf der Tafel. »Ken hat Geburtstag. Ein weiterer runder Sechziger mit dem heutigen Tag.«
»Ich kann’s einfach nicht glauben«, sagte Bennie und lächelte Richter Kenneth Sherman zu. Sie mochte Richter Sherman wirklich, aber sie brachte es nicht über sich, ihn Ken zu nennen. Richter waren für sie von einer gewissen mystischen Aura umgeben, auch wenn sie keine Robe trugen. Sie waren wirkliche Diener des Rechts, verdienten weit weniger als ihre für privaten Gewinn arbeitenden Kollegen, zum Wohl der Allgemeinheit. Sie verbeugte sich leicht und versuchte, würdevoll auszusehen in ihren Khakishorts. »Herzlichen Glückwunsch, Herr Vorsitzender!«
»Ms. Rosato, eine meiner Lieblingsdemokratinnen!«, rief Richter Sherman aus, und Bennie lachte.
»Und bitte, halten Sie noch eine Weile durch«, erwiderte sie. »Denn außer uns beiden sind nicht mehr viele übrig.«
»Stimmt!«, rief Richter Sherman, und die anderen stimmten gutmütig in sein Lachen ein. Jeder von ihnen wusste, dass die Reihe der republikanischen Präsidenten, angefangen mit Bush senior, den Charakter der Bundesrichterschaft verändert hatte. Es gab heute weit mehr alte, weiße und konservative Richter. Doch die Berufenen waren im Allgemeinen klug und fair und hatten offensichtlich auch Humor. Auch wenn sie kaum noch anerkannten, dass Frauen gemeinsam stark sind.
»Ich will Sie nicht weiter stören«, sagte Bennie. »Feiern Sie schön! Viel Vergnügen!« Sie verließ den Tisch mit einem kurzen Winken, und alle verabschiedeten sich herzlich von ihr. An der Bar begrüßte der Kellner sie mit einem Glas Rotwein. Sie setzte sich, trank langsam ihren Wein und genoss die verschiedenen gebratenen Kleinigkeiten, die sie dazu bekommen hatte. Dabei dachte sie über ihren Klageentwurf nach. Ab und zu betrachtete sie die fröhlichen Menschen um sie herum, die zweifellos alle ihre Ferngespräche bezahlen konnten. Die Garnelen, die sie bestellt hatte, aβ sie schnell und verließ dann das Lokal.
Die Nacht war fortgeschritten, und es lag eine schwere, erwartungsvolle Feuchtigkeit in der Luft. Sie fror ein wenig in ihrem Sweatshirt und sah zum Himmel hinauf, an dem Sturmwolken hingen. Der Mond war nicht zu sehen. Es würde sehr bald wieder anfangen zu regnen, wie es aussah. Kein Taxi weit und breit. Die Gehsteige waren verwaist. Philadelphier blieben Sonntagabend zu Hause, und übrigens auch jeden anderen Abend. Das war es, was sie an ihrer Heimatstadt immer wieder liebte.
Sie ging in westliche Richtung auf das Viertel zu, in dem sie wohnte, und begann, in einem gleichmäßigen Rhythmus zu laufen. Wenn es sein musste, lief sie die ganze Strecke bis nach Hause. Doch ihr Magen fühlte sich unangenehm voll gestopft an, und sie wurde das unheimliche Gefühl von vorher nicht los. Obwohl sie diesmal kein Geräusch hörte, warf sie einen ängstlichen Blick über die Schulter. Ein Sprühregen setzte ein, der sich nach und nach zu einem kalten Schauer entwickelte und auf die parkenden Autos niederprasselte.
Bennie lief schneller.
Sie versuchte, nicht mehr über die Schulter zu sehen.