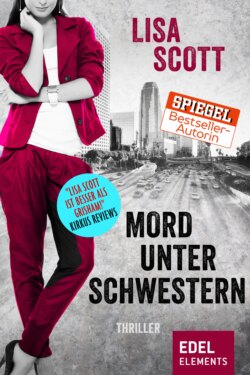Читать книгу Mord unter Schwestern - Lisa Scott - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеBennie Rosato hatte in ihrer Laufbahn schon auf über hundert Geschworenenentscheidungen gewartet, aber das Warten wurde dadurch nicht leichter. Der Gerichtssaal war leer, die Luft war zum Schneiden. Bennie meinte, die Uhr an der getäfelten Wand ticken zu hören, aber vielleicht ging ihre Fantasie schon mit ihr durch. Sie saß neben ihrem Mandanten, Ray Finalil, der an seinen Fingernägeln kaute. Wenn sie diesen Prozess verloren, würde Rays Firma drei Millionen Dollar Schadenersatz bezahlen müssen. Für drei Millionen Dollar bekam man eine Menge Fingernägel.
Bennie beschloss, ihre eigene Nervosität kurzzeitig zu vergessen, um ihn aufzumuntern. »Hey, Ray. Worin liegt der Unterschied zwischen einem toten Hund und einem toten Anwalt?«
»Weiß nicht.«
»Vor dem toten Hund gibt es Bremsspuren.«
Ray lächelte nicht. Sein Blick richtete sich unverwandt auf die Geschworenenbank, deren schwarze Lederstühle in verschiedene Richtungen gedreht dastanden. Die Jury hatte sich an diesem Morgen zur Beratung zurückgezogen, und seitdem hatten sie nichts mehr von sich hören lassen. Das hieß, dass Ray und Bennie nun schon fast sechs Stunden lang Small Talk machten. Bennie kam sich wie verheiratet vor.
»Na gut, keine Witze mehr«, sagte sie. »Erzählen Sie mir, wie Ihr Sohn der Abgott aller Vierzehnjährigen geworden ist. Ich tu so, als wüsste ich nichts von Football.«
»Es war Baseball!«
»Sehen Sie?«
Ray verzog das Gesicht. Seine braunen Augen waren rot geädert von drei schlaflosen Wochen, seine Wangen hohl, weil er während der Verhandlung fünf Kilo abgenommen hatte, und das, obwohl er völlig unschuldig war. Als Angeklagter hatte man nichts zu lachen; wenn man verlor, musste man den Kläger bezahlen, wenn man gewann, den Anwalt. So war es eben im amerikanischen Rechtssystem. Nur Amerikaner lassen solche ungerechten Gesetze zu.
»Passen Sie auf, Ray. Wir müssen nicht hier bleiben. Ich habe mein Handy, und der Protokollführer hat meine Nummer. Wie wär’s mit einem kleinen Ausflug? Wir können die Unabhängigkeitsglocke besichtigen, dazu brauchen wir nur einen Block weit zu gehen.«
»Nein.«
»This land is your land, Ray, this land is my land.« Sie sang es beinah.
»Nein.«
»Kommen Sie. Es tut Ihnen gut, frische Luft zu atmen und ein paar Schritte zu gehen.« Bennie stand auf, streckte sich und machte eine kurze Bestandsaufnahme ihrer äußeren Merkmale: Für eine Anwältin sah sie gut aus, sagte sie sich, obwohl sie über ein Meter achtzig groß war und den Körperbau einer Amazone hatte. Ihr Khakikostüm war gebügelt, und ihr schlichtes weißes Shirt einigermaßen sauber. Ihr langes, störrisches blondes Haar hatte sie mit Hilfe einer Schildpattspange zu einem Knoten gedreht, doch das Blau ihrer Augen wurde nicht durch Lidschatten hervorgehoben, und sie benutzte kein Make-up, um ihre Krähenfüße zu verdecken. Ein Freund hatte ihr einmal gesagt, ihr Mund verrate Großzügigkeit, doch sie hatte den Verdacht, dass er damit eigentlich nur sagen wollte, sie habe einen großen Mund. »Und Sie wollen wirklich keinen Spaziergang machen?«, sagte ihr Mund in diesem Augenblick mitfühlend.
»Wann, denken Sie, kommen sie zurück?« Ray musste nicht erklären, wer »sie« waren. Die Geschworenen.
»Heute Nachmittag.« Bennie setzte sich wieder. Das Dehnen und Strecken ihrer Glieder hatte den Stress etwas abgemildert. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal Sport getrieben hatte. In den letzten zwei Monaten hatte dieser Prozess jede Minute ihres wachen Lebens beansprucht, aber ihre Kanzlei brauchte das Geld dringend. Die Talfahrt der Wirtschaft wirkte sich auch auf Anwälte aus. Es musste schon viel passieren, bevor die Leute heutzutage vor Gericht zogen. Hieß das, dass bald Frieden auf Erden herrschte?
»Ich halte keinen Tag länger durch. Sind Sie sicher, dass sie heute noch zurückkommen?«
»Ganz sicher. Es ist ein ganz normaler Betrugsfall, der nur deshalb vor einem Bundesgericht verhandelt wird, weil die Parteien unterschiedliche Staatsangehörigkeiten besitzen. Und Donnerstag ist ein guter Tag für die Entscheidungsfindung von Geschworenen. Wenn sie heute noch entscheiden, haben sie es geschafft; sie können heimgehen und sich auf ein langes Wochenende freuen. Sie brauchen morgen nicht mehr zu arbeiten.«
»Woher wissen Sie das?«
»Überliefertes Wissen. Die Stammesältesten vermitteln es den Nächstjüngeren in einer geheimen Zeremonie. Um Neulinge zu täuschen, nennen wir es Anwaltsexamen.«
»Aber was machen sie da drin den ganzen Tag?« Ray rieb sich mit seinen stumpfen Fingerspitzen die Stirn. Er war einundfünfzig Jahre alt, sah aber älter aus und war im Lauf des Verfahrens seltsamerweise nicht ruhiger, sondern immer nervöser geworden. Ray war weder der entspannte Typ noch ein Kämpfer. Er war Buchhalter.
»Ein Tag ist gar nichts. Wir haben einen Prozess von vierzehn Tagen hinter uns, mit einhundertsechsundzwanzig Beweisstücken und achtundzwanzig Zeugenaussagen. Wollen Sie wirklich, dass es schneller geht? Es braucht eben seine Zeit.«
Plötzlich öffnete sich die getäfelte Tür neben dem Podium mit den Plätzen für die Geschworenen, und der Protokollführer trat heraus. Er war groß und muskulös, und beim Gehen gab sein Polyesterblazer ein raschelndes Geräusch von sich, das die Würde seines Amtes unterstrich. Bennie stand auf, als sie merkte, dass er auf sie zukam. »Kommen sie zurück?«, fragte sie, und ihr Herz begann, schneller zu schlagen, aber er schüttelte den Kopf.
»Sie haben eine Frage. Sie haben sie dem Richter gegeben. In fünf Minuten geht die Verhandlung weiter. Ist der Kläger noch im Anwaltszimmer?«
»Ja«, antwortete Bennie, und sobald der Protokollführer den Gang hinuntergegangen war, sprang Ray auf und ergriff erregt ihren Ärmel.
»Was meint er damit, eine Frage? Die Geschworenen haben eine Frage? Was für eine Frage?«
»Ganz ruhig. Setzen Sie sich.« Bennie löste Rays Finger einen nach dem anderen und schob ihn mit sanfter Gewalt auf den Sitz zurück. »Der Richter kommt raus und liest uns die Frage vor. Dann ...«
»Eine Frage? Ist das nicht ungewöhnlich? Ich verstehe das nicht. Was kann das heißen?«
»Das kommt manchmal vor. Die Geschworenen schicken dem Richter eine Frage zu einem Beweisstück oder einem Gesetz. Es ist nichts, worüber man ...«
»Ich meine, was müssen Sie denn noch wissen?« Ray zerwühlte mit seiner freien Hand sein schütteres Haar. Zu Beginn der Verhandlung hatte er ausgesehen wie ein Frotteekaninchen. Na ja, das war vielleicht etwas übertrieben. »Wer sagt, dass sie Fragen stellen dürfen? Warum tun sie das?«
»Weil wir hier in Amerika sind. Reißen Sie sich zusammen. Gleich geht’s los.« Bennie deutete dorthin, wo der Saal unvermittelt wieder lebendig geworden war. Der Protokollführer kehrte zurück und ließ seine Fingerknöchel knacken, bevor er sich an die Stenografiemaschine setzte. Ein Gerichtsdiener und eine junge weibliche Bedienstete betraten den Saal durch die getäfelte Tür und nahmen zügig ihre Plätze an der Seite und im vorderen Teil des Raumes ein. Der Kläger und sein Anwalt kamen durch den Mittelgang und setzten sich an ihren Tisch, und der Anwalt nickte Bennie zu.
Bennie nickte zurück, doch das war das Äußerste an Freundlichkeit, was sie sich einem gegnerischen Anwalt gegenüber erlaubte, wenn man von einem flüchtigen Händedruck über den Schreibblock hinweg absah. Sie versuchte nicht, Freunde zu gewinnen; sie wollte die Verhandlung gewinnen. Ihre Loyalität gehörte ganz ihrem Mandanten, selbst einem so kleinmütigen Mandanten wie Ray. Besonders einem so kleinmütigen wie Ray, der sich zur Seite lehnte und anfing zu flüstern und ihr dabei so nahe kam, dass sie riechen konnte, was er zu Mittag gegessen hatte. Ray Finalil war der einzige Mensch auf der Welt, der immer noch Leberwurst mit Zwiebeln aß.
»Was, glauben Sie, werden sie fragen? Was haben sie nicht verstanden?«
»Still jetzt. Stehen Sie auf.« Bennie stand auf, als Richter William Delburton den Saal betrat. Er war ein älterer, grauhaariger Mann, der noch von Präsident Carter ernannt worden war und sich während des Prozesses als hart, aber fair erwiesen hatte. Er saß auf seinem hochlehnigen Lederstuhl auf dem hölzernen Podium unter dem soliden goldenen Gerichtssiegel der Vereinigten Staaten. In der Hand hielt er ein Stück gefaltetes Papier, das er las, während der Protokollführer seinen Text aufsagte.
»Erheben Sie sich!«, rief er unnötigerweise. Die Parteien standen schon, und die Zuschauergalerie war leer. »Die Verhandlung ist eröffnet. Der ehrenwerte Richter William Delburton führt den Vorsitz.«
»Bitte, setzen Sie sich«, sagte der Richter. »Guten Tag, Herrschaften.« Er warf Bennie einen Blick zu, als sie ihren Platz einnahm, dann sah er den Kläger am anderen Tisch an. »Herr Anwalt, Sie haben sicher schon gehört, dass unsere Jury eine Frage hat. Ich lese sie Ihnen vor.«
Ray packte Bennies Hand. Sie tat, als merke sie es nicht. Ein Prozess machte aus Männern kleine Jungen, Frauen wurden zu Tigerinnen.
Richter Delburton setzte eine Lesebrille auf, deren Rahmen im gleichen Schwarz gehalten war wie seine Robe. »Die Frage lautet: ›Herr Richter, dürfen wir dem Kläger mehr als die drei Millionen Dollar zubilligen, die er gefordert hat?‹«
O Gott. Bennies Mund wurde trocken. Das durfte nicht wahr sein. Diese Jury machte es sich einfach zu leicht. Ray sank in seinem Sitz zusammen wie ein Dummy beim Crash-Test.
Der Richter machte eine Geste zum Tisch des Klägers. »Was ist der Standpunkt des Klägers zu dieser Frage, Herr Anwalt?«
»Danke, Euer Ehren.« Der Angesprochene stand auf und konnte ein verstohlenes Kichern nicht unterdrücken. »Unsere Antwort auf die Frage lautet ja. Zusätzlich zu den kompensatorischen Schadenersatzleistungen von drei Millionen Dollar hat der Kläger Anspruch auf weitere Zahlungen als Strafschadenersatz. Wir haben das ungerechtfertigte und betrügerische Verhalten der Firma des Beklagten und ihres Eigentümers, Mr. Finalil, hinlänglich bewiesen. Finanzielle Leistungen, die die drei Millionen zum Ausgleich des Schadens übersteigen, sind mehr als gerechtfertigt.«
»Ich danke Ihnen.« Der Richter nahm seine Brille ab und wandte sich an Bennie. »Ms. Rosato, für den Beklagten, ich bitte um Ihre Einlassung zu der Frage.«
»Danke, Euer Ehren.« Bennie schluckte mit Mühe und stand mit wackligen Knien auf. »Die Antwort auf die Frage der Geschworenen sollte lauten: nein. Die Jury darf über keine Schadenersatzleistungen entscheiden, die nicht von den Beweisanträgen der Klagepartei gestützt werden. Die Jury sollte erneut mit der Entscheidungsfindung beauftragt und darüber belehrt werden, dass ihr Spruch auf nichts anderem gründen darf als auf den vorgelegten Beweisen.«
»Danke, Frau Anwältin.« Der Richter setzte seine Brille wieder auf und legte das Blatt Papier sorgfältig vor sich hin. Das Dokument würde wieder hübsch glatt sein, wenn es in die Berufung ging, was sicher folgen würde, so oder so. »Ich habe Ihre Plädoyers gehört, und ich meine, dass wir die Frage zustimmend beantworten werden. Der Kläger hat Strafschadenersatz gefordert, also kann die Jury Schäden zuerkennen, die die ursprüngliche Schadenersatzsumme von drei Millionen übersteigen. Ich werde sie entsprechend instruieren.«
»Einspruch!«, sagte Bennie reflexartig. Sie warf Ray einen schnellen Blick zu. Er sah aus wie ein Stürmer nach einem vermasselten Tor. Der Protokollführer führte die Geschworenen in den Saal zurück, und der Richter beantwortete ihre Frage und beauftragte sie mit erneuter Beratung. Dann verließen der Richter und die Bediensteten den Raum, der Kläger und sein Anwalt warfen hämische Blicke zur anderen Seite, und Bennie widmete sich wieder Ray. Inzwischen hatte sie ihre Fassung wieder gefunden.
»Ray, Sie dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren«, sagte sie, aber es war zu spät.
»Wie soll ich das verhindern? Haben Sie nicht gehört, was die gesagt haben?« Ray riss seine Brille herunter und rieb sich die Wange, bis sie glühte. »Sie werden ihm über drei Millionen Dollar zugestehen!«
»Nein, das ist noch nicht sicher. Ich gebe zu, es sieht schlecht aus für uns, aber wenn die Geschworenen eine Frage stellen, kann man nie wissen. Sie ...«
»Es ist eine Katastrophe! Eine Katastrophe! Wie können sie mir das antun?«
»Ray. Warten Sie ab. Beruhigen Sie sich.« Bennie ging um den Tisch herum, bediente sich bei einem Stapel Papierbecher und goss ihrem Mandanten aus einem grauen Plastikkrug Wasser ein. »Bitte, hören Sie mir zu. Wir wissen nicht, woher diese Frage kam, und wir wissen nicht, was sie bedeutet. Es ist nicht notwendigerweise eine Frage, die die gesamte Jury stellt, höchstwahrscheinlich kam sie von einem einzigen Geschworenen. Irgendjemandem ist eine Laus über die Leber gelaufen. So was passiert ...«
»Aber diese Frage!« Ray schüttete gedankenlos Wasser in sich hinein. »Haben Sie die Frage nicht gehört? Was soll ich jetzt machen? Ich glaub’s einfach nicht! Das ist die totale Katastrophe!«
»Ich glaube nicht, dass die Beweise des Klägers ausreichend waren. Das ist auch Ihre Meinung gewesen, erinnern Sie sich? Wir haben beide geglaubt, dass er verloren hat, und seither hat sich nichts geändert, außer dass die Jury eine Frage stellte. Also bleibe ich auch bei meiner Meinung.« Bennie sah ihm direkt in die gramvollen Augen, die wie Kilroy über den Rand des Papierbechers lugten. »Scharf war ein lausiger Zeuge, erinnern Sie sich? Er konnte auch im Zeugenstand seine Wut nicht bezähmen, er war unsympathisch, und wütende Kläger gewinnen nie. Erinnern Sie sich an meine Theorie über wütende Kläger?«
»Nein!«
»Doch, natürlich.« Bennie beugte sich vor. »Ray, jetzt hören Sie mal zu. Ich erlebe das alles nicht zum ersten Mal. Jeder flippt aus, wenn die Jury Fragen stellt. Jeder versucht, aus dem Kaffeesatz zu lesen, und redet wirres Zeug. Aber bitte verlieren Sie nicht die Nerven.«
»Aber sie haben nun mal diese Frage gestellt.«
»Vergessen Sie die Frage. Wir wissen nicht, was sie zu bedeuten hat, und wir können nichts daran ändern. Unsere Verteidigung ist sehr gut gelaufen. Sie waren ein großartiger Zeuge, und Jake und Marty ebenso. Wir sind im Recht. Wir haben die Wahrheit gesagt. Also halten Sie, um Gottes willen, durch.«
»Diese ganze Verhandlung bringt mich noch ins Grab!« Ray setzte den Papierbecher ab und verschüttete dabei den Rest Wasser, der sich noch darin befunden hatte. »Sollten wir nicht einlenken? Vielleicht können wir immer noch einen Vergleich schließen!«
»Beim letzten Mal, als wir sie gefragt haben, wollten sie fünfhunderttausend, und so viel haben Sie nicht gehabt. Haben Sie in der Zwischenzeit eine Tankstelle ausgeraubt?« Bennie wartete nicht auf die Antwort. »Und ich bin sicher, dass sie jetzt noch mehr wollen. Also haben wir keine andere Wahl, als abzuwarten.«
»Aber es ist, als wenn wir darauf warten würden, dass uns ein Zug überfährt! Wir können nichts tun, weil wir an die Gleise gefesselt sind.«
»Warten Sie ab, und beruhigen Sie sich.«
»Sie haben leicht reden!«, explodierte Ray, und seine Stimme hallte in dem leeren Gerichtssaal wider. Zornig blitzte er seine Anwältin an. »Wenn ich verliere, müssen Sie keinen Cent zahlen! Sie machen einfach mit dem nächsten Fall weiter! Sie sind einfach eine verdammte Anwältin, nicht anders als alle anderen!«
Bennie fühlte sich getroffen. Eine unsichtbare Mauer stand plötzlich zwischen ihnen. Die Uhr an der Wand tickte sorglos weiter. Diesmal war sie sicher, es zu hören. »Es ist unser Fall, Ray«, sagte sie nach einer Weile.
Sie erwartete nicht, dass er ihr glaubte.
Aber es stimmte.
Schon eine halbe Stunde später wurde die Verhandlung fortgesetzt, und die Geschworenen nahmen ihre Plätze ein. Der Sprecher der Jury hielt ein Stück weißes Schreibmaschinenpapier in der Hand. Es war das Formular, auf dem die Entscheidung stand, eine einzige Frage und eine Antwort. Im Saal herrschte tiefes Schweigen, und alle Blicke wendeten sich den Geschworenen zu. Auch Bennie versuchte, in ihren Mienen zu lesen. Sie bemerkte, dass sie den Augenkontakt mit ihr vermieden, und versuchte, es nicht als schlechtes Zeichen aufzufassen. Sie hörte, dass Ray scharf die Luft einzog. Wenigstens war er nicht mehr grün im Gesicht.
Richter Delburton saß auf seinem schwarzen Lederstuhl auf dem Podium und betrachtete die Jury über den Rand seiner Lesebrille hinweg. Als alle wieder saßen und ihn ansahen, fragte er: »Sind die Geschworenen zu einer Entscheidung gelangt?«
»Jawohl, Euer Ehren«, antwortete der Sprecher. Er stand auf und übergab dem Protokollführer das weiße Formular.
Bennie hielt den Atem an. Ray ballte die Fäuste. Der Protokollführer reichte das Blatt dem Richter, der es gleichmütig überflog. Er gab es dem Protokollführer zurück. Dieser straffte sich, hielt das Formular hoch und las es laut vor: »Frage: ›Ist der Beklagte dem Kläger gegenüber haftbar, und wenn ja, wie hoch ist der Schaden? Antwort: Wir befinden: Der Beklagte ist nicht haftbar.«
Ja! Ja! Ja! Bennie hätte schreien können vor Freude. Sie hatten tatsächlich gewonnen! Sie nickte den Geschworenen dankbar zu, und Ray griff nach ihrer Hand und drückte sie fest. Sie drehte den Kopf, und ein breites Grinsen erschien auf seinem Gesicht, das minutenlang anhielt. Der entsetzte gegnerische Anwalt befragte die Mitglieder der Jury einzeln, und einer nach dem anderen antwortete mit: »Nicht haftbar.« Dann wurden sie vom Richter entlassen, der mit allen Bediensteten den Saal verließ und die Tür hinter sich schloss. »Herzlichen Glückwunsch!«, rief Bennie, als sie wieder allein waren, und Ray fiel ihr um den Hals. Sie umarmte ihn herzlich. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal so froh gewesen war. Oder so erleichtert. »Wir haben gewonnen, Ray! Was für ein Glück!«
»Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen!«, schrie Ray noch lauter, und als sie ihn wieder losließ, sah sie hinter der Brille Tränen in seinen Augen.
»Jetzt ist endlich alles vorbei, Ray!« Bennie drückte ihn noch einmal an sich. Einen ausgewachsenen Buchhalter hatte sie noch nie weinen sehen. Was machte es schon, dass ihn im letzten Moment vor dem Urteil die Panik gepackt hatte? Sie hätte ihm keine Anwaltswitze erzählen sollen. »Freuen Sie sich! Wir haben gewonnen!«
»Ja, und ich kann’s einfach nicht glauben.« Ray nahm seine Brille ab und rieb sich mit Daumen und Zeigefinger die Augen. Er versuchte, seine Fassung wiederzugewinnen. »Sie haben es gesagt, und es hat gestimmt.«
»Ich will nicht weiter darauf herumreiten.« Bennie gab ihm einen Klaps auf den Rücken, warf sich ihre Handtasche über die Schulter und nahm die Aktentasche. »Kommen Sie, lassen Sie uns feiern! Sie müssen mir einen Drink spendieren!«
Doch als Ray zwinkernd seine Brille wieder aufgesetzt hatte, sah er immer noch elend aus. Seine Stirn blieb sorgenvoll gerunzelt, in seinen Augen schwammen Tränen, und seine Unterlippe zitterte.
»Ray, schauen Sie nicht so trübselig! Wir haben gewonnen! Es ist alles vorbei!«
»Nein, nein.« Ray räusperte sich und blickte sie mit feuchten Augen an. »Ich muss Ihnen etwas sagen.«
»Was denn?«
»Ich kann nicht zahlen.«
Bennie lächelte. »Es war nur ein Scherz, Ray. Ich lade Sie ein.«
»Nein, ich meine, ich kann Sie nicht zahlen.« Ray schob seine schmalen Schultern vor. »Was ich Ihnen schuldig bin. Ihr Honorar.«
Bennie warf den Kopf zurück. »Natürlich können Sie mich zahlen.«
»Nein, das kann ich nicht. Es ist schrecklich für mich, das zu sagen, aber ich kann Sie nicht zahlen. Ich habe das Geld nicht.«
»Natürlich haben Sie das Geld.« Verwirrt stellte Bennie Aktenkoffer und Handtasche ab. »Sie sind ein guter Mandant. Sie haben mich im letzten Quartal bezahlt und im vorletzten und vorvorletzten. Ihr Geschäft geht gut.«
»Nicht wirklich. Im letzten Quartal habe ich mir Geld geliehen, um Sie zu bezahlen, und ich dachte, ich könnte es auch diesmal schaffen, weil meine zwei größten Kunden noch beträchtliche Beträge offen stehen hatten. Aber letzten Monat haben sie mir gesagt, sie können das Geld nicht aufbringen, weil ihnen Aufträge fehlen.« Ray befeuchtete seine trockenen Lippen mit der Zungenspitze. »Sie haben beide Konkurs angemeldet. Und ich auch.«
»Sie meinen, Sie sind bankrott?«
»Ja.«
Bennie starrte ihn mit offenem Mund an. »Das kann nicht sein!«
»Doch.«
»Aber Sie sind doch Buchhalter, verdammt noch mal! Ich meine, wie kann so was passieren?«
»Ich bin ein guter Buchhalter, ein guter Geschäftsmann. Aber wir haben eine Rezession, und da gibt es einen Domino-Effekt.«
»Ray, ich rechne mit diesem Honorar!« Bennie hatte in diesem Quartal fast zweihundertfünfzig Stunden ihrer Arbeitszeit in diesen Fall gesteckt, mit Prozessvorbereitung und Verhandlung. Auch wenn sie ihm nur fünfzig Dollar pro Stunde berechnete, war sie immer noch billiger als ein Fliesenleger. »Sie schulden mir fast fünfzehntausend Dollar. Ich kann so einen Verlust nicht ausgleichen. Meine Angestellten warten auf ihre Gehälter.«
»Ich kann Sie nicht zahlen, Bennie.«
»Sie können etwas davon zahlen, oder?«
»Keinen Pfennig. Tut mir Leid.«
»Wir können Raten vereinbaren. Wie wäre das?« Bennie war verzweifelt. Kein Wunder, dass er im Lauf der Verhandlung immer nervöser geworden war; ihm stand der Konkurs bevor. Und jetzt war sie plötzlich in der gleichen Lage. »Hören Sie zu, Ray. Ich kann für Sie arbeiten. Ich arbeite weiterhin für Sie. Sie sind doch mein Mandant.«
»Nein. Sie vertreten meine Firma, nicht mich. Solche Deals sind nicht statthaft.« Ray schüttelte den Kopf. »Wenn ich pleite gehe, müssen Sie sich in die Schlange stellen.«
»Bin ich wenigstens die Erste, die etwas bekommt?«
»Offen gesagt, nein. Es gibt mehrere Justiziare, die Ansprüche erheben werden, und dann meine Steuerberater.«
»Aber was ist mit den Sachverständigen, die wir vorgeladen haben? Sie müssen sie bezahlen. Ich habe ihnen versprochen, dass Sie sie bezahlen. Ich kann es nicht tun, selbst wenn ich das Geld hätte.«
»Tut mir Leid.«
Bennie schwankte. Sie konnte es nicht begreifen. Es gab immer noch die Freude über den Sieg, aber sie hatte im gleichen Augenblick gewonnen und verloren. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte, was zu tun war. Hier half weder Erfahrung noch geheimes überliefertes Stammeswissen. Und Ray sah so gramgebeugt aus, dass sie es nicht übers Herz brachte, ihn umzubringen.
Wie ein Roboter nahm Bennie Handtasche und Aktentasche. »Ich muss zurück an die Arbeit«, sagte sie energisch.
Doch sie sagte es mehr zu sich selbst als zu ihm.