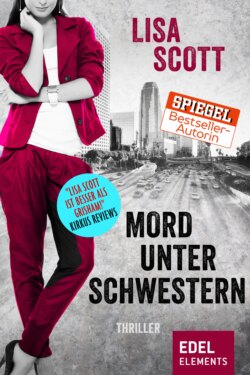Читать книгу Mord unter Schwestern - Lisa Scott - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеBennie suchte jeden Millimeter ihres indischen Teppichs ab, kroch unter Schreibtisch und Stühle. Sie war nicht bereit, diesen Planer mitsamt dem Geld verloren zu geben. Sie hatte nicht die Zeit, sich um einen neuen Führerschein zu kümmern, und sie brauchte dringend ihren Terminkalender. Ohne ihren Terminkalender war sie aufgeschmissen. Sie durchsuchte jedes Regalfach, wühlte in Stapeln alter Briefe, in Mappen mit Rechtsgutachten und Gerichtsentscheiden, in vergilbten Gesetzbüchern. In den Schubfächern ihres Schreibtischs fand sich kein Terminplaner, aber ein altes Bild ihres Exfreundes, Grady Wells, bei einem Wochenendausflug nach Cape May. Sie betrachtete es eine Weile. Vielleicht hätten sie mehr Wochenendausflüge zusammen machen sollen. Das war damals sein Standpunkt gewesen, aber sie hatte schließlich eine Kanzlei, um die sie sich kümmern musste.
Ein schüchternes Klopfen war zu hören, und Bennie wusste sofort, wer es war. Die Sekretärin war nicht da, Judy klopfte wie ein Dampfhammer, und Anne klopfte überhaupt nicht. Bennie schob das Foto in die Schublade zurück und schloss sie energisch, damit niemand auf die Idee kommen konnte, sie gebe sich einer normalen menschlichen Regung hin oder ihre Ritterrüstung weise Löcher auf. »Du bist gefeuert, DiNunzio!«, rief sie laut.
Von jenseits der Tür kam kein Lachen.
»Es war nur ein Witz! Komm rein, Dummchen!«
Die Tür öffnete sich langsam, und Marys entgeistertes Gesicht erschien. »Ich komme nicht rein, wenn du mich feuerst.«
»Ich werde dich nicht feuern.« Bennie machte eine einladende Handbewegung. »Komm rein und setz dich hin.«
»Danke, vielen, vielen Dank, Bennie. Ich kann dir alles erklären. Zuerst: Es tut mir echt Leid, und meine Mutter ist nicht verrückt.« Sie ging zu dem Klubsessel auf der anderen Seite des Schreibtischs und blieb auf der Kante sitzen. Die Worte sprudelten aus ihr heraus, und sie begleitete sie mit hastigen Gesten, einer Art Gebärdensprache. »Sie ist wirklich eine sehr gute Mutter, und ich liebe sie, aber ich hätte nie zugelassen, dass sie mitkommt, wenn ich gewusst hätte, dass sie sich so verhält. Sie hat gesagt, dass sie weiß, wie sie sich zu benehmen hat, aber wahrscheinlich hat sie irgendwann einfach die Selbstbeherrschung verloren, weil sie im Grunde noch lebt und fühlt wie ihre Vorfahren, du hast ja gehört, was sie für einen Akzent hat, sie ist nicht mal hier geboren, und sie regt sich immer so furchtbar auf, weil sie sich Sorgen um mich macht, weißt du, und es tut mir echt Leid. Ich kann es einfach nicht glauben, dass sie sich so benommen hat, es ist mir so entsetzlich peinlich, und ich entschuldige mich dafür. Es tut mir wahnsinnig Leid. Habe ich das schon gesagt?«
»Ja, du ...«
»Ich fühle mich schrecklich. Es ist mir so peinlich. Und ich kann mir vorstellen, wie schrecklich es für dich gewesen sein muss. Es war einfach so wahnsinnig peinlich.«
»Nein. Ich bin erwachsen, und ich bin Anwältin. Ich weiß, wie ich mit so was umgehen...«
»Ich meine, wenn jemand dich so anbrüllt, vor allen Leuten, mitten im Büro, das Ganze war ein Albtraum, absolut, ich konnte es einfach nicht glauben. Es war fürchterlich! Meine Mutter sagt, dass es ihr Leid tut, und mein Vater lässt dir ausrichten, dass es ihm auch Leid tut, und wir sind alle völlig entsetzt über das alles.« Mary hatte anscheinend vor, ihre Litanei fortzusetzen, und alles, was Bennie hatte, war ein Becher mit kaltem Kaffee, den sie ihr über den Tisch hinweg reichte. Ihre Angestellte trank einen Schluck und zog eine Grimasse. »Ii! Das schmeckt ja furchtbar.«
»Ich weiß. Es war ein Versuch, dich zu stoppen.«
»Hat funktioniert.« Sie setzte den Becher ab. »Tut mir Leid.«
»Mir auch. Können wir jetzt zum nächsten Punkt übergehen? Du weißt, dass ich als Trösterin der Betrübten nicht sehr gut bin. Ich ...«
»Aber ich sollte dich trösten!« Marys Augen röteten sich verdächtig. »Du hast nichts Falsches getan. Du hast nur versucht, mir zu helfen, und ...«
»Bitte, halt endlich den Mund!«, rief Bennie, und ihre Angestellte verharrte in tränenfeuchtem Schweigen. »Vielen Dank. Und jetzt hör mir mal zu. Deine Mutter hat allen Grund, mir böse zu sein. Nachdem ich dich in so viele gefährliche Fälle reingezogen habe.«
»Aber das alles ist nicht deine Schuld gewesen, und das habe ich ihr zu erklären versucht. Es war meine Entscheidung, an diesen Fällen zu arbeiten, und dann sind eben diese Dinge passiert. Sie macht sich einfach nur Sorgen, weil ich hier arbeite. Sie will, dass ich kündige.«
»Du kannst tun, was immer du willst.« Bennie konnte sich die Kanzlei ohne Mary nicht vorstellen, aber sie wollte die Schuldgefühle der jungen Frau nicht noch weiter verstärken. »Willst du irgendwo arbeiten, wo deine Mutter sich keine Sorgen um dich machen würde?«
»Das ginge nicht. Sie würde sich immer Sorgen machen, egal, wo ich arbeite. Sie hat sich um meine Schwester Angie Sorgen gemacht, und die war eine Nonne im Kloster.«
Bennie sagte nichts. Sie dachte an ihre eigene Mutter, die schwer krank gewesen und vor zwei Jahren gestorben war. Bennie vermisste sie immer noch jeden Tag.
»Und außerdem liebe ich die Arbeit, die wir hier machen, auch wenn es manchmal Schwierigkeiten gibt. Wir arbeiten für die Gerechtigkeit, oder? Das ist es, was wir tun.« Marys Lippen wurden schmal vor Entschlossenheit. »Ich glaube, dass ich als Anwältin im Lauf der Zeit immer besser werden kann. Ich versuche es wenigstens, und damit will ich nicht aufhören. Und heute habe ich ganz allein dafür gesorgt, dass wir einen neuen Mandanten bekommen.«
Bennie lächelte. Sie hatte Mary noch nie mit solchem Stolz sprechen hören und hatte das Bedürfnis, sie zu loben, auch wenn ihre Angestellte sich hier und da in einem Schriftsatz noch etwas unbeholfen ausdrückte. »Ich glaube, DiNunzio, dass du eine viel bessere Anwältin bist, als du selbst glaubst. Du hast genug Herz und Verstand, um eine der besten deiner Generation zu werden.«
Mary fing beinahe wieder an zu weinen.
»Allerdings fehlt dir noch der Heiligenschein.«
Mary lächelte, aber ihre Augen schwammen immer noch in Tränen.
»Denk nicht mehr an die Szene mit deiner Mutter. Ich bin sicher, wir werden darüber hinwegkommen. Und dann lade ich sie mal zum Essen ein, und wir plaudern ein bisschen.«
»Nein!« Marys Blick weitete sich entsetzt. »Ich meine, danke, aber ich glaube nicht, dass das richtig wäre. Meine Mutter geht nicht zum Essen aus.«
»Warum nicht?«
»Weil es außerhalb ist.«
»Außerhalb von was?«
»Von ihrer Küche.«
»Natürlich ist es außerhalb ihrer Küche.« Bennie dachte wieder an ihre eigene Mutter. Sie hatte solche Depressionen gehabt, dass sie ständig im Bett geblieben war, oft über Monate, in einer Zeit, als es noch keine Antidepressiva gegeben hatte. Nichts hatte gegen ihre abgrundtiefe Traurigkeit geholfen. »Warum geht sie nicht raus? Ist sie krank?«
»Krank? Du hast sie doch gesehen.«
»Hat sie vielleicht Platzangst?«
»Nein. Sie ist Italienerin.«
Bennie gab auf. »Na gut. Dann lade ich sie in ein italienisches Restaurant ein, und sie kriegt einen schönen Teller Pasta.«
»Nein. Sie würde nie eine Sauce essen, die jemand anders gekocht hat. Außer, es ist eine Blutsverwandte.«
»Na gut, dann gehen wir eben nicht aus. Ich besuche sie. Dann kann sie bleiben, wo sie ist.«
»Nein.« Mary schüttelte sich. »Kein Gespräch, kein Besuch.«
»Warum nicht?« Bennie kam die ganze Sache ungewöhnlich kompliziert vor. »Ich will Frieden schließen. Wir können diskutieren. Ich setze größtes Vertrauen in die Macht der Worte.«
»Glaub mir, ihr beiden sprecht nicht die gleiche Sprache. Bennie, du hast das vielleicht noch nicht gemerkt, aber meine Mutter ist voller abergläubischer Vorstellungen. Die hat sie aus Europa mitgebracht.«
»So was wie, dass ich eine leibhaftige Teufelin bin? Wegen unserer Fälle?«
Mary schluckte. »Es ist weniger das, was du tust, als eben deine ganze Person. Was du bist. Wofür du stehst. Wie du dein Haar trägst, dass du groß bist, dass du so anders bist als sie, als ihre Vorstellung, wie eine Frau zu sein hat, dass du nicht verheiratet bist, dass du nicht wie eine Lady aussiehst ...«
Nur zu, spuck alles aus.
»... und außerdem ist es überhaupt nicht rational. Verstehst du, sie ist böse auf dich, weil ich erwachsen geworden bin, weil ich arbeiten gehe, weil ich nicht zu Hause lebe, weil meine Schwester Nonne ist und ich Anwältin und das alles, und ...«
Bennie stoppte den Redestrom wie ein Verkehrspolizist. Merkwürdigerweise verstand sie das alles durchaus. »Okay. Was soll ich also tun?«
»Sieh einfach darüber hinweg. Das wäre das Beste.«
»Das sieht mir gar nicht ähnlich.«
»Manchmal ist es besser, einen Schritt zurückzutreten.«
Kindermund tut Weisheit kund. Bennie straffte sich. »Gut. Okay. Und jetzt zum Fall Brandolini ...«
»Können wir ihn übernehmen? Wenn ich verspreche, mich ganz ernsthaft um ihn zu kümmern und in meiner Freizeit daran zu arbeiten?« Mary sprang auf, fiel auf dem indischen Teppich auf die Knie und rang die Hände wie in einem verzweifelten Gebet. »Bitte, bitte, bitte?«
»Du verrücktes Huhn! Steh auf!« Bennie brach in Gelächter aus.
»Ich bin kein verrücktes Huhn. Ich bin katholisch, und so was machen wir die ganze Zeit. Bitte, bitte, bitte, können wir den Fall übernehmen? Er ist so wichtig. Wir würden dafür sorgen, dass ein schreckliches Unrecht wieder gutgemacht wird. Ich bearbeite ihn ganz allein, das schwöre ich, und der Circolo wird genug Geld dafür aufbringen. Sie können sehr viele Kekse verkaufen, wenn sie wollen. Die mit der Ricottafüllung sind einfach göttlich!«
Die dunklen Augen ihrer Angestellten flehten mit tiefem und unbezweifelbarem Gefühl, und es wurde Bennie klar, dass es um mehr als einen Fall ging. Mary hatte ihren ersten eigenen Mandanten in die Kanzlei gebracht: Sie wurde vor ihren Augen erwachsen, als Anwältin und als Frau. Bennie reagierte mit spontaner Sympathie, ganz anders, als sie sich vorgenommen hatte. Annes Strumpfhose, Judys Haar und jetzt Marys neuer Fall – hatte sie in der Gruppe dieser Mädchen eigentlich immer noch das letzte Wort? Wo blieb ihre Autorität? Die Insassen übernahmen die Leitung des Irrenhauses, und aus irgendeinem Grund brachte Bennie diese Tatsache zum Lächeln.
»So ist es also, wenn man Kinder hat«, murmelte sie.
Und Mary brach in Freudengeheul aus.
Bennie hatte den Terminplaner aufgegeben und wollte gerade die Führerscheinbehörde anrufen, um den Verlust zu melden, als das Telefon klingelte. »Bennie Rosato«, sagte sie in den Hörer, und die Stimme am anderen Ende der Leitung lachte.
»Hab ich Sie endlich erwischt! Es war Dale Gondek, der Hausverwalter, der für ihre Büroräume zuständig war. »Seit zwei Wochen stellen Sie sich tot, wenn ich anrufe!«
Verdammt! Jetzt hat er mich. Bennie bekam einen roten Kopf. Es stimmte. Sie hatte die Nummer des Anrufers auf ihrem Display einfach übersehen. »Sie werden es nicht glauben«, sagte sie. »Aber es gibt gute Neuigkeiten. Ich habe gerade einen großen Fall an Land gezogen, und Sie werden noch diese Woche eine Zahlung erhalten.«
»Wer ist Ihnen in die Hände gefallen? Bill Gates?«
»Sehr witzig. Ich kann Ihnen dreitausend überweisen, sobald ich den ersten Scheck eingelöst habe.« Das Geld von St. Amien und Brandolini hatte sie schon für Gehaltszahlungen, Spesen und Doughnuts mit Cremefüllung reserviert.
»Dreitausend? Das ist genau eine Monatsmiete. Sie sind aber drei Monate im Rückstand, Bennie. Sie haben gesagt, Sie wären wieder flüssig, sobald die Verhandlung zu Ende ist. Ist sie zu Ende?«
Bennie verzog das Gesicht. Ray Finalil. »Ja, aber mein Mandant ist in Konkurs gegangen und konnte mich nicht bezahlen. Können Sie nicht die dreitausend erst mal nehmen? Den Rest bekommen Sie später.«
»Wann, später?«
»Sehr bald.«
»Wie bald?«
Bennie rieb sich die Stirn. Was sollte sie sagen? Sie konnte nicht lügen. Sie war die schlechteste Lügnerin im ganzen Anwaltsverein. »Wollen Sie eine realistische Prognose? In sechs Monaten, wenn es in diesem großen Fall zum Vergleich kommt. Dann werde ich bestimmt nie mehr etwas schuldig bleiben. Ich schwöre.«
»Sechs Monate?« Dale seufzte. »Das ist viel zu lang. Sie wissen, dass ich viel für Sie übrig habe, Bennie, aber ich stehe genauso unter Druck wie Sie.«
»Ich weiß. Und ich weiß Ihre Geduld zu schätzen.« Bennie hatte schon daran gedacht, ihre Kanzlei in das Viertel östlich der Broad Street zu verlegen, wo die Mieten niedriger waren, aber zum jetzigen Zeitpunkt würde sie nicht einmal die Kaution für neue Räume bezahlen können. »Bitte erinnern Sie den Vermieter daran, dass meine Kanzlei jetzt schon fünf Jahre in diesem Gebäude ist und dass ich bis vor kurzem immer pünktlich gezahlt habe. Ich bin eben nur im Moment nicht flüssig.«
»Ich weiß, und das ist der Grund dafür, dass Sie schließlich immer noch hier sind. Ich habe Ihren Rückstand von drei Monaten hingenommen, weil ich wusste, dass Sie diese Verhandlung hatten.«
O nein. »Vielleicht wäre es besser, ich würde selbst mit dem Vermieter reden und ihm alles erklären.«
»Das geht auf keinen Fall. Dafür bin ich da. Und unter uns gesagt, ihm geht es auch nicht blendend. Er braucht das Geld. Können Sie es sich nicht von irgendjemandem borgen?«
»Ich kriege von niemandem mehr Kredit.« Bennie hatte ihr Geschäftskonto bereits weit überzogen. Es gab eine allerletzte Möglichkeit, aber sie brach in Schweiß aus, als sie daran dachte. »Aber ich bezahle meine Miete, das schwöre ich.«
»Ben. Ich kann nichts mehr für Sie tun. Mir sind die Hände gebunden. Bitte lassen Sie es nicht zur Zwangsräumung kommen.«
»Sie haben sie mir ja schon angedroht. Mit einem rosaroten Zettel.« Bennies Blick wanderte zu dem Stück Papier, das zwischen anderen Papieren auf ihrem Schreibtisch lag. Es hatte die gleiche Farbe wie Judys Haar. »Bitte geben Sie mir Zeit. Ein wenig Zeit, ja?«
»Ich kann nicht.«
»Nach dem Gesetz habe ich sowieso noch dreißig Tage, von der ersten Ankündigung der Zwangsräumung an gerechnet. Sobald dieser Fall richtig in Gang kommt, werde ich genug Geld haben. Dann können Sie mir die zweite Ankündigung schicken. Die orangerote.«
»Ich werde sehen, was sich machen lässt. Aber ich verspreche nichts.«
»Tausend Dank, Dale! Sie sind der Größte!«, sagte Bennie und legte auf, bevor er seine Meinung ändern konnte.