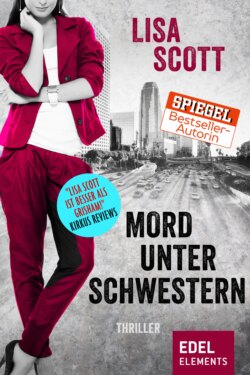Читать книгу Mord unter Schwestern - Lisa Scott - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеAm Freitagmorgen rutschte Bennie auf ihrem Schreibtischstuhl hin und her und schlug ihre langen, schlanken Beine übereinander. Egal, was sie tat, sie schaffte es nicht, sich wohl zu fühlen. Ihre Waden juckten, ihre Oberschenkel taten weh, und ihre Unterwäsche fühlte sich an, als sei sie mit Alleskleber an die Haut geklebt. Sie hasste Strumpfhosen, und sie hatte an wichtigere Dinge zu denken als an Wäscheprobleme, weil ein neuer Mandant sich angemeldet hatte. Sie brauchte dringend einen neuen Fall, nach dem gestrigen Debakel mit Ray Finalil. Doch im Augenblick stand die Modepolizei vor ihrer Tür. Und sie hatte einen Haftbefehl.
»Mach auf!«, rief Anne Murphy durch die Tür und polterte sofort danach in ihr Büro. Anne hatte langes rotes Haar, die atemberaubende Figur eines Models und ein juristisches Abschlusszeugnis aus Stanford. Natürlich hatte jeder sie sofort gehasst, als sie bei Rosato & Associates angefangen hatte, und es hatte lange gedauert, bis man ihr allmählich ihr genetisches Erbe nachsah. Anne klatschte in die Hände wie ein Feldwebel mit perfekt manikürten Händen. »Los, steh auf und zeig dich!«
»Nein, ich muss mich auf das Meeting vorbereiten«, sagte Bennie. Sie fragte sich, ob sie überhaupt noch stehen konnte. Der taillenmodellierende Strumpfhosenrand schnitt in ihre Eierstöcke ein wie ein Skalpell.
»Lass mal sehen.« Anne ging um Bennies Schreibtisch herum. Ihre Absätze waren so hoch, dass man von ihrem Anblick allein Nasenbluten bekam. Dazu trug sie ein schwarzes, eng anliegendes Strickkleid. Mit Mitte zwanzig war sie noch weit von der Einsicht entfernt, dass Strickkleider prinzipiell zu meiden waren. Durchaus erfreut betrachtete sie Bennies Beine. »Sagenhaft! Sie machen was aus dir.«
»Was meinst du? Diese ekligen Wursthäute?« Bennie kam mit Mühe auf die Beine und brachte dadurch das aufgestaute Blut wieder zum Fließen. Im Bürofenster sah sie ihr schmerzverzerrtes Gesicht. Von der Strumpfhose abgesehen, trug sie das gleiche khakifarbene Kostüm wie gestern. Ihr Haar sah etwas ordentlicher aus. »Diese Dinger sind einfach zu eng, Murphy.«
»Gott sei Dank hatte ich noch ein Paar übrig. Deine waren viel zu rustikal.« Anne deutete auf den Papierkorb neben Bennies Schreibtisch, in dem die alte Strumpfhose lag wie eine abgestreifte Schlangenhaut. »Ich kann es einfach nicht glauben, dass du deinem Körper so was antust. Dieses grobe Material! Merk dir: Zieh nichts an, was aus dem Supermarkt kommt.«
»Aber es ist billiger.«
»Ich hoffe, so was sagst du nicht im Ernst. Das, was du jetzt anhast, ist von Nordstrom’s.« Anne überreichte Bennie eine exquisite Packung. »Wenn man schon eine Strumpfhose trägt, was eigentlich total out ist, muss es die sein. Die anderen sind alle total ätzend.«
»Sag bitte im Büro nicht ›ätzend‹«, ermahnte sie Bennie.
»Du sagst auch ›ätzend‹.«
»Nicht mehr. Ich fluche auch nicht mehr. Ich hab mir selbst ein Anti-Fluch-Training verordnet.«
»Was hat ›ätzend‹ mit fluchen zu tun?«
»Tssss.« Bennie studierte kopfschüttelnd die leere Packung, auf der unter dem Preisschild eine sich räkelnde, vollkommen nackte Frau zu sehen war. Sie wusste nicht, was sie mehr überraschte, dieses Bild oder der Preis. »Sag mal, Murphy, kaufst du wirklich Strumpfhosen, die siebzehn Dollar kosten?«
»Natürlich. Und ich finde, auch du solltest nur noch solche tragen. Willst du, dass der neue Mandant dich für eine Niete hält?«
»Ich bin keine Niete«, erwiderte Bennie fast beleidigt. Sie war eine der kompetentesten Anwältinnen in Philadelphia, kannte sich bestens aus in Straf- und Zivilrecht und hatte bis auf wenige Male alle ihre Prozesse gewonnen. Was machte es schon, dass sie so gut wie pleite war, zwei ernsthafte Beziehungen in den Sand gesetzt hatte und ihre Strumpfhosen im Supermarkt kaufte? »Verdammt noch mal, es ist völlig okay, Strumpfhosen im Supermarkt zu kaufen.«
»Sieh dir diese hier doch mal an. Die Farbe ist einfach perfekt.«
Bennie betrachtete ihre Beine. Sie waren straff und muskulös, weil sie jahrelang für Ruderwettkämpfe trainiert hatte; an der linken Wade schlängelte sich eine Vene nach unten und bildete an einer Stelle einen winzigen Knoten. Doch sie konnte überhaupt keine Farbe erkennen, wahrscheinlich, weil die Blutzirkulation in den Beinen mittlerweile völlig aufgehört hatte. »Was soll das für eine Farbe sein?«, fragte sie. »Sie haben überhaupt keine Farbe.«
»Natürlich. Die Farbe ›nackt‹.«
»Nackt ist keine Farbe, sondern ein öffentliches Ärgernis.«
»›Nackt‹ ist einfach die perfekte zweite Haut.«
»Oh, bitte.« Manchmal bezweifelte Bennie, ob Anne Murphy den Hörsaal von Stanford überhaupt je gesehen hatte. »Kauft man eine Strumpfhose, um auszusehen, als würde man keine Strumpfhose tragen?«
»Natürlich. Und du bist die einzige Frau, die das immer noch nicht kapiert hat.« Anne verschränkte ihre lakritzstangendünnen Arme, während Bennie immer nur an die siebzehn Dollar denken konnte. Sie hatte sich selbst seit zwei Monaten kein Gehalt bezahlt. Es war ihr überhaupt nicht zum Lachen zumute. Ray Finalil war nicht der Einzige ihrer Mandanten, der sich in ernsten finanziellen Schwierigkeiten befand; die Rezession hatte bereits dafür gesorgt, dass zwei ihrer lebenswichtigen Geldquellen, die Firmen Caveson und Maytel, aufgeben mussten. Bennie war deshalb gestern bis spät nachts wach gewesen, um die Bücher durchzugehen. Wenn sie ihre Ersparnisse aufbrauchte, würde die Kanzlei noch höchstens zwei Monate durchhalten können, dann war Schluss. Sie hatte die Ausgaben schon auf das Allernötigste reduziert, und jetzt sah sie in die arglosen grünen Augen der Anwältin, die sie als Letzte angeheuert hatte, und es war ihr klar, dass sie auch die Erste sein würde, die sie entlassen musste.
Gelächter kam von der offenen Tür, und der Rest ihrer Mannschaft zeigte sich: die Anwältinnen Mary DiNunzio und Judy Carrier. Wenigstens glaubte Bennie, dass es sich um Judy Carrier handelte, aber sie musste zweimal hinsehen, um sich zu vergewissern. Die junge Frau trug Judys lässige Kordjacke mit weißem T-Shirt, und ein vertrautes Lächeln strahlte aus ihrem runden, hübschen Gesicht. Doch ihr einst zitronengelbes Haar war um die Ohren herum abgesäbelt worden, und der strubbelige Schopf loderte nun in sattem Pink. Bennie war entsetzt.
»Carrier, du hast dein Haar gefärbt!«, sagte sie, und fast wäre ihr wieder ein kräftiger Fluch herausgerutscht. Es war wirklich schwer, bei der Arbeit nicht zu fluchen. »Was ist in dich gefahren? Du bist Anwältin!«
»Ich bin auch Künstlerin. Ich arbeite an meinem eigenen Gesamtkunstwerk!« Judy schwang die Hüften und wiegte ihren ungeheuer schöpferischen Kopf hin und her. »Und außerdem können auch Anwältinnen mal ein bisschen Spaß haben.«
»Nein, das können sie nicht. Außer, sie nehmen eine Geldbuße in Kauf.«
Anne sprang entzückt auf Judy zu. »Jude, das ist super! Und der pinkfarbene Lippenstift dazu! Grandios!«
Selbst Mary quiekte begeistert. »Wahnsinn! So cool! Ich hätte nie den Mut dazu!« Wehmütig fuhr sie mit der Hand durch Judys zerrupfte Strähnen. Ihr eigenes blondes Haar mit leicht angeschrägten Enden war mit einer Klammer nach hinten gesteckt. Sie sah kompakt und konventionell aus in ihrem marineblauen Kostüm. Bei der Arbeit wie auch bei ihrer Kleidung erlaubte sie sich keinerlei Nachlässigkeit. Aber jetzt stimmte sie in das mädchenhafte Gekicher und Gegacker ihrer jungen Kolleginnen mit ein. Ab und zu machte sich in dieser Frauenkanzlei eben auch das Östrogen bemerkbar.
»Hallo! Ladys!«, rief Bennie, und die Köpfe der Frauen fuhren in einmütiger Überraschung herum. Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Carrier, hast du den Verstand verloren? Rosa Haare gehören nicht in eine Anwaltskanzlei. Was soll der neue Mandant davon halten?«
»Ob rosa oder braun, es wird ihm nicht darauf ankommen.« Judys blaue Augen blitzten herausfordernd, aber Bennie wurde die Assoziation einer rosaroten Babybadewanne nicht los. »Meine Freundin Ellen hatte grüne Haare, als ich sie das letzte Mal im Gerichtssaal sah. Die Geschworenen haben in ihrem Sinn entschieden, und nachher wollte jeder wissen, wie sie die tolle Farbe hingekriegt hat.« Plötzlich meldete sich die Gegensprechanlage mit einem Piepsen; Marshall, die Sekretärin, meldete, dass der neue Mandant eingetroffen sei. Alle strafften sich und wurden sofort ernst, vor allem Bennie.
»Das ist er!«, sagte sie. Während alle zur Tür hasteten, sagte Bennie zu Judy: »Kannst du eine Mütze darüber ziehen, Carrier? Oder so was Ähnliches?«
»Ach, komm, Chefin.« Judy klang, als sei sie beleidigt, und Bennie beschloss, die Sache erst einmal auf sich beruhen zu lassen.
»Na gut, dann eben nicht. Du und Murphy werdet an dem Meeting teilnehmen. Wenn wir den Fall kriegen, brauche ich euch beide. Carrier, sag Murphy, wie es geht.«
Judy wandte sich an Anne. »Du schreibst mit und hältst den Mund, und steh ja nicht mittendrin auf, um dich umzuziehen.«
»Sehr witzig«, sagte Bennie und gab ihr einen Klaps auf den Hintern.
Judy lachte. »Um was geht es noch mal? Eine Firmengeschichte?«
»Ja.«
»Weder Mord noch Totschlag?«
»Totschlag einer Firma. Wir waten ausnahmsweise nicht knöchelhoch in Blut. Und kein Gejammer, van Gogh!« Bennie ließ ihre Angestellten allein und machte sich auf den Weg zum Empfang. Sie vergaß die kostspielige Strumpfhose und das künstlerische Haar. In ihrer Brust breitete sich ein Gefühl der Hoffnung aus, das berufsmäßigen Spielern ebenso vertraut ist wie Freiberuflern.
Zehn Minuten später saßen sie alle um den runden Konferenztisch in Bennies Büro. Die Morgensonne schien strahlend durch die großen Fenster an der Nordseite und beleuchtete die weißen Wände mit den Ruderbildern von Thomas Eakins. Diplome der Universität von Pennsylvania, Urkunden für vorbildliche Prozessführung und Ehrenplaketten für gemeinnützige Arbeit hingen an der gegenüberliegenden Wand. In den Regalen sammelten sich juristische Literatur und Zeitschriften, und in einer Kaffeemaschine auf dem gediegenen Eichenbord brodelte frischer Kaffee, der den Raum mit seinem Duft erfüllte. Bennie hatte gewollt, dass das Meeting in diesem Raum stattfand, nicht im Besprechungszimmer, weil es hier wesentlich behaglicher war; sie wollte von Anfang an eine vertraute Atmosphäre schaffen.
»Möchten Sie eine Tasse Kaffee, Mr. St. Amien?«, fragte sie und ging zu dem Eichenbord. Sie hatte keine Schwierigkeiten damit, einem Mandanten Kaffee zu servieren. Dienst am Kunden. Das galt für jedes Geschäft.
»Ja, gern. Schwarz. Danke«, antwortete er mit höflichem Lächeln. Robert St. Amien war ein eleganter Mann von fünfundfünfzig, groß und schlank, mit dunklem Silberhaar und klugen blauen Augen hinter einer Hornbrille. Sein Akzent entstammte dem vornehmsten Pariser Arrondissement, und seine Manieren waren fast berückend. Ein dunkler Anzug warf teure Falten um seine Schultern, und die seidene Krawatte erglänzte in mattem Schimmer.
»Sofort.«
»Und wie gesagt, nennen Sie mich Robert, bitte. Sie alle.« St. Amien warf Judy und Anne einen freundlichen Blick zu. Bennie vermerkte es als höfliche Geste, auch wenn seine Augen ein wenig zu lange bei der prachtvollen Anne verweilten. St. Amien war Franzose; vielleicht war er ein Fan von perfekt manikürten Fingernägeln.
»Nun gut, dann also Robert«, sagte Bennie. Sie griff nach dem einzigen unbeschrifteten Kaffeebecher, ließ diejenigen mit den Aufschriften FEMINAZI, DER BOSS IST EIN BIEST und WAS SAGT MUTTI DAZU? links liegen, füllte den Becher und reichte ihn ihm. Sie selbst nahm sich einen Pappbecher und goss sich Kaffee ein, während sie begann: »Also, Robert, sagen Sie mir, warum Sie hier sind und was ich für Sie tun kann.«
»Eh bien.« St. Amien trank einen Schluck Kaffee und setzte seinen Becher ab. »Wie ich, glaube ich, schon am Telefon sagte, besitze ich eine Firma, die Medizinoptiken herstellt. Letztes Jahr haben wir in Philadelphia unsere erste Niederlassung in den Vereinigten Staaten eröffnet. Wir haben einhundertfünfzig Angestellte in King of Prussia, und wir fertigen spezielle Linsen für medizinische Apparate, etwa Faseroptikmikroskope und andere optoelektronische Systeme.«
Bennie setzte sich. St. Amien hatte ihr diese Dinge schon am Telefon erzählt. Mandanten liebten es, über ihre Geschäfte zu sprechen, und sie nahmen sich Anwälte, um ihre Begeisterung mit ihnen zu teilen. Bennie konnte viel Begeisterung in sich entfachen, wenn es um einen neuen Mandanten ging. Am Ende dieses Meetings würden die optoelektronischen Systeme sie zum Orgasmus bringen.
»Im Gebiet von Philadelphia boomt das Geschäft mit medizinischen Geräten, dank der Konzentration von Krankenhäusern und Forschungsstätten, die wir hier haben, und den Veränderungen im Gesundheitssystem, wodurch die Nachfrage nach diagnostischem Instrumentarium gestiegen ist.«
»Ich verstehe«, sagte Bennie. Manchmal war es gut, einfach irgendetwas zu sagen.
»Im Zusammenhang mit der Eröffnung meiner neuen Niederlassung besuchte ich letzten Monat zufällig einen Kongress des amerikanischen Verbands der Hersteller optischer Linsen, obwohl ich nicht Mitglied dieses Verbands bin. Ich nahm an dem Kongress teil, um zuzuhören und etwas zu lernen. Es gab verschiedene Vorträge mit freier Diskussion, Ich glaube, so heißt das.«
Bennie nippte an ihrem Kaffee. »Ich hasse Vorträge mit freier Diskussion. Ich habe ständig das Gefühl, die freie Diskussion schränkt mich ein.«
St. Amien lachte. »Ich auch. Ganz zufällig landete ich einmal im falschen Vortrag, es gab so viele in diesen Ballsälen dort, und ich setzte mich hinten hin, als sich der junge Mann am Rednerpult gerade über ausländische Hersteller von optischen Linsen ausließ. Er sprach ganz offen. Was er sagte, war: ›Amerikaner sollten in diesem Sommer von Ausländern keine optischen Linsen kaufen, egal, wie weit sie uns im Preis entgegenkommen. Keine ausländischen Linsen! Als Amerikaner müssen wir zusammenhalten, heute mehr denn je!‹«
»Das ist verheerend«, sagte Bennie. Das Verhalten ihrer Landsleute war ihr peinlich, und sie ärgerte sich über das St. Amien zugefügte Unrecht. Doch sie konnte nicht bestreiten, dass es für Rosato & Associates etwas durchaus Erfreuliches bedeutete. Die Aussage war ein unleugbarer Beweis eines Vergehens, und St. Amiens Fall konnte nur gut für sie ausgehen. Blut schoss ihr in den Kopf; aber vielleicht war es die Strumpfhose, die die Hitze in ihr nach oben drückte wie in einem Thermometer.
»Der Vortragende war der Vizepräsident des Verbands der Linsenhersteller. Ich weiß, wie er heißt, sein Name stand im Programm. Ich habe es einfach nicht glauben können, dass er so dreist ist!«
»Das kommt immer wieder vor. Industrieverbände werden nachlässig, weil ihre Mitglieder nicht immer die Wettbewerbsgesetze kennen, und Kriminelle sind hochmütig, ob im Blaumann oder im Anzug.« Bennie beugte sich nach vorn. »Was ist dann passiert?«
»Der ganze Saal klatschte, vielleicht dreihundert Leute, und in der Woche danach verlor ich einen Auftrag über mehrere Millionen Dollar, meinen größten, mit Hospcare.« St. Amien zog die Brauen zusammen, und zwei tiefe Furchen erschienen auf seiner hohen Stirn. »Dieser Auftrag war der eigentliche Grund dafür, dass ich hier eine Fabrik baute. Zwei weitere Aufträge wurden drei Tage nach dem Bruch mit Hospcare gekündigt, und mein letzter Bewerber hat auch schon kalte Füße bekommen.« Er breitete seine Hände aus und drehte die Handflächen nach oben. »Das heißt, ich befinde mich plötzlich in der Lage, dass ich keine Einnahmen mehr habe und es für meine amerikanische Niederlassung keine neuen Aufträge mehr gibt. Als ob der Boden unter meinen Füßen ...« Er sprach nicht weiter.
»Als ob man ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen hätte?«, half Bennie.
»Précisément.«
Sie kannte das Gefühl, wenn auch nicht das französische Wort. »Ich verstehe. Ihre Verluste müssen enorm sein. Können Sie den Schaden beziffern? Alle Schäden aus diesen zurückgezogenen Aufträgen?«
»Der Vertrag mit Hospcare belief sich auf fast drei Millionen Dollar. Die anderen beiden zusammen etwas über fünf Millionen. Mein gesamtes Engagement in den Vereinigten Staaten ist ernsthaft gefährdet, und die Kosten für die neue Fabrikanlage betrugen über fünfzig Millionen.« St. Amien ratterte die Zahlen herunter, als seien sie seine eigentliche Muttersprache. »Ich habe ungefähr sechzig Millionen Dollar verloren.«
Bennie war wie betäubt. Sie konnte nicht rechnen, weil das Blut so laut in ihren Ohren rauschte. Allerdings konnte sie auch nicht rechnen, wenn kein Blut in ihren Ohren rauschte. Früher einmal hatte sie geglaubt, dass sie einfach nur schlecht im Rechnen sei, bis es ihr gelang, sich einzureden, dass sie unter einer Mathematikphobie leide, was nicht von Dummheit, sondern nur von einem psychischen Handicap zeugte. Das war im Umgang mit diesem Problem sehr hilfreich gewesen.
»Es stimmt doch, dass meine Rechte verletzt worden sind?«, sagte St. Amien, der sie mit einem offenbar amüsierten Lächeln beobachtete.
»Äh, ja. Sicher. Absolut. Das stimmt absolut.« Konzentrier dich, Mädchen. »Zusätzlich zu den vertragsrechtlichen Ansprüchen gegenüber der Handelskammer gibt es einen begründeten Anspruch auf Schadenersatz wegen Verletzung der Wettbewerbsgesetze. Das wird sehr einfach zu beweisen sein, wenn wir die Aussage auf der Konferenz haben. Der genaue Sachverhalt muss natürlich ausgearbeitet werden, und das benötigt einige Zeit, doch im Wesentlichen sind Ihre Rechte mit Füßen getreten worden, Robert.«
»Aha.«
»Lassen Sie mich das kurz erklären.« Wenn Koffein versagte, verschafften ihr die Gesetze wieder einen klaren Kopf. »In unseren Wettbewerbsgesetzen steht, dass jeder sich weigern kann, mit irgendeinem anderen Geschäfte zu machen; es ist aber nicht erlaubt, sich zu einer Gruppe zusammenzuschließen und sich als Gruppe zu weigern, Geschäfte mit jemandem zu machen. Gruppenboykott verstößt gegen Bundesgesetze. Die Schadenersatzansprüche sind beträchtlich, und wenn wir sie durchkriegen, wird sich Ihre Firma bald wieder vollständig erholen.«
»Das höre ich gern.« St. Amien erlaubte sich ein weiteres Lächeln.
»Offen gesagt ist Ihr Fall so einfach, dass sogar mein Hund den Prozess gewinnen würde, aber ich bezweifle, dass es überhaupt zum Prozess kommt. Die Beweislage ist eindeutig, und die Ansprüche sind so überwältigend, dass der Verband sicher zu einem Vergleich bereit sein wird, vielleicht schon innerhalb des nächsten halben Jahres.«
»Ausgezeichnet.«
»Ja, das ist es«, sprudelte es aus Bennie heraus, aber dann hielt sie inne. Es gab etwas, das sie in ihrer ersten Gier übersehen hatte. »Warten Sie, Robert. Der Vortragsredner des Verbandes hat über alle ausländischen optischen Linsen gesprochen, nicht nur über Ihre. Gibt es weitere ausländische Hersteller, auf die er sich bezog, wissen Sie das?«
»Ah, oui. Es gibt viele andere wie mich, obwohl ich die größten Verluste zu verzeichnen habe. Ich habe viele Kollegen, die geschädigt wurden, drei aus Deutschland und etliche aus Holland. Außerdem gibt es Firmen aus dem Fernen Osten, besonders aus Japan, und ich weiß, dass sie auch nach einem Anwalt suchen, der sie vertreten kann.«
»Wie viele andere Hersteller optischer Linsen sind hier tätig?«
»Etwa dreißig, vielleicht ein paar mehr im ganzen Land, die alle betroffen sind. Es war ein Kongress des nationalen Verbands, nicht irgendeiner kleinen lokalen Vereinigung.«
O je. Bennie ertrug den Schlag wie ein Mann. In Strumpfhosen. »Das ändert die Lage, Robert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie vertreten sollte.«
»Was?« St. Amiens scharf gezeichnete Lippen öffneten sich leicht. Judy und Anne wechselten verwirrte Blicke.
»Sie können nicht allein klagen. Es handelt sich hier um eine Gruppenklage.« Bennie trank einen Schluck Kaffee, um nicht wie eine Hysterikerin in Tränen auszubrechen. Denn das wäre definitiv nicht professionell. »Ich bin keine Anwältin für Gruppenklagen. Es wäre besser, Sie würden sich einen auf diese Form spezialisierten Anwalt suchen. Er repräsentiert Sie und die anderen gegen den Industrieverband.«
»Eine Gruppenklage? Was ist das?« St. Amien neigte leicht irritiert sein silbernes Haupt.
»Eine Gruppenklage trifft genau auf Ihre Situation zu. Sammelklage, so heißt es auch. Aber wir Juristen sprechen von einer Gruppe. Sie fasst potenzielle Streitgenossen zusammen. Von Einzelheiten abgesehen, geht es bei allen Geschädigten der Gruppe um den gleichen Sachverhalt.« Bennie wurde sich bewusst, dass sie selbst über die Gruppenklage nicht mehr wusste als das, was sie ihrem Gegenüber gerade erläutert hatte. Genau das war das Problem. »Ich bin kein Experte in Gruppenklagen, aber ich kann Ihnen helfen, einen wirklich kompetenten Anwalt zu finden.«
Am anderen Ende des Tisches schüttelte Anne missbilligend den Kopf. Ihre schimmernde kupferrote Mähne schwang hin und her wie in einem Werbespot für Shampoo. »Ich bin sicher, wir kommen mit einer Gruppenklage zurecht, Bennie. Ich habe schon einmal bei einer Gruppenklage mitgearbeitet, bevor ich hier anfing.«
Judy neben ihr sah genauso unglücklich aus. »Wir können eine Gruppenklage vertreten, Chefin. Wir haben schon so viele Kartellsachen gemacht, und wir können die Verordnungen zur Gruppenklage genau so gut lesen wie jeder andere auch. Wir müssen uns nur einarbeiten.«
In Bennie stieg der Wunsch auf, ihre beiden Angestellten zu erwürgen, als St. Amien in den Chor einstimmte: »Ich würde mir ehrlich wünschen, dass Sie mich vertreten, Benedetta. Ich habe gehört, dass Sie bei Gericht über ein hohes Ansehen verfügen. Sie sind außerordentlich fähig und erfahren. Mein Sohn macht seine Ausbildung hier in Amerika, und er hat mir erzählt, dass man Ihnen sogar die Examensfragen an der juristischen Fakultät in Harvard zur Beurteilung vorlegt. Er hat mich auf Sie verwiesen. Er sagt, Sie sind in gewisser Weise eine Außenseiterin. Das stimmt doch, oder?«
Außenseiterinnen tragen keine Strumpfhosen für siebzehn Dollar. »Ich weiß nicht ...«
»Es stimmt. Ihr Büro sieht nicht so gestylt und prätentiös aus wie das von anderen Anwälten. Ihr Verhalten ist ehrlich.« St. Amien deutete auf die jungen Frauen auf der anderen Seite des Tischs. »Sehen Sie sich nur Mademoiselle Carrier an. Sie darf sich hier frei ausdrücken, sowohl in geistiger Hinsicht wie auch hinsichtlich ihres Äußeren. Das spricht Bände über Sie.«
Bennie fehlten die Worte. Nicht die kleinste banale Bemerkung fiel ihr mehr ein.
Judy grinste. »So ist Bennie immer gewesen. Ja. Und sie findet meine Haare toll.«
St. Amien fuhr fort: »Ich bin auch ein Außenseiter. Ein Franzose, der sich in Philadelphia zu Hause fühlt. Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen, bis dieser Verband kam und sich quer stellte. Sie haben mein Geschäft ruiniert, nur weil ich nicht einer von ihnen bin. Aus all diesen Gründen möchte ich, dass Sie mich vertreten.«
»Warten Sie eine Sekunde, Robert«, sagte Bennie. »Um Sie zu vertreten, müsste ich die gesamte Gruppe vertreten, und Ihre Verluste sind so hoch, dass Sie wahrscheinlich der Hauptkläger wären, das wichtigste Mitglied der Gruppe.« Anwalt des Hauptklägers, das hieß federführende Anwalt! Es würde definitiv spannend werden. Und die Honorare bei Gruppenklagen gingen von Mars bis Pluto. »Aber ich habe keinerlei Erfahrung bei Gruppenklagen.«
St. Amien zuckte die Achsel. »Dann fangen Sie jetzt an, Erfahrungen zu sammeln. Ich bin sicher, Sie werden die Sache hervorragend bewältigen.«
»Hast du wirklich so wenig Selbstvertrauen, Chefin?«, fragte Judy ungläubig.
»Lieber Gott!« Annes sorgfältig geschminkte Augen weiteten sich. »Du bist die berühmte Bennie Rosato!«
»So einfach ist es nicht, meine Lieben«, sagte Bennie tonlos. Sie knirschte mit den Zähnen und versuchte, sie mit zornigen Blicken zum Schweigen zu bringen. Mary hätte hier sein sollen statt dieser beiden Verrückten. Mary hätte begriffen, dass man im Beisein von Mandanten niemals über familiäre Angelegenheiten spricht. Bennie wandte sich an St. Amien. »Unsere Gesetze lassen es nicht zu, dass ich mich einfach selbst zum Gruppenanwalt ernenne. Ich muss zugelassen sein. Anwälte, die eine Gruppe vertreten wollen, müssen ihre Kompetenz und Erfahrung beweisen.«
»Das könnte ich machen«, sagte Judy. »Ich kann sofort einen Antrag auf Zulassung schreiben. Lass uns den Fall übernehmen!«
Bennie blieb hart. »Wir sind nicht dafür qualifiziert, Carrier.«
»Wir übernehmen ständig Fälle, für die wir nicht qualifiziert sind!«
Nur weiter so.
»Wir waren keine Experten für Mord, als wir angefangen haben, Mordfälle zu übernehmen, und jetzt machen wir es dauernd. Wir haben dazugelernt.« Judy ließ sich nicht mehr aufhalten. »Bennie, du hast super viel Gerichtserfahrung, du bist super qualifiziert als Anwältin, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen einzigen Richter im ganzen Distrikt gibt, der dich nicht akzeptieren würde. Sie finden deine Plädoyers toll. Sie haben dich bei zwei verschiedenen Planungsausschüssen zugelassen.«
St. Amien nickte. »Ausgezeichnet. Nun denn, ich habe mich entschieden. Ich stimme den beiden jungen Damen zu. Also.« Er schob die Hand in sein Jackett und holte ein in burgunderfarbenes Leder gebundenes Scheckbuch sowie einen teuren dunkelroten Füllfederhalter heraus. Er öffnete das Scheckbuch und begann, einen Scheck auszustellen, und an dieser Stelle explodierte Bennies Strumpfhose.
»Bitte, Robert, tun Sie das nicht.« Nicht. Halt. Weitermachen. »Nicht.«
»Ich gehe davon aus, dass Sie es mir nachsehen werden«, sagte St. Amien mit einem verschmitzten Lächeln. Er schrieb zu Ende und riss den Scheck ab. Dann steckte er Scheckbuch und Füller wieder zurück in sein Jackett. »Ich habe Ihnen Geld angewiesen, in der Hoffnung, dass Sie mich vertreten werden. Betrachten Sie es als Handgeld. So nennt man das doch?«
»Selbst wenn ich den Fall übernehmen würde, Robert, was ich nicht tue, bliebe das weitere Vorgehen doch noch völlig offen. Bitte, behalten Sie Ihren Scheck!«
»Alors, betrachten Sie es als Vorschuss für Ihre Auslagen.«
»Bei einer Gruppenklage sind Vorschüsse nicht üblich. Bitte, tun Sie das nicht.« « Bitte. Nicht. Aufhören!
»Vertreten Sie mich. Bitte, würden Sie es für mich tun?« St. Amien legte den Scheck vor sich auf den Tisch wie ein Trumpf-Ass.
Nein. Ja. Nein. Ja. Dann hörte Bennie ein Geräusch. Der Sirenengesang der Solvenz. Ihr Herz machte einen Sprung. Vielleicht war ihre Kanzlei doch nicht zum Untergang verurteilt! Vielleicht würde es bei der Gruppenklage sehr bald zum Vergleich kommen! Wenn sie vom Gericht nicht akzeptiert würde, würde sie sich wenigstens sagen können, dass sie es versucht hatte. Warum sollte sie ihre Niederlage proklamieren, wenn es so viele qualifizierte Leute gab, die darauf brannten, das zu tun? »Na gut, Sie haben mich überzeugt«, sagte sie, und St. Amien lachte.
»Merci beaucoup. Ich bin sehr froh. Jetzt werde ich mich verabschieden.« Er stand auf und verbeugte sich vor Judy und Anne. »Ich danke Ihnen, meine Damen, für Ihre Unterstützung.«
»Wir danken Ihnen«, sagte Judy, und Anne nickte.
»Ja, es war uns ein Vergnügen.«
Bennie schob ihren Stuhl zurück. »Ich bringe Sie hinaus«, sagte sie und führte St. Amien aus dem Büro in den leeren Gang hinaus, wo er sich zu ihr wandte.
»Ich finde den Weg. Nochmals danke für alles. A bientôt.« Unvermittelt beugte sich St. Amien zu ihr und gab ihr einen leichten Kuss auf die Wange. Dann drehte er sich um und ging.
»Bis bald.« Bennie blinzelte ungläubig. Sie hatte noch nie einen Mandanten gehabt, der sie küsste, aber es hatte sich nicht unangenehm angefühlt. Sie sah, wie er in den Aufzug stieg, und hatte das vage Gefühl, als hätte er sie um ein vertrauliches Rendezvous gebeten. Dann ging sie in ihr Büro zurück, um ihre Angestellten zur Schnecke zu machen. »Verdammt noch mal! Wenn das noch einmal vorkommt, dass ihr mir vor einem Mandanten widersprecht...«
»Der Scheck lautet über zehntausend Dollar!«, rief Anne mit schriller Stimme, und von Judy kam ein überaus albernes Gekicher. Mary war hereingekommen und trat zu ihnen, und alle drei wandten Bennie ihre aufgeregten Gesichter zu. St. Amiens Scheck wanderte von einer heißen Hand zur anderen.
»Zehn Riesen? Das kann nicht sein«, sagte Bennie und griff nach dem Scheck. Die Tinte war kaum getrocknet, die Schrift sah europäisch aus, doch in der Zeile für den Empfänger stand eindeutig: Benedetta Rosato. Sie versuchte vergeblich, sich zu erinnern, wann sie das letzte Mal ihren Namen in dieser Zeile gelesen hatte. Und zehntausend war das Doppelte ihres üblichen Honorars. Damit waren zwei Angestellte für die nächsten beiden Monate gesichert, und für Anne würde sie mit ihren Ersparnissen aufkommen. »Sacré bleu!«
»Klingt, als hätten wir einen echt interessanten Fall«, sagte Mary, und Anne nickte.
»St. Amien ist süß für sein Alter.«
»Und wir können die Arbeit gut brauchen«, sprudelte es aus Judy heraus. »Seit es Caveson und Maytel erwischt hat, habe ich nichts mehr zu tun. Das heißt, ich habe überhaupt keine Arbeit mehr.«
Bennie starrte mit rotem Kopf den Scheck an. Dass es keine Arbeit mehr gab, war ein offenes Geheimnis, aber es war ihr peinlich, mit ihren Angestellten darüber zu sprechen. Warum hatte sie es nur so weit kommen lassen können, dass sie nun in dieser Lage war? Hatte sie die Kanzlei schlecht geführt? Warum hatte sie Ray Finalil nicht umgebracht? Sie riss sich zusammen und ging steifbeinig um den Tisch, um ihre Handtasche zu holen. »Ich gebe dir erst mal deine siebzehn Dollar zurück, Murphy. Diese Strümpfe kann ich ohne Schweißgerät nicht mehr ausziehen.«
Anne winkte ab. »Vergiss das Geld. Ich hab anschreiben lassen.«
Mary sah sie missbilligend an. »Das bedeutet nicht, dass sie nichts kosten, Murphy.«
»Doch. Einen Monat lang.«
Judy schüttelte ihren quietschrosa Kopf. »So was lernt man auf der Managerschule.«
Schluck. Bennie behielt ihre Gedanken für sich. Sie hatte nicht das Recht, irgendjemandem Vorschriften zu machen. St. Amiens Scheck würde das Schlimmste verhindern, aber damit hatte sie das Problem noch nicht gelöst. Sie musste die Kanzlei so lange über Wasser halten, bis es bei der Gruppenklage zum Vergleich kam. Sie öffnete ihre alte, längst formlos gewordene Handtasche und kramte nach ihrem Geld. Sie stieß auf Schlüssel, Papiertaschentücher und ihr silbernes Handy, aber was sie suchte, war nicht da: ein dicker schwarzer Terminplaner mit Zusatzfächern, in denen sie ihre Kreditkarten und ihr Kleingeld aufbewahrte.
»Bennie, du musst mir das wirklich nicht zurückgeben«, sagte Anne. »Wenn du das nächste Mal bei deinem Supermarkt vorbeikommst, kannst du mir ein T-Shirt kaufen.«
Aber Bennie hörte nicht zu. Sie war jetzt bis zum Boden der Tasche gelangt, aber der Terminplaner war nicht da. Sie leerte die Tasche auf dem Tisch aus. Der Tisch lag voller Dinge. Eselsohrige Schriftsätze, Briefe und Fotokopien, eine Plastikpistole, ein Laptop und ein leerer Kaffeebecher. Sie räumte alles weg und konzentrierte sich auf den Inhalt der Tasche. »Bitte sagt mir, dass mein Terminplaner noch da ist. Ich kann ihn nicht verlieren. Ich kann nichts tun ohne ihn.«
»Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen?«, fragte Mary, als Bennie schon dabei war, die Spur des schwarzen Terminplaners zurückzuverfolgen.
»Freitag. Ich bin mit dem Hund rausgegangen, dann hab ich mich angezogen und bin zur Arbeit gefahren. Bei Dunkin’ Donuts hab ich einen Kaffee getrunken. Mit viel Milch und Zucker.«
»Vielleicht hast du ihn dort liegen lassen.«
»Nein.« Bennie schüttelte den Kopf. Wenn sie irgendwo kurz einen Kaffee trank, holte sie nicht jedes Mal ihren Terminplaner heraus. Ohne umständliche Kramerei nahm sie einfach zwei Dollarscheine aus einem Seitenfach. Dann zahlte sie und ließ das Wechselgeld als Trinkgeld auf dem Teller. »Das ist wirklich seltsam. Ich weiß, dass er in meiner Handtasche war. Ich kann mich erinnern, dass ich ihn da gesehen habe.«
Mary verschränkte die Arme. »Vielleicht täuscht dich die Erinnerung. Du warst wahrscheinlich mit dem Meeting heute Morgen beschäftigt.«
»Vielleicht.« Bennie dachte angestrengt an die Viertelstunde im Dunkin’ Donuts. Es war voll gewesen. Sie hatte an Ray und an Geld gedacht und die Schlagzeilen der Zeitungen überflogen, die am Ständer neben der Kasse steckten. WIRTSCHAFT ERWARTET NEUE EINBRÜCHE. WEITERE ENTLASSUNGEN ANGEKÜNDIGT. Die Nachrichten hatten sie deprimiert. »Ich muss ihn dort verloren haben.«
»Ich ruf den Laden an«, sagte Anne teilnahmsvoll. »Ist es der hier unten in der Straße?«
»Ich würde sofort die Kreditkarten sperren lassen, Bennie«, sagte Mary.
Judy betrachtete prüfend Bennies Gesicht. »In letzter Zeit bist du öfter ein bisschen vergesslich, Chefin. Ist irgendwas los?«
»Überhaupt nichts«, antwortete Bennie. Sie brachte mühsam ein Lächeln zustande und schob St. Amiens Scheck in ihre Handtasche. »Was soll los sein? Wir haben gerade einen riesigen Fall an Land gezogen!«
»Jaaaa!«, jubelte Judy und klatschte in die Hände. »Das müssen meine neuen Haare gewesen sein, oder, Chefin?«
»Klar«, stimmte Bennie zu, und diesmal war ihr Lächeln echt.