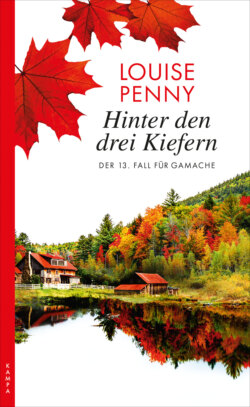Читать книгу Hinter den drei Kiefern - Louise Penny - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
Оглавление»Kommst du heute nicht nach Hause?«, fragte Reine-Marie, als Armand an diesem Abend anrief.
»Ich fürchte, nein. Ich übernachte in der Wohnung in Montréal. Es gibt hier so viel zu tun, und die Verhandlung beginnt früh.«
»Soll ich kommen? Ich kann etwas aus dem Bistro mitbringen.«
»Nein, schon gut. Ich bin wahrscheinlich keine gute Gesellschaft. Und ich muss arbeiten.«
»Der Prozess?«
»Ja.«
»Bist du zufrieden, wie es läuft?«
Er rieb sich die Stirn und dachte über die Frage nach. »Schwer zu sagen. So viele Einzelteile müssen sich zu einem Ganzen fügen. Und dabei könnte stattdessen jederzeit alles auseinanderfallen.«
Reine-Marie hatte schon öfter erlebt, dass er sich Sorgen wegen eines Gerichtsprozesses machte, insbesondere was die Aussagen bestimmter Zeugen betraf. Doch in diesem Fall war er bisher der einzige Zeuge. Was konnte ihn jetzt schon so beunruhigen?
»Wird es eine Verurteilung geben?«
»Ja.«
Seine Antwort kam jedoch zu rasch, zu entschieden für einen Mann, der für gewöhnlich besonnen und nachdenklich war.
»Was machst du zum Abendessen?«, fragte sie.
»Ich esse irgendwas hier im Büro.«
»Allein?«
Gamache spähte durch die einen Spalt offenstehende Tür in das Besprechungszimmer, wo sich Jean-Guy, Isabelle und die anderen Kollegen über Landkarten beugten. Auf dem langen Tisch verteilt standen Kaffeebecher und Platten mit Sandwiches aus der Brasserie um die Ecke, dazu Wasserkrüge, Laptops und Unterlagen. Dahinter sah er die Lichter von Montréal.
»Ja.«
Chief Superintendent Gamache gesellte sich zu seinem Team, setzte seine Brille auf und beugte sich über die große Karte von Québec.
Darüber waren Folien ausgebreitet, auf die in verschiedenen Farben Linien gezeichnet waren.
Kräftige Striche. Rot. Blau. Grün. Mit schwarzem Filzstift. So schwarz, dachte Gamache, während er die Linien studierte, wie das Geheimnis, das sich dahinter verbarg.
Für sich genommen, ergaben die bunten Linien auf den einzelnen Folien keinen Sinn. Doch sobald man sie übereinander auf die Karte von Québec legte, verbanden sich die Linien miteinander. Ein zufälliger Betrachter hätte es für ein U-Bahn-Streckennetz halten können. Ein sehr großes Netz, mit regem Verkehr.
Damit hätte er nicht mal so weit danebengelegen.
Tatsächlich war es eine Karte der Unterwelt.
Einige Linien schlängelten sich am Sankt-Lorenz-Strom entlang. Andere kamen aus dem Norden herunter. Viele zweigten von Montréal und der Stadt Québec ab. Aber alle führten zur Grenze zu den Vereinigten Staaten.
Superintendent Toussaint, die neue Leiterin der Abteilung für Schwerverbrechen, nahm einen blauen Filzstift aus der Tasse auf dem Konferenztisch.
In den Augen einiger jüngerer Mitglieder des inneren Zirkels hätte sie genauso gut zu Hammer und Meißel greifen können, so primitiv war diese Methode des Kartographierens. Sie waren an Laptops und präzisere, effizientere Werkzeuge gewöhnt.
Aber die Karte und die Folien hatten einen großen Vorteil. Man konnte sie nicht hacken. Und einzeln betrachtet, konnte man nicht erkennen, was sie bedeuteten.
Und das war entscheidend.
»Hier die neueste Information«, sagte Madeleine Toussaint. »Unser Informant auf den Magdalenen-Inseln meldet, dass vor zwei Tagen eine Lieferung an Bord eines Frachtschiffs aus China eingetroffen ist.«
»Vor zwei Tagen?«, fragte ein Kollege. »Warum bekommen wir diese Information dann erst jetzt?«
»Wir können von Glück reden, dass wir sie überhaupt bekommen haben«, erwiderte Toussaint. »Wir alle wissen, was passiert, wenn sie unseren Informanten enttarnen. Und er weiß es auch.«
Sie senkte den Stift, und auf den Inseln im Sankt-Lorenz-Golf erschien ein blauer Fleck.
»Wissen wir, wie viel?«, fragte Beauvoir.
»Achtzig Kilo.«
Sie sahen sie schweigend an.
»Fentanyl?«, fragte Isabelle Lacoste.
»Ja.« Toussaint hob den Stift. Blau für Fentanyl.
Sie wechselten einen Blick. Achtzig Kilogramm.
Das wäre die bislang größte Lieferung nach Nordamerika. Beinahe das Doppelte der bisherigen Lieferungen. Auf jeden Fall die größte, von der sie wussten.
Die Kartelle wurden immer dreister.
Warum auch nicht? Sie kamen praktisch ungeschoren davon.
Alle im Raum drehten sich zu Chief Superintendent Gamache, der auf die winzige, zwischen Gaspé und Neufundland im Meer treibende Inselgruppe starrte. Ein reizvolleres Fleckchen Erde war nur schwer zu finden. Oder ein besserer Ort für den Drogenhandel.
Windumtost, abgelegen, kaum bewohnt. Und trotzdem auf einer wichtigen Handelsroute für Frachtschiffe rund um die große weite Welt.
Ein Einfuhrhafen nach Québec. Nach Kanada. Eine Art Hintertür. Eine Drehtür. Wenig beachtet von den Behörden, die damit beschäftigt waren, die großen Häfen im See- und Luftverkehr zu überwachen.
Die Topadresse waren jedoch die winzigen, unbeschreiblich schönen Magdalenen-Inseln.
Und von dort aus?
Gamache musterte die vielen kräftigen farbigen Linien.
Sie begannen an verschiedenen Stellen in Québec, führten jedoch alle in dieselbe Richtung.
Die Grenze. La frontière.
Die Vereinigten Staaten.
Fast alle Linien, alle Farben liefen zusammen und gingen mitten durch ein winziges Dorf, das in der Karte nicht einmal eingezeichnet war. Gamache hatte es markieren müssen.
Three Pines.
Doch jetzt verschwand es unter den Filzstiftstrichen auf dem Weg zur Grenze.
Durch diese Lücke in der Grenze flossen Drogen in die Vereinigten Staaten, und das Geld floss zurück.
Tonnenweise Kokain, Methamphetamine, Heroin hatten hier die Grenze überquert. Jahrelang.
Als Gamache die Leitung der Sûreté übernommen und das Ausmaß des Drogenproblems in und um Québec erkannt hatte, war ihm noch etwas anderes klargeworden. Nur ein Bruchteil des Drogenhandels erfolgte auf den bereits bekannten Routen.
Wie also kam der Rest ins Land?
Armand Gamache, der neue Chief Superintendent der Sûreté du Québec, hatte seine Leute auf die Drogen angesetzt, die in Québec hergestellt wurden, und diejenigen, die importiert wurden. Diejenigen, die hier konsumiert wurden, und diejenigen, die für einen lukrativeren Markt bestimmt waren.
Er stellte Teams zusammen. Es wurden Wissenschaftler, Hacker, Exhäftlinge, Informanten, See- und Luftfahrtexperten, in Motorradgangs eingeschleuste verdeckte Ermittler, Hafenarbeiter, Gewerkschaftler, Packer und sogar Marketingleute angeworben. Die meisten hatten keine Ahnung, worum es letztlich ging, nicht einmal, für wen sie eigentlich arbeiteten. Jeder bildete eine eigene kleine Zelle und hatte ein einzelnes Problem zu lösen.
Und so wie all die Drogen an einen Ort geleitet wurden, geschah das auch mit all den Informationen.
Zu Chief Superintendent Gamache.
Die Sûreté musste einen entscheidenden Schlag landen. Nicht eine Reihe kleiner Störaktionen, sondern einen harten, raschen, wirkungsvollen Schlag. Direkt ins Herz.
Nach fast einem Jahr intensiver Ermittlungen hatten sich die Linien auf den Folien weiter ausgedehnt. Hatten sich gekreuzt. Verschlungen. Und ein Muster wurde sichtbar.
Aber noch immer wurde Chief Superintendent Gamache nicht aktiv.
Trotz der dringenden Bitten einiger Kollegen wartete Armand Gamache. Und wartete. Bekam die Wucht von der immer lauter werdenden Kritik ab, die von privater Seite, aus Polizeikreisen und Politik kam, von der breiten Öffentlichkeit und von Kollegen, die nur eine steigende Verbrechensrate und Untätigkeit seitens der Sûreté sahen.
Dann hatte das Team endlich gefunden, wonach es suchte. Die Person, die alle Fäden in der Hand hielt.
Den Durchbruch verdankten sie der Zusammenarbeit, der Intelligenz und dem Mut von verdeckten Ermittlern und Informanten.
Und dem Auftauchen einer dunklen Gestalt auf einem von Schneeregen gepeitschten Dorfanger.
Nur wenige wussten, dass das der Wendepunkt war, und Gamache setzte alles daran, damit es so blieb.
Die Beamten sahen Chief Superintendent Gamache an. Warteten darauf, dass er etwas sagte. Etwas tat.
Superintendent Toussaint senkte den hellblauen Filzstift und zog auf der Folie eine Linie vom Hafen auf den Magdalenen-Inseln um die Küste der Gaspé-Halbinsel herum. Die Spitze des Filzstifts quietschte leise, als sie den großen Sankt-Lorenz-Strom entlangfuhr. Schließlich landeinwärts abbog. Und weiter nach Süden, immer weiter.
Bis die blaue Linie auf die Grenze traf.
Dort blieb Toussaints Hand stehen.
Sie sah zu Gamache. Der auf die Karte sah. Auf die Markierung.
Dann blickte er über den Rand seiner Brille. An seinen Mitarbeitern vorbei zur Tafel an der Wand.
Eine andere Art von Karte. Sie zeigte nicht die Wege der Drogen und des Geldes, der Gewalt, sondern die der Macht.
An die Tafel waren Fotos geheftet. Einige davon aus der Verbrecherkartei, die meisten jedoch heimlich mit einem leistungsstarken Objektiv aufgenommen.
Männer und Frauen, die ihren täglichen Verrichtungen nachgingen. Alles ganz normal. Nach außen hin. Aber unter ihrer Haut verbarg sich eine innere Leere.
Ganz oben, wo sich all die Linien und Bilder trafen, war lediglich eine dunkle Silhouette. Kein Bild.
Gesichtslos. Formlos. Nicht wirklich menschlich.
Armand Gamache wusste, wer das war. Er hätte ihm tatsächlich ein Gesicht geben können. Entschied sich jedoch dagegen. Für alle Fälle. Einen Moment lang blickte er in dieses dunkle, leere Gesicht, dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder Superintendent Toussaint zu. Und nickte.
Sie zögerte, vielleicht, um ihm Gelegenheit zu geben, es sich anders zu überlegen.
Im Raum herrschte Totenstille.
»Das können Sie nicht machen«, sagte Toussaint leise. »Achtzig Kilo, Sir. Sie sind vielleicht schon auf dem Weg. Ich habe nichts mehr von unserem Informanten gehört. Wir sollten wenigstens ein paar Leute postieren.«
Der Chief Superintendent nahm ihr den Filzstift aus der Hand und zog, ohne zu zögern, eine letzte Linie.
Ein Strich quer über die Grenze, wo das Opioid Québec verließ und in die Vereinigten Staaten kam.
Dann steckte er mit einem entschlossenen Klick die Kappe auf den Stift, blickte in die Gesichter seiner vertrauenswürdigsten Mitarbeiter und begegnete in jedem dem gleichen Ausdruck.
Entsetzen.
»Sie müssen etwas tun«, sagte Toussaint, und ihre Stimme wurde mit jedem Wort lauter, bevor sie sie wieder unter Kontrolle hatte. »Sie dürfen nicht zulassen, dass es die Grenze überquert. Achtzig Kilo«, wiederholte sie mühsam beherrscht. »Wenn Sie nicht …«
Gamache richtete sich auf. »Fahren Sie fort.«
Stattdessen verstummte sie.
Er musterte die anderen Gesichter und musste nicht erst fragen, wer ihrer Meinung war. Es war offensichtlich, dass die Mehrheit so dachte.
Aber das bedeutete nicht, dass es richtig war.
»Wir behalten unseren Kurs bei«, sagte er. »Als wir diese Operation vor fast einem Jahr gestartet haben, habe ich das deutlich gemacht. Wir haben einen Plan, und wir halten uns daran.«
»Ohne Rücksicht auf die Konsequenzen?«, fragte einer der anderen Beamten. »Ja, wir haben einen Plan. Aber wir müssen bereit sein zu reagieren. Dinge ändern sich. Es ist verrückt, an einem Plan festzuhalten, nur weil wir ihn haben.«
Gamache hob die Augenbrauen, sagte jedoch nichts.
»Tut mir leid, patron«, sagte der Beamte. »Ich habe nicht verrückt gemeint.«
»Ich weiß, was Sie gemeint haben«, sagte Gamache. »Wir haben den Plan entwickelt, bevor wir alle Informationen hatten.« Der Beamte nickte. »Er wurde in einer kalten, nüchternen, logischen Umgebung entwickelt.« Weiteres Nicken.
»Warum setzen wir Leben aufs Spiel, um diese Informationen zu bekommen?« Ein anderer Beamter deutete auf die Karte. »Wenn wir nicht danach handeln?«
»Wir handeln ja«, sagte Gamache. »Nur nicht so, wie es die Kartelle erwarten. Glauben Sie mir, ich will die Lieferung aufhalten. Aber bei dieser Operation geht es um das langfristige Ziel. Wir halten daran fest. D’accord?«
Er sah sie der Reihe nach an, einen nach dem anderen. Handverlesen. Nicht weil sie sich seinem Willen beugen würden, mit ihm konform gehen, sondern weil sie klug und erfahren waren, geschickt und erfinderisch. Und mutig genug, um zu sagen, was sie dachten.
Und das taten sie. Aber jetzt war es an ihm.
Gamache dachte nach, bevor er erneut das Wort ergriff. »Wenn wir eine Razzia durchführen und geschossen wird, und alles im Chaos zu versinken droht, was machen wir dann?«
Er sah sie an, jeder von ihnen war schon einmal in einer solchen Situation gewesen. Auch Gamache.
»Wir behalten einen kühlen Kopf, und wir behalten die Nerven. Und wir behalten die Kontrolle. Wir konzentrieren uns. Wir lassen uns nicht ablenken.«
»Ablenken?«, sagte Toussaint. »Das klingt ja gerade so, als ginge es um eine lästige Fliege.«
»Ich will weder diese Lieferung herunterspielen noch die Bedeutung der Entscheidung oder die Konsequenzen, Superintendent.«
Er warf einen kurzen Blick auf die Tafel an der Wand. Auf das dunkle Gesicht.
»Verlieren Sie nie das Ziel aus den Augen«, sagte er und wandte sich wieder seinen Mitarbeitern zu. »Niemals.« Er hielt kurz inne, damit es sacken konnte. »Niemals.«
Sie traten von einem Fuß auf den anderen, begannen jedoch, die Schultern zu straffen.
»Jeder andere Beamte in Ihrer Position hat die Strategie aufgegeben«, fuhr Gamache fort. »Sie haben sich weggeduckt. Nicht weil sie schwach waren, sondern weil die Folgen so gravierend waren. Es musste dringend gehandelt werden.« Er tippte mit dem Finger auf die neue Linie. »Und muss es immer noch. Dringend. Achtzig Kilo Fentanyl. Wir müssen es aufhalten.«
Sie nickten.
»Aber wir können es nicht.«
Er holte tief Luft und konzentrierte sich kurz auf die Lichter der Stadt hinter dem Fenster. Und in der Ferne die Berge. Und das Tal. Und das Dorf.
Und das Ziel.
Dann kehrten sein Blick und seine Gedanken in den Besprechungsraum zurück.
»Wir sehen zu«, sagte Chief Superintendent Gamache, jetzt in entschlossenem Ton. »Aus der Entfernung. Wir greifen nicht ein. Wir halten die Lieferung nicht auf. D’accord?«
Es gab nur ein kurzes Zögern, bevor der Erste und schließlich alle antworteten: »D’accord.«
Einverstanden. Sie taten es widerstrebend, aber sie taten es.
Gamache drehte sich zu Superintendent Toussaint, die geschwiegen hatte. Sie blickte auf die Karte. Dann zu der Tafel an der Wand. Dann sah sie wieder ihren Vorgesetzten an.
»D’accord, patron.«
Gamache nickte knapp, bevor er sich Beauvoir zuwandte. »Auf ein Wort?«
In seinem Büro angelangt, die Tür fest hinter ihnen geschlossen, blieb er vor Beauvoir stehen.
»Sir?«, sagte der jüngere Mann.
»Du bist der gleichen Meinung wie Superintendent Toussaint, nicht wahr.«
Es war keine Frage.
»Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Lieferung aufzuhalten, ohne dass sie mitkriegen, dass wir ihnen auf die Schliche gekommen sind.«
»Vielleicht«, räumte Gamache ein.
»Wir haben kleinere Lieferungen abgefangen«, sagte Beauvoir. Er nutzte die vermeintliche Gelegenheit, ein leichtes Wanken in der Haltung seines Vorgesetzten.
»Das ist richtig. Aber die wurden auf den üblichen Routen befördert, passierten die Grenze an einer vorhersehbaren Stelle. Wenn wir überhaupt nichts mehr abfangen, würden die Kartelle merken, dass etwas im Busch ist. Diese Lieferung ist riesig, und sie werden sie mit ziemlicher Sicherheit direkt an den Ort schaffen, von dem wir ihrer Meinung nach nichts wissen. Wenn sie sich bei einer solchen Menge Fentanyl auf diese Route verlassen, dann weil sie sich sicher fühlen, Jean-Guy. Aber es funktioniert nur, wenn wir sie in dem Glauben lassen.«
»Sollen das etwa gute Neuigkeiten sein?«
»Es ist das, worauf wir gehofft haben. Das weißt du. Hör zu, mir ist klar, dass es für dich besonders schwierig ist …«
»Warum läuft es eigentlich immer darauf hinaus?«, fragte Beauvoir.
»Weil wir unsere persönlichen Erfahrungen und unsere beruflichen Entscheidungen nicht voneinander trennen können«, erwiderte Gamache. »Wenn wir das glauben, machen wir uns etwas vor. Wir müssen es uns eingestehen, unsere Motive überprüfen und dann eine rationale Entscheidung treffen.«
»Hältst du mich für irrational? Du bist doch derjenige, der mir dauernd vorwirft, ich würde nicht meinem Instinkt vertrauen. Willst du wissen, was er mir jetzt gerade sagt? Und nicht nur mein Instinkt, sondern auch meine Erfahrung?«
Inzwischen war Beauvoir nahe dran, Gamache anzubrüllen.
»Das ist ein gewaltiger Fehler«, sagte Beauvoir und senkte seine Stimme zu einem Knurren. »Wenn wir zulassen, dass eine solche Menge Fentanyl in die USA gelangt, könnte das die Zukunft einer ganzen Generation verändern. Du willst meine persönliche Meinung hören? Bitte sehr. Du warst niemals süchtig. Du hast keine Ahnung, wie das ist. Opioide? Designerdrogen? Die ergreifen Besitz von dir. Verändern dich. Verwandeln dich in etwas Grauenhaftes. Alle reden ständig von ›achtzig Kilo‹.« Er deutete zur Tür und zum Besprechungsraum auf der anderen Seite des Flurs. »Was da auf dem Weg zur Grenze ist, ist kein Gewicht, keine Zahl. Es gibt keine Maßeinheit für das Elend, das auf uns zukommt. Ein langsames Krepieren. Und das gilt nicht nur für die Süchtigen, die du erzeugen wirst. Was ist mit all den anderen Leben, die zerstört werden? Wie viele Menschen, die heute am Leben sind, die heute gesund sind, werden sterben oder töten? Wegen deiner ›rationalen‹ Entscheidung?«
»Du hast recht«, sagte Gamache. »Du hast völlig recht.«
Er deutete auf die Sitzgruppe in seinem Büro. Nach kurzem Zögern, als würde er überlegen, ob das eine Falle war, ging Jean-Guy zu seinem gewohnten Sessel und setzte sich auf die Kante.
Gamache lehnte sich zurück und suchte eine bequeme Haltung. Schließlich gab er es auf und beugte sich ebenfalls vor.
»Es gibt da eine Theorie, der zufolge Winston Churchill wusste, dass die Deutschen die englische Stadt Coventry bombardieren würden, bevor es tatsächlich geschah«, sagte er. »Und er tat nichts, um es zu verhindern. Bei dem Bombenangriff starben Hunderte von Männern, Frauen und Kindern.«
Beauvoirs verkniffenes Gesicht entspannte sich etwas. Aber er sagte nichts.
»Die Briten hatten den Geheimcode der Deutschen geknackt«, erklärte Gamache. »Wenn sie gehandelt hätten, hätten sie ihnen das verraten. Coventry wäre verschont geblieben. Hunderte von Leben wären gerettet worden. Aber die Deutschen hätten den Code geändert, und die Alliierten hätten einen gewaltigen Vorteil verspielt.«
»Wie viele wurden infolge dieser Entscheidung gerettet?«, fragte Beauvoir.
Es war eine grauenvolle Rechnung.
Gamache öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Und blickte auf seine Hände.
»Ich weiß es nicht.«
Dann hob er den Kopf und erwiderte Beauvoirs ruhigen Blick. »Womöglich haben die Engländer ihr Wissen nie genutzt, aus Angst, ihren Vorteil aufzugeben.«
»Du machst Witze, oder?«
Aber es war klar, dass er das nicht tat.
»Wozu ist denn ein Vorteil gut, wenn man ihn nicht nutzt?«, fragte Beauvoir. Mehr verwundert als zornig. »Und wenn sie zugelassen haben, dass diese Stadt …«
»Coventry.«
»… bombardiert wird, was haben sie dann noch alles zugelassen?«
Gamache schüttelte den Kopf. »Das ist eine gute Frage. Wann setzt man sein ganzes Vermögen ein? Wann geht man strategisch vor, und wann ist man knauserig und hortet es? Je länger man es behält, desto schwieriger wird es, etwas davon herzugeben. Wenn du nur einen Versuch hast, Jean-Guy, wann wagst du ihn? Und woher weißt du, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist?«
»Vielleicht ist es auch zu spät, wenn du es endlich wagst. Du hast zu lange gewartet«, sagte Beauvoir. »Der entstandene Schaden übersteigt bei weitem alles, was an Gutem hätte erreicht werden können.«
Beauvoirs Zorn war nach und nach verraucht, während er Chief Superintendent Gamache ansah, der mit dieser Frage kämpfte.
»Wenn dieses Fentanyl auf die Straße gelangt, werden Menschen sterben, Jean-Guy. Junge Menschen. Ältere Menschen. Vielleicht Kinder. Es wird wie eine Feuersbrunst sein.«
Gamache dachte daran, wie er mit Reine-Marie Coventry besucht hatte, viele Jahre nach dem Bombenangriff. Man hatte die Stadt wieder aufgebaut, aber die Ruine der Kathedrale hatte man stehen lassen. Sie war zu einem Symbol geworden.
Reine-Marie und er hatten lange vor dem Altar der zerstörten Kathedrale gestanden.
Nur wenige Tage nach der Bombardierung hatte jemand zwei Worte in eine der Wände geritzt.
Vater vergib.
Aber wem vergeben? Der Luftwaffe? Göring, der die Bomber losgeschickt hatte, oder Churchill, der beschlossen hatte, tatenlos zuzusehen?
War es Courage oder eine furchtbare Fehleinschätzung seitens der britischen Führung, die Hunderte von Meilen entfernt in ihren Häusern und Büros und Bunkern in Sicherheit war?
So wie er in Sicherheit war, hoch über den Straßen von Montréal. Weit weg von der Feuersbrunst, die er im Begriff war zu entfesseln. Der heilige Michael fiel ihm ein. Die Kathedrale von Coventry war dem Erzengel geweiht worden. Dem freundlichen Engel, der sich der Seelen der Sterbenden annahm.
Er blickte auf seinen Zeigefinger und war überrascht, eine hellblaue Linie zu sehen. Als würden die achtzig Kilo Fentanyl auf ihrem Weg nach Süden mitten durch ihn transportiert.
Armand Gamache stand praktisch direkt über der Route von den Magdalenen-Inseln zur amerikanischen Grenze. Eine Linie, die durch ein unbedeutendes kleines Dorf in einem Tal verlief.
In diesem Augenblick hatte er die Chance, die Macht, es aufzuhalten.
Gamache wusste, dass ihn die Entscheidung, die er heute Abend traf, für den Rest seines Lebens zeichnen würde.
»Gibt es denn gar nichts, was du tun kannst?«, fragte Jean-Guy mit leiser Stimme.
Gamache schwieg.
»Ein Wort unter vier Augen mit jemandem von der Drogenbehörde? Um sie zu warnen?«, schlug Jean-Guy vor.
Aber er wusste, dass das nicht geschehen würde.
Gamache hatte die Kiefer zusammengepresst, er schluckte, erwiderte jedoch nichts. Seine dunkelbraunen Augen ruhten auf seinem Stellvertreter. Seinem Schwiegersohn.
»Was meinst du, wie lange es dauert, bis das Fentanyl die Grenze erreicht?«, fragte Gamache.
»Wenn es sofort weitertransportiert wurde? Dann müsste es die Grenze morgen in der Nacht passieren. Vielleicht früher. Es könnte schon dorthin unterwegs sein.«
Gamache nickte.
»Aber wahrscheinlich ist noch genug Zeit, um es abzufangen«, sagte Beauvoir, und er wusste, dass er eigentlich sagen wollte, Gamache habe noch Zeit, es sich anders zu überlegen.
Allerdings wusste er, dass auch das nicht geschehen würde. Und tief in seinem Inneren wusste Jean-Guy Beauvoir, dass es nicht geschehen sollte.
Das Fentanyl musste die Grenze passieren. Ihr Geheimnis musste bewahrt werden.
Um später genutzt zu werden. Für den endgültigen Schlag.
Armand Gamache nickte, dann stand er auf und ging zur Tür. Und er fragte sich, ob sich eine dunkle Gestalt aus dem Schatten lösen und ihm folgen würde, wenn er an diesem Abend sein Büro verließ, um zu der kleinen Wohnung zu fahren, die Reine-Marie und er in Montréal behalten hatten.
Um eine Schuld einzutreiben, von der Chief Superintendent Gamache wusste, dass er sie niemals begleichen konnte.
Alles, worauf er hoffen konnte, war Vergebung.