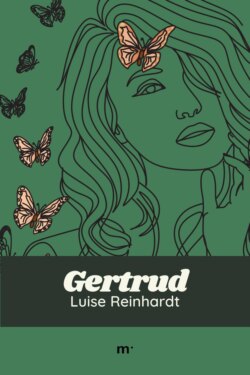Читать книгу Gertrud - Luise Reinhardt - Страница 3
Erster Teil. Erstes Kapitel.
ОглавлениеD er Landstrich im mittleren Deutschland, welcher sich vom Elbstrome bei Dresden, westlich hinüber nach Kurhessen zieht, ist stets vorzugsweise von den bedeutendsten adeligen Familien bewohnt gewesen. Nirgends fand man so viele Barone, Grafen und Herzöge, wie dort, und auch das geistigere Leben schien sich in diese Landesdistrikte geflüchtet zu haben, als Deutschlands Genius sich zu regen begann.
Ohne auf einen wild romantischen Charakter Anspruch zu machen, ziehen sich die Ebenen voll fruchtbarer Üppigkeit, durchschnitten von einer Menge kleiner Flüsse und oftmals von Höhen unterbrochen, die teils mit uralten Waldungen gekrönt, teils mit Wein bebaut sind, von dem Elbestrand bis zu den Ufern der Werra und Fulda hin, und die Saale mit ihren anmutigen Ufern durchschneidet in fast lächerlichen Krümmungen das Land, bis sie sich einige Meilen vor Magdeburg in die Elbe ergießt.
In den anmutigen Tälern sowohl, als auf den waldumkränzten Hügeln lagen zerstreut die Wohnungen reicher und armer Edelleute, die in frühern Jahrhunderten bei weitem weniger als jetzt geneigt waren, die patriarchalische Würde gegen ein Hofamt oder gar gegen Militär- und Zivilkarrieren zu vertauschen. Sie thronten, bevorzugt und mit Privilegien aller Art ausgerüstet, als Herren auf ihren Edelsitzen und glaubten sich Könige. Was manchem an Reichtum abging, das hatte er dafür an Ahnen aufzuweisen, und die Zahl derselben, in unentweihter Reihenfolge, war wohl im Stande einen leeren Beutel und ein zerfallendes Schlossgebäude mit dem Glanze irdischer Hoheit zu verklären. Aber auch reiche Edelleute von untadelhaftem Stammbaume gab es in den Gauen des kleinen Landstrichs, den wir bezeichnet haben, und unter diesen zeichnete sich das Geschlecht Bünau von RittbergenNote 1) als ein von Gott reich gesegnetes und auch reich begabtes aus. Von allen Standesgenossen geachtet und von allen Untergebenen geliebt, lebte der Stammherr Reinhard Bünau von Rittbergen seit Jahresfrist mit seiner jungen, wunderschönen Schwester Margareth auf dem väterlichen Schlosse, das von alter Bauart, umgeben von den Trümmern einer stolzen und mächtigen Vergangenheit, dennoch nicht ohne Ansprüche auf Pracht war. Der Charakter der Landschaft, die Üppigkeit des Waldgrünes und der Wiesen, von einem kleinen, rasch rieselnden Gewässer verschönt, milderten das Raue und Altritterliche des Rittberg’schen Ahnensitzes, und die Überbleibsel einstiger Barbarei waren von der Hand der Zeit sowohl, als von der Mildherzigkeit der Mutter Natur so hinlänglich und entsprechend vorbereitet gewesen, dass es dem jungen Schlossherrn nur wenig Mühe und Geld gekostet hatte, um der ›Burg seiner Väter‹ zu einem bewunderungswürdigen Aussehen zu verhelfen. Das antike, mit Seitentürmen versehene Schloss lag gleichsam auf einem Vorsprunge des Gebirgszuges, der sich dicht hinter demselben, aber abgetrennt, in kühnen und hohen Bergrücken, schön bewaldet am westlichen Horizonte entlang zog, während der Osten eine freie Ebene mit Baumgruppen, Wiesengrün und Kornfeldern darbot. Der Lärm der Arbeit und das rüstige Leben der Tätigkeit entwickelte sich in ergötzlicher Nähe vor den spiegelhellen Fenstern der Schlossbewohner, ohne doch die würdige Ruhe in demselben Maße zu beeinträchtigen, und es konnte gewiss kein friedvolleres Glück geben, als abends von den hohen Bogenfenstern hinab auf die lichtgrünen Wiesen zu schauen, wenn die Herden mit ihren weithin schallenden Glocken am Ufer des silberhellen Flusses hinzogen. Die etwas sentimentale Schwärmerei für solche Naturschönheiten hinderte zur Zeit, als Margareth von Rittbergen mit ihrem stolzen und zugleich liebevollen Bruder im väterlichen Schlosse hausete, die junge Dame nicht, sich ihr mit ganzer Seele hinzugeben und das tägliche Schauspiel als das reizendste zu preisen, was ihr geboten werden könne. Nach solchen Beteuerungen zu schließen, gehörte Fräulein Margareth schon damals dem Kreise jener überschwänglichen Frauen an, wie sie um einige Jahrzehente später das ganze liebe Deutschland dergestalt überfluteten, dass man nach einer vernünftigen Frauenseele und nach einem nüchternen Frauenverstande vergeblich suchte. Es war dies der erste Anlauf einer weiblichen Geisteskultur, die sich in entsetzlicher Übertreibung als schäfermäßige Süßlichkeit und hochtrabendes Phrasentum Bahn zu brechen strebte. Man konnte es vielleicht dem Umstande zuschreiben, dass den deutschen Frauen seit lange wieder von der Literatur gehuldigt ward. Es war dies das erste Stadium der weiblichen Bildung, wo man sich in süßer Schwermut den Dichtern des Vaterlandes zuneigte und sich in ihrer Wertschätzung bis zu einer rührenden Anbetung verstieg. Dem gefunden Kerne der Vernunft konnte die krankhafte Überspannung solcher weiblichen Seelen nicht lange widerstehen, aber dem weichen, nach Übersinnlichkeit schmachtenden Herzen war der ganz falsch beurteilte Bildungsgrad der damaligen Zeit oftmals ein Gift, das seinen eigenen Untergang herbeiführte.
Die duftige, herzerweiternde Frische eines Herbstmorgens lag auf der Flur, welche sich vor dem Schlosse Rittbergen ausbreitete, als eine Equipage mit der bezeichnenden Bedächtigkeit des achtzehnten Jahrhunderts durch die abgemäheten Kornfelder fuhr und bald darauf seine Insassen vor der gotisch gewölbten Haustür ab lieferte. Ein fröhliches Willkommen tönte ihnen entgegen, und man sah alsbald den jungen Schlossherrn mit ganz besonderm Eifer eine junge hübsche Dame vom Wagentritte hinabheben und voll ehrerbietiger Zärtlichkeit von dem Gesindepersonale begrüßen.
Nach dieser Dame, die Elvire von Uslar hieß und seit wenigen Wochen Herrn Reinhard Bünaus Braut war, entstieg ein kriegerisch aussehender Herr mit einem schmalen schwarzen Pflaster über der linken Wange bis zum Kopfe hinauf, der Karosse, und wendete sich sogleich hilfreich, um seiner lebhaft sprechenden und laut lachenden Frau und einem noch sehr jungen Fräulein, Gertrud von Spärkan, gleichfalls ritterliche Dienste zu weihen.
Während Rittbergen seine Braut unter leisen zärtlichen Worten in die Vorhalle geleitete und sich in dem glücklichen Lächeln des Mädchens sonnte, begrüßte Fräulein Margareth unter Erröten die Vorläufer der großen Festlichkeit, die in wenigen Tagen auf Schloss Rittbergen stattfinden sollte, und empfing mit Herzklopfen die Glückwünsche zu ihrer bevorstehenden Vermählung von den Ankommenden. Ja, es sollte Hochzeit auf Schloss Rittbergen sein – Margareth wollte das Vaterhaus und ihren Bruder verlassen, um nach einer sehr kurzen, stürmischen Werbung die Gattin des Grafen Levin von Brettow auf Brettowroda zu werden.
Man erwartete viele Gäste zu dieser Hochzeitsfeier. Man erwartete sie von nah und fern. Der militärisch aussehende Herr mit dem schwarzen Pflaster kam weit her. Es war der Oberst von Pröhl aus dem Sachsenlande, der im letzten Kriege sein Herz an eine allerliebste Preußin verloren und ihre Hand endlich nach verschiedenen Kapitulationen unter der Bedingung erworben hatte: als Ehegatte seiner lustigen Elisabeth nur französisch zu fluchen!
Im Anfange hatte sich die anmutige Frau von Pröhl wirklich das Ansehen gegeben, als wolle sie ernstlich dem ›Donnerwettern‹ ihres ehrenwerten Gemahls ein Ziel setzen, allein mit der Zeit war ihre Opposition gegen die kriegerische Koketterie des guten Obersten, der da glaubte, im Fluche stecke die Grundidee einer richtigen Courage, eingeschlafen und wurde jetzt nur noch als Neckerei von ihr benutzt. Zu ihrer Freude hatte der leidige Streit zwischen Preußen, Sachsen und Österreich gleich nach ihrer Vermählung mit einem Frieden ihres Vaterlandes aufgehört. – Die Siege ihres Königs, denen sie mit dem angeborenen Patriotismus einer echten Preußin enthusiastischen Beifall zollte, machten endlich diesem Kriege ein Ende, und beruhigten mit dem Friedensabschluss des Jahres 1745 ihr Gemüt so weit, dass sie wohlgemut von Preußen nach dem Sachsenlande übersiedelte. In der Schlacht bei Kesselsdorf hatte der Oberst aber einen so entstellenden Hieb über das Gesicht er halten, dass die junge Frau es nötig fand, ihm ein für alle Mal jeden künftigen Kriegsdienst zu untersagen und anzuordnen, dass er zur Verbergung der abscheulichen roten Narbe einen schmalen, höchst kleidbaren schwarzen Pflasterstreif trug. Alle Demonstrationen des würdigen Kriegsmannes, der sich schön mit einem blutroten Malzeichen der persönlichen Tapferkeit fand, halfen ihm nichts, und wenn sie auch endlich bisweilen zugab, dass er im Hause, also sozusagen im Negligee, unbepflastert erschien, so gehörte doch zum Galaanzuge und den gesellschaftlichenDehors das Pflaster ganz unvermeidlich, und wurde zuletzt dem Obersten so notwendig, wie einem Kahlkopfe die verschönernde Perücke.
Das Pröhl’sche Ehepaar blieb kinderlos. Um diesem Übelstande, aber mehr der entstehenden Langeweile, als dem sehnsüchtigen Bedürfnisse abzuhelfen, warf sich Frau Elisabeth zur Beschützerin und Erzieherin zweier jungen Damen auf, die ihrer Eltern beraubt, durch geschwisterliche Verwandtschaftsbande zu der Familie ihres Mannes gehörten. Elvire von Uslar war die ältere ihrer Pflege befohlenen, seit acht Jahren unter ihrer Obhut und ganz ohne Zweifel der Stolz ihrer noch jugendlichen Pflegemutter. Gertrud von Spärkan befand sich erst seit einigen Jahren bei ihr, und wurde ihr immer zeitweise entzogen, wenn der Vormund des holden Kindes, der großmächtige, stolze und oft misslaunige Feldmarschall von Spärkan in Dresden sich des jungen Mädchens einmal erinnerte und sie ›zu sich befahl‹.
Im Stillen ärgerte sich Frau von Pröhl entsetzlich über die Sultanlaunen des gnädigen Herrn Vormund, und hatte oft nicht übel Lust, durch Vorspiegelung von Krankheit ihre kleine hübsche Gertrud dem steifen Zwange des vormundschaftlichen Befehles zu entziehen, allein hier eröffnete sich ein Feld, wo sie mit all ihren Herrscherkünsten nichts gegen ihren Gemahl auszurichten vermochte.
In einer Anwandlung von Respekt und schuldiger Subordination stemmte sich der Oberst stets gegen solche Machinationen und forderte unbedingten Gehorsam, wenn die Karosse des allgewaltigen Feldmarschalls vom nahen Dresden vorfuhr, um das Fräulein Gertrud von Spärkan in die Arme ihres gnädigen Herrn Vetters und Vormunds zu holen. Die kecke, schelmische und dabei höchst entschlossene Miene der Frau von Pröhl bei solchen Gelegenheiten zeigte, dass sie sich mit Plänen trug, die den besorglichen Anordnungen des Feldmarschalls geradezu entgegen liefen. Er, das wusste sie, wollte die kleine Gertrud, die Erbin großer Reichtümer, vor der zu intimen Verbindung mit der preußisch gebliebenen Frau von Pröhl bewahren, obwohl er dem Aufenthalte derselben bei ihr nichts anhaben konnte, weil das Fräulein näher mit Pröhl, als mit ihm verwandt war, dessen Namen sie zwar trug, allein ohne anders, als durch weithergeholte Abstammung, zu seiner Familie zu zählen. Und Frau von Pröhl? Nun, das lag klar zu Tage, sie hatte gar nichts dagegen, wenn sich eines Tages ein hübscher preußischer Vetter in das hübsche reiche Sachsenkind verliebte und dasselbe trotz aller Feldmarschall-Taktik auf das Schloss seiner Ahnen entführte. Es herrschten also zwischen den Preußen- und Sachsenplänen immer noch die feindseligen Elemente vor, trotzdem der König von Preußen im guten Glauben lebte, ›Frieden geschlossen‹ zu haben. Es waren nur Kriege anderer Art, als sie der tapfere Friedrich zu führen pflegte.
Für den Augenblick war es der Frau von Pröhl gelungen, hinter dem Rücken des Feldmarschalls das Fräulein zu entführen, um sie teilhaft der großen, glänzenden Hochzeitsfeierlichkeiten werden zu lassen, die im Schlosse Rittbergen vorbereitet wurden.
Graf Levin Brettow gehörte zu den hervorragenden Persönlichkeiten seines Vaterlandes, und es ließ sich bei diesem Stande des Bräutigams und der glänzenden Lebensstellung der schönen Braut etwas Grandioses erwarten. Hierin sowohl, als in dem bräutlichen Verhältnisse ihrer Pflegetochter Elvire von Uslar zu Herrn Reinhard Bünau von Rittbergen, lagen die Entschuldigungsgründe seiner Hochzeitsreise, zu der allerdings der Feldmarschall gewiss niemals eine Einwilligung gegeben haben würde, wenn man ihn sonst befragt hätte. Frau von Pröhl kümmerte sich nicht um das Ungewitter, das sie mit ihren sehr geheim gehaltenen Plänen zu dieser Hochzeitsreise angerichtet hatte. Sie war auf Schloss Rittbergen angelangt, hatte lachend und voll mutwilliger Einfälle der schönen Margareth ihre diplomatischen Kunststücke gebeichtet und ihre frommen, sehnlichen Wünsche ausgesprochen, dass sich ebenfalls ein so ›stürmischer Bewerber‹, als der Bräutigam Graf Levin, finden möchte, der ihre kleine Gertrud im Sturm seiner Gefühle ohne weiteres auf preußischen Grund und Boden zu verpflanzen, Lust bezeige. Was nun noch im Schoße der Zukunft lag, das überantworte sie der Vorsehung, die, wie sie in ihrem Glaubensbekenntnisse aussprach, ›stets das vorbereite, was dem Menschen von Gott als ein Schicksal bestimmt sei.‹
Unter diesen freundschaftlichen Mitteilungen, denen Fräulein Margareth mit merklicher Zerstreutheit lauschte, hatte Frau von Pröhl ihre Reisetoilette mit eigenen Händen etwas verbessert und schickte sich nun an, in Margareths Gesellschaft das Zimmer zu verlassen, wo sie während der Zeit ihres Aufenthaltes mit ihrem Gatten wohnen sollte, während den beiden Pflegetöchtern ein Kabinett im nördlichen Turme angewiesen worden war, von wo man weit hinaus ins Land schauen konnte.
Sie hatte, ganz eingenommen von ihrem gelungenen Staatsstreiche, übersehen, welch’ ein reizendes, aber sichtlich verlegenes Lächeln über Margareths Antlitz flog, als sie ›die stürmische Bewerbung‹ des Grafen Levin hervorhob, und es fiel ihr bei ihrem leichten Sinne nicht ein, dass das Fräulein einen Vorwurf der Übereilung aus ihren Worten interpretieren könne. Harmlos, weil eine schnell entstandene stürmische Liebe ganz ihren Beifall hatte, nahm sie die kleine Verwirrung der jungen Dame, die sie späterhin zu bemerken noch Gelegenheit fand, für bräutliche Scham, welche unter den vorliegenden Verhältnissen noch natürlicher und verzeihlicher als sonst wohl war. Margareth kannte ihren Verlobten kaum zehn Wochen, war seit acht Wochen seine Braut und sollte in einigen Tagen seine Frau werden. Allerdings musste jeder zugeben, dass man kaum schneller die nötigen Schritte und Stadien vor einer lebenslänglichen Vereinigung, wie die Ehe, absolvieren konnte, und es musste jeder glauben, dass nur mächtige und leidenschaftliche Gefühle von beiden Seiten das Brautpaar zu der Abkürzung aller üblichen Formalitäten veranlasst hatten. Frau von Pröhl war auch einige Minuten lang sehr verwundert gewesen, dass die zarte blonde Margareth, mit dem sanften süßen Gesichtchen, das so durchsichtig weiß wie Alabaster war, so stark leidenschaftlich für ihren Levin entbrannt erschien, um alle Prüderie des jungfräulichen Sinnes zu überwältigen; allein die Herzensfreude über die damit eingestandene Wahrhaftigkeit ihrer Liebe half sogleich der momentanen Verwunderung ohne weiteres ab und brachte sie auf immer zur Ruhe. Liebe musste der Beweggrund dieser Eile ein – Liebe von Seiten des Verlobten, der in der ersten stürmischen Herzenswallung darnach dürstete, sein errungenes Kleinod sicher in Besitz zu nehmen, Liebe aber auch von Seiten der Braut, die mit vollkommener Willensfreiheit diesen lebhaften Forderungen des Bräutigams Folge geleistet hatte. Und wo die Liebe siegend ihr Panier schwang, da war nach Frau von Pröhls Glaubensbekenntnis: ›nichts zu fürchten!‹
Vertraulich, Arm in Arm, verließ die Dame, in ihren weiten Lebensregeln sicher, mit Margareth das Gastzimmer, um sich zum Frühstück zu begeben, das ihrer wartete. Sie traten unmittelbar von dem Zimmer in die Halle, welche im Mittelpunkte des untern Geschosses lag, und stiegen langsam die mit pomphafter Bequemlichkeit angelegte breite Treppe hinauf, welche sich ganz dicht an diesen nördlichen Flügel des Schlosses anlehnte, während vom südlichen Flügel eine gleiche Treppenflucht aufwärts lief, um sich mit jener unweit der zweiten Etage in einem Balüstre zu vereinen. Schon auf dem Wege vernahmen beide Damen ein lebhaftes Gespräch, mit Beifall und jugendlichem Frohsinn geführt, und Frau von Pröhl wandte ihren Blick fragend auf die Schlossdame, da die hervortönende Männerstimme weder ihrem Gemahle noch dem Hausherrn angehörte.
»Ist das Graf Levin?« fragte sie endlich, als sie das Balüstre erreicht hatten und von dort in den Korridor zu treten Anstalt machten. -
Margareth schüttelte den Kopf.
»Es ist Levins Vetter, Junker Wolf! Er ist unser Hausgenosse seit längerer Zeit und wird auch das Schloss so bald nicht verlassen.«
»Junker Wolf?« fragte Frau von Pröhl, indem sie das Wort ›Junker‹ stark betonte.
»Levins Großvater wurde in den Grafenstand erhoben, als er sich mit einer fürstlichen Dame vermählte. Die andern Linien der Brettows sind Freiherren,« erklärte Margareth.
In diesem Augenblicke öffnete sich die Tür des Salons, wo das Frühstück eingenommen werden sollte, und Fräulein Gertrud flog, wie ein Schmetterling, der gehascht zu werden fürchtet, heraus, gerade der Treppe zu. Ein Kavalier von auffallend schönem Äußern folgte ihr, einen Myrtenzweig in der Rechten, den er augenscheinlich zu leichtsinnigen Zwecken hoch emporhielt.
»Nur eine Minute – nur eine Sekunde, Fräulein Gertrud!« rief er dabei schmeichelnd.
»Nein, nicht eine halbe Sekunde,« entschied das junge Mädchen fliehend.
»Ich möchte nur sehen, wie Ihnen ein Myrtenkranz kleiden würde, gnädiges Fräulein,« bat er weiter, und wurde nun erst der Damen ansichtig, die voller Erstaunen die kleine Szene belauschten.
Sogleich besonnen, wenn auch noch das verklärende Lachen jugendlichen Übermutes in den schönen Gesichtszügen, trat der Junker auf Frau von Pröhl zu und drückte sein Bedauern aus, dass er nur einige Minuten zu spät von der Jagd zurückgekommen sei, um die Herrschaften empfangen zu können, und stellte sich selbst als den Premierminister des Herrn Reinhard Bünau von Rittbergen auf Rittbergen vor. Eine anmutige Gebärde der Frau von Pröhl zeigte ihre Geneigtheit, auf den scherzhaften Ton dieser Präsentation einzugehen, und sie nahm seinen Arm an, den er ihr voll ritterlicher Galanterie darreichte, um sie in den Salon zu führen. Gertrud und Margareth folgten. Die Erstere erzählte die Veranlassung ihrer Flucht vor dem Junker. Sie hatten zusammen vor den kolossalen Myrtenbäumen, welche eine Zierde des großen Familiensaales abgaben und mit der Vergangenheit des Rittberg’schen Stammes verknüpft waren, gestanden. Scherze, wie die leicht vertrauliche Jugend gern zu machen pflegt, flogen von den Lippen der jungen Damen, und plötzlich bog Herr von Rittbergen einen Zweig des Baumes mit vielsagendem Lächeln zu der Stirn seiner errötenden Braut nieder, um zu sehen, wie ihr das dunkle Grün zu Gesichte fände. Junker Wolf fühlte ein unbezwingliches Verlangen zu einer gleichen Probe. Da aber Gertrud nicht so nahe zum Baume fand, so brach er mit räuberischer Hand einen Zweig und verfolgte das fliehende Mädchen. Das war die große Geschichte des ersten Krieges zwischen diesen beiden Leutchen, die in allen andern Punkten sehr gut zu einander passten, nur in Hinsicht der Geldverhältnisse nicht. Junker Wolf von Brettow war der dritte Sohn seines Vaters, welcher nur ein Gut zu vererben hatte und zwar ein Lehngut. Allodialvermögen besaß dieser Zweig der Familie gar nicht.
Der älteste Junker präparierte sich also zum Schlossherrn, der zweite Junker studierte und ging als Attaché in die weite Welt, um sich einsort zu machen, und der dritte Junker lebte bald hier, bald da, wo er sich mit seinen Kräften nützlich machen konnte. Am liebsten wäre er Offizier geworden. Aber da das ganze heilige deutsche Reich jetzt in einem ewigen Frieden versunken zu sein schien, so sagte es ihm nicht zu, sich in die Reihen derer zu stellen, die beim leidigen Kamaschendienst Zeit genug behielten, sich von der fürchterlichsten Langeweile geplagt zu fühlen.
Er lebte seit einigen Jahren auf Rittbergen, hatte während der kürzlich erst beendigten Reisen des jungen Schlossherrn das ganze Hauswesen administriert, und konnte sich also mit Fug und Recht als den Premierminister des Herrn Reinhard Bünau präsentieren. Durch und durch ehrlich und brav, ziemlich unterrichtet, gescheit und praktisch, sozusagen das Ideal eines tüchtigen und ehrenwerten Landjunkers, dabei heiter, für Schönheit, und Anmut empfänglich, allein ohne besondere Anlage zum sogenannten ›Verlieben‹, und schließlich viel zu ehrlich, um sich aus Eigennutz zu poussieren – das waren ungefähr die Grundelemente seines Wesens. Im Hinter halte schlummerten freilich noch die Stammeigentümlichkeiten: ›Ungeduld und aufbrausende Hitze‹; da jedoch seine ganze Erziehung darauf hingewiesen hatte, sich unter der Herrschaft bevorzugter Edelleute zu beugen, so war Junker Wolf zu einer weit größeren Selbstbeherrschung gelangt, als irgendein Brettow vor ihm. Er hatte, vielfach schon, Proben seiner ungestörten Seelenruhe abgelegt, und er war zu dem Selbstvertrauen gekommen, selbst ›die Kämpfe mit einem rebellischen Herzen als Narrenspossen zu betrachten und die Macht der Liebe zu bezweifeln, wenn der Mann nur richtig mit sich fertig werden wollte.‹
Freilich hatte er die Erfahrung für sich. Er war der schönste Mann seiner Zeit, und die Jungfrauen seines Standes nicht allein, sondern die reizendsten Mädchen in allen Schichten der Bevölkerung waren bereit sich von ihm lieben zu lassen. Da der schöne Junker Wolf nun eben kein Weiberfeind war und den warmen Blicken ein waches Herz entgegentrug, so kam er oft in Gefahr, einem reichen Vater oder einer hochmütigen Mutter Todesangst einzuflößen. Man fürchtete eine Liaison, die den allgemein geachteten und beliebten jungen Edelmann zu einer gerechten Anfrage verhelfen konnte, und wenn man damals, noch weniger als jetzt, auch nicht geneigt war, sich der tränenreichen Liebe eines Töchterchen zu fügen, so scheute man doch die Konflikte mit dem angesehenen Stamme Brettow, der es bis zum Grafentume gebracht hatte. Junker Wolf zog sich aber aus allen diesen Affären stets ehrenhaft und mit unverletztem Herzen zurück, weil er, wie er sagte, ›recht gut wisse, dass er den Eltern schöner, liebenswürdiger Mädchen ein geeigneter Kavalier sei, aber keineswegs ein geeigneter Schwiegersohn.‹
Durch Junker Wolf war ein Vetter, der Graf Levin Brettow, auf Rittbergen eingeführt. Er hatte im Sturme das stille, sanfte Herz der schönen Margareth genommen, ohne ihr eigentlich Zeit zur Prüfung zu gestatten. Graf Levin war keineswegs so schön, wie sein Vetter, und ihm mangelte vor allen Dingen die heitere Selbstverleugnung, die dem armen Junker zum Schmuck gereichte. Wild, ungestüm, verwegen bis zur Tollkühnheit, ein Feind aller Verfeinerung, aller Schwärmerei und aller Geisteserhabenheit, aber dabei ein edler, hochsinniger Mann im wahren Sinn des Wortes, dem die Koketterien des Weibes ein Gräuel waren, der Wahrheit und Recht liebte und die Lüge verabscheute – so war der Graf Levin beschaffen. Ob er in dieser Eigentümlichkeit fähig war, das sensible Gemüt und das zartfühlende Herz Margareths zu beglücken, blieb fraglich. Margareths Ausbildung war von einer Tante besorgt, die nicht hinter dem Zeitfortschritt zurückzubleiben Lust hatte; sie gehörte also zu den schwärmerischen Seelen, die in der Verzückung über erhabene Gemütsregungen vergessen, dass Steine auf dem Lebenswege liegen, worüber man fallen kann, wenn man zu viel himmelwärts schaut. Margareth war von der Poesie der Liebe für den Augenblick berauscht, sie verwechselte vielleicht die Herzensglut des Grafen Levin mit Geistesflammen, weil die Beredsamkeit wie ein frischer, belebter Quell aus seinem jähe erweichten Innern hervorbrach und seine Worte färbte. Sie erkannte vielleicht zu spät ihren Irrtum, um den Missgriff wieder gutzumachen, der sie nahe an den Rand des Verderbens bringen konnte. Ihre jungfräulich zarten Begriffe von Erdenglück fanden für jetzt Befriedigung in dem überschwänglichen Reichtume seiner Empfindungen, aber was wurde daraus, wenn eines Tages der Schleier von ihren Augen fiel und sie sich mit all’ ihren Lieblingsträumereien an einem jenseitigen Ufer fand, getrennt durch brandende Lebenswellen von dem, den sie zärtlich zu lieben meinte? Ihr Himmel, den sie azurblau für Ewigkeiten glaubte, hatte Wolken von drohendem Inhalte am Horizonte lagern, und ein einziger Windstoß vermochte sie zu ihrem Entsetzen hinaufzutreiben.
Ihr Bruder Reinhard wäre vielleicht im Stande gewesen die Misslichkeit ihrer eingegangenen Liebesverhältnisse richtig zu beurteilen, da er die genügende Weltkenntnis erlangt hatte, um die heterogenen Charakterbildungen des Brautpaares zu durchschauen, allein sein eigenes Herz war für den Augenblick zu tief beschäftigt, und die Überzeugung von dem Werte des Grafen stillte die auftauchenden Zweifel, die sich seiner bisweilen blitzähnlich bemächtigten. Er hielt überdies eine edle und zärtliche Liebe für mächtig genug, um jede Verschiedenartigkeit der Naturen auszugleichen, und er wusste, wie recht weiblich hingebend seine schöne Schwester zu sein vermochte. Was sich in geistiger Beziehung Abweichendes vorfand, das berücksichtigte er gar nicht. Die Zeitperioden lagen auch zu nahe, wo es dem Edelmanne nur nötig schien, sich äußerlich als Ritter zu zeigen und außerdem dem wilden und ungezügelten Leben eines Jägers obzuliegen, ohne daran zu denken, dass Lesen, Schreiben und Rechnen edle Wissenschaften seien, die einstmals jedes Kind im Volke begreifen könne. Herr von Rittbergen hatte sich befleißigt eine höhere Stufe der Bildung zu erlangen. Er war in den Jahren einer Studien mit Männern zusammengetroffen, die, späterhin zu geistigen, Größen seines deutschen Vaterlandes emporgewachsen, schon in ihrer jugendlichen Strebsamkeit auf ihre Kommilitonen eingewirkt hatten; aber er schlug solche Verstandesbeschäftigungen nicht so hoch an, um davon ein Erdenglück abhängig zu machen. Graf Levin verstand vortrefflich zu rechnen, las und schrieb hinlänglich gut, um seinem Stande gemäß überall auftreten zu können. Dass er zu abstrakt dachte, um sich für Klopstocks ›Messiade‹ begeistert zu fühlen oder des jungen schwärmerischen Wielands ›Platonische Betrachtungen über den Menschen‹ zu studieren, dies gereichte ihm in den Augen Rittbergs nicht zum Schaden, obwohl er für diese Geistesproduktionen schwärmte und mit allen Dichtern und Schriftgelehrten seiner Zeit im engsten Verbande stand. Der gesunde Verstand des Grafen Levin glich den Abstand einer Universitätsausbildung mit seinem untergeordneten Wissen durch anderweit hervorragende Geschicklichkeiten aus, und er bewies durch die Vorliebe, die er für die Gellert’schen Dichtungen zeigte, dass er keineswegs unempfindlich für den Aufschwung der deutschen Literatur war. Nach seiner Meinung musste man aber verstehen, was man las. Die ›Fabeln‹ von Gellert mit ihrer unausbleiblichen Moral verstand er und ergötzte sich daran, weil er den Nutzen der Satire darin erkannte. Weniger sagten ihm die damals in Umlauf gesetzten ›Satyrischen Briefe‹ Rabeners zu, obwohl er sie ebenfalls begriff und vorzugsweise auch mit Andacht durchstudierte. Gellert blieb ein Ideal, und er ruhte nicht, bis er die persönliche Bekanntschaft dieses Lieblingsdichters gemacht hatte.
In diesem kleinen Charakterzuge fand Rittberg eine Art Garantie für die Wärme einer Geistesempfänglichkeit, und glaubte es ruhig der Gemeinschaft mit seiner exzentrisch-poetisch erzogenen Schwester überlassen zu können, die nötigen Berührungspunkte zwischen ihren ungleich kultivierten Seelen herauszufinden. Genug, er machte sich wenig Sorge wegen der Verstandesverfassung des Brautpaares, nachdem er einige schlagende Beweise für die Sympathie ihrer Herzen erhalten hatte.
Die Eile, womit Graf Levin seine Verheiratung betrieb, war ihm im Grunde sehr lieb, weil seine eigene Vermählung auch dadurch beschleunigt wurde. Er hatte in einer romantischen Laune seinem Vater das Versprechen geleistet, nicht eher eine Gattin auf Schloss Rittbergen einzuführen, als bis eine junge schöne Schwester es als glückliche Frau verlassen hätte. Wenn ihn auch kein Schwur an diese Verheißung band, so stand er doch zu sehr unter der Einwirkung einer phantastischen Schwärmerei, die ihn zu einem ritterlichen Beschützer der verwaisten Schwester stempelte, als dass er sich sophistisch seinem Gelübde entziehen sollte. Er hatte Fräulein Elvire von Uslar schon früher kennen gelernt, aber eine direkte Bewerbung um ihre Hand verschoben, bis Margareth Braut geworden war. Die Hochzeit der Schwester sollte jetzt die Veranlassung geben, das Verlöbnis mit ihr zu veröffentlichen und zugleich die Zeit zu verkürzen, die Frau von Pröhl mit der ganzen Gravität einer Pflegemutter zum Brautstande ihres Pflegetöchterchens festgesetzt hatte.
Frau von Pröhl betrat unter bedeutenden Anwandlungen von Neugier das Besitztum der Familie Rittberg, von welchem fabelhafte Beschreibungen im Umlaufe waren. Man pries das Schloss als eines der romantisch gelegensten und luxuriös ausgestatteten, und schon die ersten Wahrnehmungen der scharf und heimlich um sich blickenden Dame bestätigten diese Erzählungen. Wie fürstlich schön waren die Hallen und die Korridore des Schlosses, nachdem man durch antike Mauerwerke und über eine Zugbrücke hinweg in den engen Schlosshof bis vor die ganz altertümliche gotisch gewölbte Haustür gedrungen war. Gleich beim ersten Eintritte überfiel sie eine Empfindung, die an Erstaunen und Ehrfurcht grenzte, als sie die kolossalen Hallen betrachtete, die einst den Vorfahren Rittbergs zum Versammlungsorte gedient hatten, jetzt aber nur noch als eine Verbindung der beiden neuern Flügel benutzt wurden. – Eine Reihe korinthischer Säulen, von denen man nicht sagen konnte, ob sie zur Zierde der Halle selbst dienen sollten, oder ob sie zur Stütze der oberhalb liegenden Räume nötig waren, zogen sich bis zu den Treppen hin, wo sie in einem schönen Halbbogen mit Balustraden versehen, als Treppeneinfassung paradierten.
Frau von Pröhl ließ ihre Blicke mit unverkennbarer Bewunderung nochmals nach dem prächtig verzierten Treppenbalkon, der auf einem Trupp eben solcher Säulen ruhte, zurückschweifen, bevor sie am Arme des Junker Wolf den rechts liegenden Korridor entlang ging, und ihr erstes Wort an Rittberg war ein lebhaftes Lob des imposanten Aufganges zum zweiten Stockwerk.
»Tod und Hölle,« brach der Oberst laut lachend heraus, »mein Lischen betrachtet sich also ganz gemütlich die architektonischen Wunder des Schlosses Rittbergen, während wir hier mit dem Frühstück warten und beinahe verhungert sind. Es ist Zeitgeist, dass unsere Frauen mehr betrachten, als handeln. Lieber Rittberg, gewöhnen Sie Ihre Braut früh genug daran, dass sie mehr an Ihr Frühstück denkt, als an den Turmbau zu Babel. Himmelsapperment–«
Frau Lischen sah ihn schelmisch an und hob drohend den Finger auf –
»Mille tonnerres « verbesserte er sich in komischer Verzweiflung, »ich sitze nun eine volle Stunde vor dem besetzten Frühstückstische und labe mich am Dufte des gekochten Schinkens. Himmelelement – wenn ich nur satt davon würde! «
Die Damen hatten Erbarmen mit dem hungrigen Oberst und verschoben die Bewunderung der prachtvollen Myrtenbäume bis zu einer gelegenern Zeit.
Während er seinem Appetite folgte und dem Geschäfte des Sättigens mit allem Eifer oblag, plauderten die Damen mit Junker Wolf und dem Schlossherrn von den bevorstehenden Festlichkeiten, und Elvire bemerkte schlau lächelnd:
»Sie erwarte etwas ganz Besonderes von Poesie, denn der Professor Gellert habe sie ausführlich über alle Umstände der Verlobung und über den Charakter des Bräutigams befragt.«
»Er hat unsern Vetter Levin vor zwei Jahren kennengelernt,« fiel Junker Wolf ein, »und ihn damals etwas urwüchslich gefunden. Vielleicht liegt hierin das Motiv seiner wissbegierigen Forschungen, mein gnädiges Fräulein, und Sie irren sich in Ihrer Voraussetzung, als habe er die Notizen zu einem Hochzeitscarmen gesammelt. Mein Vetter Levin verehrt den Professor als Menschenkenner und als Dichter, allein ich muss befürchten, die Verehrung ist nicht gegenseitig.«
Margareth hob ihre sanften blauen Augen unwillig zu dem Junker auf:
»Gellert würde einem Ruhme als Menschenkenner keine Ehre machen, wenn er meinen Verlobten nicht als einen Edelstein anerkennen wollte,« sprach sie rasch einfallend.
»Nun, nun, Margareth,« scherzte der Junker, »kommt einmal eine Fabel von einem ungeschliffenen Edelsteine ans Tageslicht, so weiß ich, wer damit gemeint ist.«
Rittberg lächelte zu diesem Einfalle und nickte zustimmend mit dem Kopfe. Eine Feuerglut überströmte das schöne, weiße Gesicht der jungen Braut, als sie dem Beifallsblicke ihres Bruders begegnete, und sie wendete sich in großer Bewegung zu Frau von Pröhl, indem sie eine ganz abweichende Frage an sie richtete.
Diese beobachtete sie scharf.
»Woher die Aufregung?« fragte sie sich heimlich. »Ist Graf Levin ein roher Landjunker? Hat sie Ursache, sich ihrer Wahl zu schämen? Was hat sie, die Überfluss an Bewerbern erwarten musste, dazu vermocht, sich einem Manne zu verloben, der ihr an Bildung nachsteht? Nun, wir werden ihn ja sehen und werden selbst beurteilen können, wie sich die Fäden des Netzes um dies schöne Mädchen geschürzt haben. Gott gebe nur, dass er ihrer würdig ist, denn jetzt ist alles zu spät!«
»Wir erwarten heute auch noch unsere Tante Wallbott von Gotha,« unterbrach Rittberg die schwermütige Gedankenflut, welche Frau von Pröhl zu überschwemmen drohte. -
Der Oberst ließ mit gut gespielter Verzweiflung Messer und Gabel fallen und schrie kläglich:
»Was Teufel! Donnerwetter –diable –wollt’ ich sagen! Heute schon? Bringt sie den Leibaffen des Königs von Preußen, der sich zu ihrem und zu aller Entzücken jetzt in Gotha aufhält, mit?«
»Sie meinen Voltaire?« fragte Junker Wolf.
»Voltaire ist schon abgereist,« berichtete Rittberg unangenehm berührt.
»Schon abgereist?« fragte der Oberst verwundert. »Himmelelement, Lischen, wollte nicht Professor Gellert seinetwegen nach Gotha? «
»Allerdings, « antwortete Frau von Pröhl. »Ich werde ihn sogleich davon zu benachrichtigen suchen, damit er den Weg nicht vergeblich macht. Geht Voltaire nach Berlin zurück?« fügte sie zu Rittberg gewendet hinzu.
»Schwerlich! Der König wünscht es nicht, sagte mir der Präsident von Maupertuis.«
»Er wünscht es nicht!« wiederholte der Oberst im Tone übermäßiger Verwunderung. »Hölle und Teufel, das muss einen verwünscht tüchtigen Haken haben! «
»Was wird es weiter für Gründe haben,« meinte Frau von Pröhl. »Wahrscheinlich haben sich die ›großen Geister‹ gezankt, und da der König nicht fortgehen kann, so schickt er seinen guten Freund fort.«
»Vielleicht ärgert sich der König von Preußen nur über Frankreich, weil es sich von dem schlauen Diplomaten Kaunitz für Österreich interessieren lässt, und der arme Untertan Frankreichs muss für die böse königliche Laune büßen,« warf Junker Wolf ein.
»Mir wäre es ganz gelegen, wenn unser König sich überhaupt dermaßen ärgerte, dass er alle Friedensbeschlüsse über den Haufen würfe. Österreich hält doch keine Ruhe, bis es Schlesien wieder hat; es verlautet, dass Kaunitz seine ganze Macht aufbietet, um Maria Theresia zur Allianz mit Frankreich zu bewegen.«
»Es ist möglich, dass Voltaires Ungnade mit diesen politischen Ereignissen teilweise zusammenhängt,« unterbrach ihn Rittberg, »allein im Grunde ist das Zerwürfnis zwischen dem Könige und Voltaire rein persönlicher Natur. Er soll bei einer Gelegenheit, wo es sehr unpassend war und den König ganz besonders kompromittierte, gesagt haben: ›Man solle es nur mit den Verordnungen des hohen Herrn machen, wie er es mit seinen französischen Aufsätzen zu machen pflege, in welchen er das Gute ungeheuer hervorstreiche und das Schlechte still durchstreiche.‹ Der König erfuhr den Ausfall sogleich wieder, und da ihm mehrfach Dinge vorgekommen waren, die ihm seinen Günstling widerwärtig machten, so sendete er ihm seine Entlassung. Wie gesagt, es ist aber möglich, dass unser König die Veranlassung benutzte, um Voltaire loszuwerden, weil er sich über die französische Wetterwendigkeit ärgerte.«
»Was sagt aber Frau von Wallbott zu der extravaganten Ungnade des Preußenkönigs?« fragte der Oberst. »Mich wundert nur, dass die Dame, deren Mund Frankreichs Sprache redet, als sei sie nicht im lieben Deutschland geboren, zur Hochzeit nach Rittbergen kommen will, statt dass sie ihren angebeteten Philosophen, der durch seine Geisteskraft der ganzen französischen Nation ein Übergewicht über alle andere zivilisierten Völker Europas verliehen hat, nach Frankreich begleiten sollte.«
Frau von Pröhl brach in ein heiteres Lachen aus.
»Das musst Du auswendig gelernt haben, lieber Pröhl!« rief sie und wiederholte den ganzen Satz sehr pathetisch.
»Der Ärger hat es mir eingeprägt, Lischen,« erwiderte der Oberst. »Ich weiß es noch wie heute – Kreuzbataillon, wenn ich daran denke, schwillt mir der Kamm. – Es war Soiree bei Lischens Bruder, und der ganze gelehrte Kram tat sich dabei auf. Herr von Voltaire kam spät und schlich wie eine Meerkatze, buckelnd, wenn er mit einer Durchlaucht oder einer Exzellenz sprach, und naseweis gegen denjenigen, welcher mit ihm gleichen Standes war, im Saale umher. Nachdem er eine Menge Sottisen gesprochen, die nur halb verstanden wurden, entfernte er sich wieder, weil der König nach ihm verlangte. War es doch gerade, als wären wir alle miteinander dumme Jungens gegen diesen Kerl mit seinem französischen großen Geiste. Die Damen, wie immer bei solchem Geistesfirlefanz taten ganz verrückt, und da war es, wo Ihre gnädige Tante von Wallbott den erhabenen Ausspruch tat. «
»Meine Tante mag aber nicht Unrecht haben, lieber Oberst,« entgegnete Rittberg von dem Zeloteneifer des Herrn von Pröhl ergötzt. »Die Zeit wird es lehren, dass Voltaire von bedeutendem Einflusse auf die menschliche Geistesbildung gewesen ist. Er gehört doch unbestritten zu den scharfsinnigsten Männern der ganzen, weiten Welt, und Frankreich wird dereinst stolz darauf ein, die Wiege dieses großen Geistes –«
»Donner und Blitz, Rittberg,« unterbrach der Oberst seine Rede, »mögen die Franzosen den Kerl wiegen bis zur Ewigkeit, ich habe nichts, gar nichts dagegen und bin froh, wenn ich nicht dabei sitzen muss, um alle die Wiegenlieder für ihn mit anzuhören. Dereinst? – Dereinst? – Warten wir es ab, ob es ein ›Dereinst‹ für ihn gibt. Die Franzosen haben kein ›Dereinst‹. Sie müssen sich mitavoir undêtre begnügen.«
Ein helles Gelächter belohnte ihn für diesen guten Einfall, und man erhob sich gutgelaunt von der Frühstückstafel, um sich in einzelne Gruppen zusammenzustellen. Das allgemeine Gespräch hörte dadurch natürlich auf und man wählte zwanglos das Thema nach den verschiedenartigen Gemütszuständen. Frau von Pröhl versuchte jetzt mit einigen feinen Wendungen die Gefühle Margareths zu sondieren, allein ihre Bemühungen zerschlugen an dem geflissentlichen Ausweichen der jungen Dame, so dass sie zuletzt davon abstand, und das Nutzlose solcher Einmischungen einsehend, ihre Wissbegierde beschränkte.
Man trennte sich bald, teils um von der Morgenfahrt auszuruhen, teils um die Sehenswürdigkeiten des Schlosses in Augenschein zu nehmen. Der Oberst wollte ein Schläfchen versuchen, wie er sagte. Ehe er aus dem Kreise schied, wendete er sich mit neckischer Geheimniskrämerei an den Schlossherrn und fragte:
»Ein Wort im Vertrauen, lieber Rittberg! Muss ich denn lispeln,« – er sprach das Wort aus, als fehle ihm wenigstens die ganze Zungenspitze – »wenn Frau Tante von Wallbott hier ist?«
»Nein! Nein!« erklärte Rittberg lächelnd. »Tante Wallbott gehört nicht zur Union der Sprachverbesserer.«
»Doch, lieber Rittberg, doch! Sie ist die schlimmste gelehrte Dame, die ich kenne, und am Hofe zu Gotha soll schon stark ›gelispelt‹ werden, auch in Weimar und in Kassel! «
»Natürlich,« fiel Junker Wolf ein. »An allen kleinen Höfen, wo nicht viel Platz für die Füße ist, recken sie umso mehr den Kopf in die Höhe, dem Himmel und ihrem eigenen Ruhme entgegen.«
»Ich sage es Ihnen, Frau von Wallbott in ihrer Geistesmajestät ist eine gefährliche Dame, lieber Rittberg, gefährlicher, als jede Intrigantin, und ich wette darauf, dass sie jetzt lispelt.«
»Sie scheinen den Begriff des Lispelns mit dem der modernen Bildung zu parallelisieren,« rief Junker Wolf ihm nach, als der Oberst nach diesen Worten eilig den Saal verließ.
»Wir werden doch keinen Skandal vom Obersten zu erwarten haben?« fragte der Schlossherr besorgt.
»Tragen Sie keine Sorge, « beruhigte ihn Frau von Pröhl. »Er wird bei der Anwesenheit Ihrer Tante für nichts Augen haben, als für diese gefährliche, gelehrte und schlimme Dame, denn es gehört, wie die leidige Angewohnheit des Fluchens zu seinen seltsamen Eigentümlichkeiten, eine unbedingte und respektvolle Verehrung für geistig bevorzugte Damen zu haben. Natürlich ist ihm, wie jedem Manne, die Subordination eines geistigen, Wesens fatal, und er sucht sich durch tadelnde Worte zu rächen, allein immer nur hinter den Rücken der gelehrten, Damen. Fürchten Sie keine Betisen von ihm. Er wird der eifrigste Kavalier für Frau von Wallbott sein.«
Frau von Pröhl schickte sich nun an, dem Professor Gellert eine schleunige Benachrichtigung über die erfolgte Abreise des Herrn von Voltaire zukommen zu lassen, um womöglich dem kränklichen Manne die Strapazen einer Reise zu ersparen. Sie liebte den sanften, geistvollen Mann mit der Hingebung einer zärtlichen Schwester, und sie verfehlte bei ihren gelegentlichen Besuchen der Stadt Leipzig niemals ihn aufzusuchen. Ihre harmlose Heiterkeit sagte dem hypochondrischen Dichter sehr zu, und es gelang ihr jedes Mal, seine Stimmung auf einige Zeit zu verbessern. Zweimal hatte sie ihn auch schon überredet, einen kurzen Aufenthalt in ihrer angenehmen Häuslichkeit zu versuchen und sich durch ihre zartsinnigen Bemühungen zerstreuen zu lassen, allein für die Dauer halfen alle Zerstreuungen nichts. Seine Gesundheit war schwach und das Übel, das ihn folterte, trotzte allen ärztlichen Mitteln. Es war wohl selten ein Mann in dem hohen Grade, wie Professor Gellert, der Gegenstand einer all gemeinen Liebe und Verehrung, und er verdankte diese Auszeichnung nicht allein den hohen Eigenschaften eines Geistes, sondern auch dem reinen Wohlwollen einer Gesinnungen und der Liebenswürdigkeit eines bescheidenen Benehmens.
Frau von Pröhl hielt es für angemessen, einen Eilboten mit ihrem Briefe abzusenden, und diesen genau über den Weg zu instruieren, den er zu nehmen hatte, um, im Falle Gellert schon von Leipzig aufgebrochen war, ihn noch unterwegs über die Nutzlosigkeit seiner Reise zu unterrichten. Sie beschrieb dem Boten Gellerts Persönlichkeit mit der Umsicht eines Polizeiagenten, und sie überließ sich ganz unbedingt dem Vertrauen, dass ihre beeilten Maßregeln einen günstigen Erfolg haben würden.
Freilich, in unserem Zeitalter der Geschwindreisen und Dampffahrten möchte ein solches Vertrauen ans Lächerliche grenzen, allein damals drängten sich die Reisenden nicht massenhaft in die Gasthofsräume, nahmen nicht in fliegender Eile ein Mittagsessen an dertable d’hôte ein und befanden sich schon wieder unterwegs, wenn es dem Wirte einfallen wollte, irgendjemanden näher in Augenschein zu nehmen. Damals reiste man gemütlich von einem Gasthofe zum andern, wie es die Kutscher und die Pferde gewohnt waren, und es war Tausend gegen Eins zu wetten, dass sich der Professor Gellert, wenn er um zehn Uhr morgens von Leipzig weggefahren war, sich punkt zwölf Uhr in irgendeinem ›weißen Löwen‹ oder ›wilden Bären‹ der nächsten Landstadt befinden würde, seelenruhig ein Süppchen mit dem Wirte verzehrend.
Auf diese feststehende Lohnkutscherpraxis baute Frau von Pröhl die Gründe ihrer Hoffnung, und es war anzunehmen, dass sie richtig kalkuliert hatte.