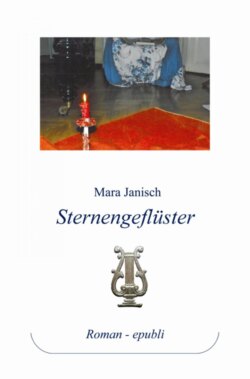Читать книгу Sternengeflüster - Mara Janisch - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Umberto und Orpheus
ОглавлениеFehler machen ist eine Schande?
„Keine Fehler machen ist eine Schande!“, werde ich den Kräften in der Helftorgasse entgegenschleudern. Warum finden sich so viele Menschen damit ab, dass Fehler machen angeblich eine Schande sein soll?
Ein wunderbarer Juni-Tag erwartet mich, die Luft ist erfrischend, inspirierend, ein leichtes Lüftchen weht. Die Sonne blitzt am Himmel, eine Sonne, die noch nicht belastet, noch nicht ihre glühende Hitze schickt. Ich steige gerade aus dem Taxi aus. Das Fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich mir schon lange abgewöhnt, weil niemanden ein Meer der Freude beim Betreten der U-Bahn erwartet. Wer taucht noch in den See der Blicke, in das Wogen von Sympathie und Antipathie beim U-Bahnfahren ein? Jeder kommuniziert mit sich und mit seinem Handy oder er glotzt wie hypnotisiert auf seinen I-Pod und der gefrorene Blick fixiert sich unbarmherzig auf den handtellergroßen Bildschirm.
Beim Meidlinger Tor am Schönbrunner Schlosspark steige ich aus und ich spaziere diesmal durch eine Kastanienallee zur Meierei. Ein rundes, einfaches Gebäude sehe ich von weitem, rundherum sind Tische und Sessel bereitgestellt, die Sonnenschirme locken schon. Mit einem Wort ein kleines Paradies inmitten der Stadt erwartet mich: lieblich, von den Errungenschaften der Technik noch nicht zu sehr entstellt. Die Atmosphäre ist leicht und luftig.
Es ist kurz vor 16 Uhr und einige Menschen sehe ich hier sitzen, noch stehen genug Plätze zur Auswahl. Umgeben von kunstgerecht geschnittenen Hecken, von Sträuchern und Bäumen, Bosquetten genannt, mit einem wohltuenden Ausblick auf die „Meidlinger Vertiefung“, die wie ein großes wasserleeres, seichtes Schwimmbecken aussieht, das mit Rasenflächen ausgekleidet ist. Mein Auge kann im Grünen schweifen, einen großen, weiten Raum kann es abtasten.
In einer halben Stunde kommt Umberto, ich freue mich auf ihn! Wie selten ist es geworden, dass das Auge mitten in der Stadt so viel Raum vorfindet und den weit ausgespannten Himmel sehen kann mit den phantasievollen Wolkengebilden, in denen ich als Kind immer Gesichter gesucht habe. Bei der Gelegenheit frage ich mich, wem die Stadt eigentlich gehört? Den Menschen?
Nein, sie stören eher das Gewoge der Autos und Straßenbahnen, Architekturscheußlichkeiten, der Kräne, Müllcontainer und der fieberhaft betriebenen Wohnbausanierungen.
„Ich bin dafür, die Stadt zur menschenfreien Zone zu erklären“, sage ich mir. Wieder schaue ich zum Himmel. Das Kommen und Gehen der Wolken zaubert neue Gebilde hervor. Kein Stillstand ist zu sehen, nur eine unentwegte Bewegung am Himmel.
„Ja, bitte einen Capuccino mit Schlag“, antworte ich der Kellnerin.
Zwanzig Minuten nach 16 Uhr ist es. Umberto wird gleich kommen. Er ist jung und schön mit großen wachen Augen. Ende Mai hat er seinen zwanzigsten Geburtstag gefeiert. Umberto, oder auch Orpheus, wie ich ihn nenne, hat kein Handy, aber dafür eine wunderschöne Singstimme.
Ob es hier einen Zusammenhang gibt, frage ich mich? So einfach wird es doch nicht sein?
Oh ja, ein Fünkchen Wahrheit ist darin verborgen. Der Umgang mit dem Ohr und der Gebrauch der Stimme beim handynieren ist doch ein sehr fragwürdiger geworden. Den Stimmklang am Handy mit dem des Festnetzes zu vergleichen ist eine höchst interessante Beobachtung, weil die technischen Gegebenheiten am Handy den Stimmklang auf eine Art und Weise verschärfen, dass das Gesetz „Wie man in den Wald hineinruft, so hallt es heraus“ beängstigende Formen für die Kommunikation annimmt. Das Ohr wird unangenehm mit Miss-Klängen bedrängt. Es gibt Menschen, und zu denen gehöre ich auch, die kein Handy verwenden, weil sich das Ohr unwohl bei dieser Klangqualität fühlt. Es wäre bei der Vielfalt der technischen Möglichkeiten ein Leichtes die Klangqualität anzuheben und erträglich zu machen. Aber die Ohren wurden durch die Zumutung des „Fernsehklanges“ bereits so korrumpiert, dass der Schritt zur Ohrenbeleidigung durch die Ausblendung bestimmter Frequenzen durch das Handy nur ein kleiner war. Und so befindet sich das Ohr in einer Situation, dass es dem Hören nicht mehr gewachsen ist. Eine beängstigende Tatsache, dass der Verlust des „Wohlklanges“ so weite Kreise zieht, dass die Stimme sich nicht mehr an einer gewissen Hörqualität heranbilden kann. Die Stimme kann nur das wiedergeben, was das Ohr hört. Wenn das Ohr stirbt, stirbt die Stimme!
Aber Umberto ist ein hörender junger Mensch, der die Wertschätzung für das Ohr nicht verloren hat. Im Gegenteil, er pflegt sie bewusst, weil er ein Sänger werden möchte, und er verweigert sich konsequent dem missklangschulenden Handyton. Jetzt sehe ich ihn von weitem mit elastisch federnden Schritten kommen. Sein offenes, dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar glänzt in der Sonne. Seine Biographie könnte von einem Kitschfilm abgeschrieben sein. Sein Vater ist Venezianer – ein Instrumentenbauer, und Umberto wird in Venedig als Sohn einer Wienerin geboren – und darf sich einer musischen Bildung hingeben.
„Hallo Bella!“, tönt seine weiche Stimme mir entgegen.
„Hallo Umberto, wir haben uns einen schönen Tag ausgesucht“, sage ich und wir umarmen uns herzlich.
„Lydia wollte unbedingt mitkommen, jedoch ich habe sie überzeugen können, dass sie auf dich nicht eifersüchtig sein muss.“
Ich lache.
„Auf deine Gesangslehrerin muss sie wirklich nicht eifersüchtig sein, eher auf deine große Liebe zum Gesang. Sie kann dich ja das nächste Mal von der Gesangsstunde abholen, dann können wir einander kennenlernen“, füge ich hinzu.
„Ja, das ist eine gute Idee“, stimmt er zu.
Schon steht die Serviererin vor uns und er bestellt einen Capuccino und einen Apfelstrudel mit Schlagobers.
„Heute schlägst du wieder zu“, scherze ich.
„Ja, ja, du weißt ich brauche Kraft zum Singen“, sagt er und seine vollen kräftigen Lippen geben seine regelmäßigen und wohlgeformten Zähne frei.
Umberto scheint die schöne Umgebung heute gar nicht zu beachten. Hat er etwas auf dem Herzen?
„Wie geht es dir, Umberto?“, frage ich.
„Weißt du, ich habe wieder versucht, in keine Mechanik beim Üben zu verfallen. Die Scalen verleiten dazu sehr, aber plötzlich war eine bedeutsame Frage auf meinen Lippen. Die Frage, was bedeutet es überhaupt zu singen. Es interessiert mich im Moment weniger, was es bedeutet ein Sänger zu sein, nein, was heißt überhaupt singen? Ein Mensch, der das Bedürfnis hat zu singen, was heißt das?“. Umbertos Augen werden ganz groß und fragend.
„Ich habe mich beobachtet, wenn ich ein Lied singe. Will ich gefallen? Nein, ein Gefühl in mir sucht den Ausdruck im Klang. Das Gefühl, das ich in mir verspüre, ist so beglückend oder so traurig, dass ich andere Menschen daran teilhaben lassen möchte“, schwärmt er.
„Ja, der Klang will in die Welt hinaus zu anderen Menschen“, stimme ich zu.
„Aber nicht nur das, das Gefühl, das in mir ist, möchte sich mit anderen Menschen verbinden“, fährt er fort.
„Ein Cappuccino und ein Apfelstrudel mit Schlag.“
„Danke“, sagt Umberto.
„Nur für sich allein singen – ausgenommen beim Üben – hat wirklich nichts mit Singen zu tun“, antworte ich.
„Genauso empfinde ich es, “ Umberto schaut seinen Kaffee gar nicht an und fährt fort „doch der Klang, der in mir entsteht, wieso hat er solche sozialen Bedürfnisse? Welches Geheimnis verbirgt sich im Klang?“, fragt er weiter.
„Wie alle Geheimnisse, so verbergen sie sich, aber ich denke der Klang kommt aus einer Welt, der der Mensch in seinem tiefsten Inneren angehört. Einer Welt, die ihm entglitten ist, einer Welt, deren Zutritt ihm mehr verschlossen als geöffnet ist. Und jedes Mal ist es ein Wunder, wenn sich dieser Zutritt ereignet. So wie ein scheinbar verbotener Garten, das Paradies, das man zufällig entdeckt“, antworte ich.
Umberto gerät in eine Erregung.
„Und dieses Wunder der Paradiesöffnung soll Abend für Abend mit einer bestimmten Gesangstechnik sichergestellt werden“, stellt er in Frage.
„Eine unverbildete Gesangstechnik ist die Grundlage dafür“, füge ich hinzu.
„Aber mit dieser Grundlage öffnen sich noch nicht die Pforten des Paradieses“, schließt er an.
„Nein, das nicht.“
„Und wer öffnet diese Pforten?“, will Umberto wissen.
Zunächst lächle ich angesichts dieser schweren Frage.
„Ja, wenn man das wüsste; die Gesangstechnik macht sicher den kleinsten Teil, ich schätze 40 Prozent von diesem Wunder aus“, sage ich.
„Wenn ich bedeutende Sänger beobachte und höre, glaube ich diesem Wunder näher zu kommen!“, sinniert Umberto.
„Zum Teil, ja“, gebe ich zu.
„Zum Beispiel, mein großes Vorbild, Giuseppe di Stefano, er hat seine Gesangsausbildung nicht fertig gemacht, aber – oder gerade deshalb hatte er dieses Charisma“, schwärmt er.
„Ja, weil er mit höchster Hingabe und Liebe gesungen hat – mit Enthusiasmus – mit Begeisterung. Und die Liebe des Publikums hat ihn getragen, er durfte auch Fehler machen und ist nicht verstoßen worden. Ein Phänomen, das heute undenkbar wäre. Umberto, willst du noch schöner werden, dein Kaffee wird kalt.“ Er lacht und fährt erregt fort ohne Kaffee und Strudel zu beachten.
„Ich merke jetzt schon an der Musikhochschule, dass ich diesen verbissenen Ehrgeiz einfach nicht mitmachen will, ich kann nur lachen darüber, das hat doch nichts mit Singen zu tun. Einen angemessenen Leistungsgedanken aus der Werktreue heraus zu verwirklichen – das kann ich noch verstehen. Auch, dass ein gewisser Grad an Genauigkeit dazugehört, um zu musizieren – das alles kann ich verstehen. Aber nur diese kalte Perfektion, das lehne ich ab. Das Geheimnis des Singens, es wird ganz entzaubert, profanisiert“, sagt er traurig. „Und wenn ich dich nicht als Privat-Lehrerin hätte, würde ich ganz verzweifeln. Ich überlege mir allen Ernstes, ob ich das nächste Jahr noch mache. Ich habe dort wenig gelernt – im Gegenteil, ich muss aufpassen, dass ich dort nichts verlerne“, antwortet er.
„Umberto jetzt übertreibst du aber ein wenig. Die Hochschule für Musik ist eine ausgezeichnete Schule. Dass deine Individualität eine andere Art der Ausbildung braucht, ist wieder eine andere Sache.“
Umberto schaut sehr traurig aus, aber plötzlich hellt sich sein Gesicht auf und er sagt: „Wir wollten doch unser Lied singen.“
„Schon wieder?“, frage ich.
„Du hast ja gesagt, immer wenn ich traurig werde, soll ich es singen.“
„Aber hier?“, wende ich ein.
„Ja, hier.“
„Na gut“, stimme ich zu.
Wir wiegen uns in den Takt ein und an den Nebentischen sitzen Menschen in ihre Zeitungen vertieft. Wir beginnen „Que serat, serat, whatever will be, will be ...“ zu singen. Wir singen nicht laut, weil wir es nur für uns singen und auch keine Aufmerksamkeit erregen wollen.
Umberto hat eine wunderbare Tenorstimme und ich begleite ihn mit meiner Sopranstimme. Die Menschen werden aber doch aufmerksam auf uns, sie legen ihre Zeitungen weg und lächeln uns an.
Aber in dem Moment ändert sich auch unser Verhalten und wir nehmen die Zuneigung aus einem gewissen Theaterinstinkt sofort an und singen, was wir nicht vorhatten, mit voller Stimme.
Von den Tischen, die um die Ecke der Meierei stehen, kommen Menschen neugierig hervor. Den Serviererinnen merkt man an, dass sie nicht so recht wissen was hier vorgeht. Es ist mir fast schon peinlich, dass wir jetzt so im Mittelpunkt stehen.
Jetzt fangen wir mit der dritten und letzten Strophe an, die mit einem hohen langen Ton endet. Umberto steht automatisch auf, um diesen letzten Ton besser stützen zu können. Ich lasse ihn alleine weiter singen bis über den hohen Ton hinaus, damit man seine Stimme gut hört. Der Schlusston – lang ausgehalten hallt förmlich im Park der Meierei.
Die Menschen applaudieren und kommen zu unserem Tisch.
„Das war wunderschön, so wohltuend, vor allem so überraschend. Einen Klavierspieler haben wir schon oft gehört, aber noch nie Sänger. Kommen Sie morgen wieder hierher, um welche Zeit?“, fragen sie.
„Nein, nein, wir treten hier nicht auf, das war wirklich ein Zufall“, sage ich. Aber niemand glaubt uns; in dem Moment sehe ich Umberto von einer Schar junger Mädchen umringt, die ein Autogramm von ihm wollen.
Plötzlich fangen einige Menschen wieder zu applaudieren an, die anderen stimmen ein.
„Bitte noch eine Zugabe“, hören wir eine Frau sagen.
„Ja, bitte eine Zugabe“, wiederholt sie. Wir stehen vor ungefähr 30 Menschen, die von uns noch eine Zugabe wollen!
Ich versuche den Menschen zu erklären, dass wir hier private Gäste sind und keine Zugaben vorbereitet haben.
„Dann wenigstens eine Strophe noch einmal“, hören wir aus der Gruppe jemand sagen.
Umberto und ich schauen uns hilflos an, in dem Moment ruft die Mädchengruppe um Umberto
„Bitte noch eine Strophe!“.
Also gut, wir singen noch einmal die letzte Strophe. Ich merke wie nervös Umberto wird, weil jetzt die Erwartung der Menschen eine Forderung nach „gut sein müssen“ fast erzwingt, deshalb singe ich mit meinem Orpheus gemeinsam den letzten hohen Ton und er dankt es mir mit seinem Blick. Es ist gutgegangen! Sehr gut sogar! Die Menschen applaudieren wieder begeistert – langsam löst sich die Gruppe auf mit den Worten:
„Morgen kommen wir wieder.“
Ich habe es aufgegeben, den Menschen zu erklären, dass wir hier nicht auftreten und langsam beruhigt sich alles wieder. Da Umberto mehr als überfordert aussieht, rufen wir die Serviererin, um zu zahlen und aufzubrechen. Ich entschuldige mich bei ihr und sage ihr, dass unser Auftritt nicht beabsichtigt war. Sie erwidert, dass wir nichts bezahlen brauchen, weil es eine sehr gute Werbung für die Meierei war und die Bestellungen nach unserem Auftritt sich verdoppelt haben. Zum Abschied sagt sie: „Vielleicht will der junge Mann bei uns im Sommer ein paar Lieder singen, dem Geschäft täte es auch gut!“
Wir verabschieden uns höflich und Umberto verlässt ein wenig fluchtartig mit mir die Meierei.