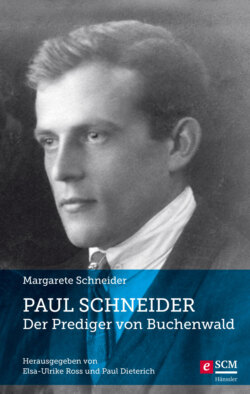Читать книгу Paul Schneider – Der Prediger von Buchenwald - Margarete Schneider - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hochelheim
Оглавление»Anfechtung lehrt auf das Wort merken.«
Jesaja 28,19
Um eine Probepredigt im Kreise Wetzlar zu halten, kommt Paul im Januar 1926 heim und findet einen sterbenden Vater. Ein Schlaganfall hat ihn beim Gottesdienst im Filial getroffen, und nach drei Tagen ist sein Ende da. Paul wird einstimmig in Hochelheim als Nachfolger gewählt; er nimmt an, wohl wissend, dass er kein leichtes Erbe antritt und dass die Gründe seiner Wahl nicht ganz geistlicher Natur sind. Viele Häuser sind dem »Paul«, der nun der »Herr Pfarrer« wird, herzlich zugetan, vielerlei Erwartungen knüpfen sich daher auch an sein Pfarramt. Die einen wollen »alles beim Alten« haben, wie es beim alten Pfarrer war, d. h., sie wollen außerhalb der Predigt in Ruhe gelassen sein; die andern denken an die Zeit, als Paul im Turnverein einen liberalen Vortrag hielt und zuzeiten aktiv dort mitmachte; die »Stillen im Land« hoffen auf ein volles Mitgehen in ihrem Gemeinschaftsleben, kurz, jeder möchte gern seinen Stempel auf ihn drücken. Was Wunder, dass es von den ersten Tagen an Spannungen gab? – Im Pfarrhaus wird aber nun zuerst geräumt und geordnet, gestrichen und tapeziert, und darüber wird es Sommer. Paul ist in der Zwischenzeit Hilfsprediger in Rotthausen bei Essen. Das Weilheimer Pfarrhaus richtet seiner Jüngsten die Hochzeit. Der Vater ruft seinen Kindern nach Rut 1,1679 zu: »Seid einig, einig, einig – in Glaube, Liebe, Hoffnung.«
Vor dem Einzug ins neue-alte Heim – es ist eine ganz glückliche Mischung – wandern die beiden, wie sie es in Brautzeiten so gerne getan, und dieses Mal erschließt sich ihnen ein Stück schönstes Neuland: Bodensee und Oberstdorf. Brauche ich zu sagen, dass es Wochen fröhlicher, erfüllter Zweisamkeit waren, wie sie uns in ihrer Unbeschwertheit und äußeren Freiheit nie mehr geschenkt waren? – Im Hochelheimer Pfarrhaus erwarten sie der jüngere Bruder80 cand. ing.81 und Sophie, die nun auch der jungen Frau die Treue hält über alle Jahre hin. Superintendent Wieber führt Paul sehr feierlich und väterlich am 4. September 1926 ein. Er hat 1. Chronik 28,20 zum Text gewählt: »Und David sprach zu seinem Sohn Salomo: Sei getrost und unverzagt und mache es; fürchte dich nicht und zage nicht! Gott der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen noch dich verlassen, bis du alle Werke zum Amt im Hause des Herrn vollendest.« Pauls Predigttext ist 1. Timotheus 3,1 und 2. Timotheus 3,14-17.82 Wie sehr Paul ein »Herz« für seine Gemeinde hatte, geht aus einem Gemeindebrief, den er im Urlaub in Pferdsfeld 1931 schrieb, hervor: »Nun sollt Ihr aber nicht denken, meine lieben Gemeinden, dass ich Euch jetzt nicht als meine Heimat betrachte, zumal Ihr mich durch Eure Wahl ja in meinem Elternhause in Hochelheim und an der Stätte meiner Jugendjahre habt bleiben heißen. Ihr seid nun die Heimat meiner Arbeit, meine Mannesheimat und meine Pfarrerheimat, die ich als Pfarrer mit der ganzen Kraft und Liebe, die mir gegeben sind, zu einer rechten, wohligen, warmen, kirchlichen Heimat für Euch alle ausgestalten helfen möchte. Aber gerade darum, weil Ihr wisst, dass ich als Pfarrer gerne bei Euch bin und bleiben will, werdet Ihr es mir gerne gönnen, dass ich mich nun auch in der Arbeitspause der Heimat meiner Kindheit freue und hier neue Kräfte für die Arbeit sammle.«
Wie sah nun diese Gemeinde Hochelheim aus? Zwei stattliche Dörfer83 mit tausend und fünfhundert Einwohnern, von denen nur das Filial rein bäuerlich ist. In Hochelheim ist fast jeder neben seiner kleinen Landwirtschaft erwerbstätig.
Auch der Pfarrer hatte für seine und seiner Familie Versorgung Acker- bzw. Wiesenland und eine Kuh. So schreibt P. S. am 23. Juni 1926, also kurz vor der Hochzeit, an den Schwiegervater: »Sophie hat ein junges, schönes Kühchen, das eine milch- und butterweiche Zukunft verspricht, gegen die alte eingetauscht und verwaltet auch sonst aufs Beste Haus und Wirtschaft.« Am 6. September 1926 freilich schreibt P. S. bezüglich der Kuh: »Wir sind schon am Überlegen, ob wir die Kuh behalten sollen oder nicht.« Am 22. September 1926 meldet er, die Landwirtschaft betreffend, vier Morgen Land würden sie zurückgeben, aber die vier Morgen »Pfarrland« wollten sie weiterbehalten »zur Bewirtschaftung, hauptsächlich wegen der Kuh, die wir einstweilen noch nicht abschaffen mögen.«84
Der Mainzer Käse wird hier hergestellt, zuerst im häuslichen Betrieb, später entstehen maschinelle Käsereien. Sie nehmen zu unserer Zeit einen großen Aufschwung. Die Frauen des Dorfes reisen mit dem Käse auf die Märkte der Großstädte Hessens und des Rheinlandes, und ihre bäuerliche Tracht, die schöne Hüttenberger Tracht, kommt ihnen dabei sehr zustatten. Was früher mühselig im Schubkarren gefahren wurde, kann nun bald mit dem Auto befördert werden! Das Dorf verändert sich dadurch sehr. Der Jugend gefällt die Bauerntracht nicht mehr, sie wird »vornehm«, d. h. städtisch. Großer Fleiß und große Geschäftigkeit herrschen im Dorf. Durch ihren Handel sind sie den Umgang mit Menschen gewöhnt, und das Wort sitzt lose auf der Zunge. Sie haben einen großen Familiensinn, und es ist bezeichnend, dass sie, die so viel unterwegs sind, bei ihren Familienfesten als Lieblingslied singen: »Ich bin so gern, so gern daheim – das ist mein Himmel auf der Erden!«
Die erste Strophe dieses Liedes, das heute noch vom Hochelheimer Frauenkreis mit Wonne auswendig gesungen wird, lautet: »Ich wär so gern, so gern daheim, / daheim in meiner stillen Klause. / Wie klingt es doch dem Herzen wohl, / das liebe, traute Wort: zu Hause! / Doch nirgends auf der weiten Welt / fühl ich so frei mich von Beschwerden. / Ein braves Weib, ein herzig Kind, / das ist mein Himmel auf der Erden.« Die dritte Strophe: »Des Abends, wenn ich geh zur Ruh / und ich mich leg zum Schlummer nieder, / dann falt ich meine Hände fromm, / es schließen sich die Augenlider. / Dann bete ich zum Herrn der Welt, / zu dem, der einstens sprach: Es werde!: / O großer Gott, erhalte du / mir meinen Himmel auf der Erde.«
Mehr und mehr wächst Paul in sein Hirtenamt hinein.85 Nur noch einmal, im November 1927, vertraut er sich seinem Tagebüchlein wieder an, aber er weiß nun, wer Herr wird über seiner »Anfechtung«, seinem »Schmerz«. »Ehemann, Vater und Pfarrer bin ich geworden. Wie viele wandeln in solcher Würde doch auf verkehrtem Wege! Kommt doch auch zu mir noch heutigentages die große Unruhe, dass mein Herz nicht alles verlassen, um Jesus zu dienen.86 Sind mir denn auch die weichen Arme, von denen Kierkegaard 87 schreibt, verhängnisvoll geworden? Habe ich in entscheidungsschweren Augenblicken meines Lebens den rechten Entschluss der Entsagung, des Verzichtes nicht gefunden? Darf ich morgen vor die Gemeinde treten mit der Adventsfreude und Adventsbotschaft? Möchte sie doch heller in meinem Herzen brennen! Möchte Gott mich seine Gnadenfülle wieder reichlich erfahren lassen! O. C.88 tröstete mich, ich habe seit Berlin einen großen Schritt vorwärts gemacht. Sein Hiersein bedeutete, wie ich mir erbeten, Stärkung und Segen. O Gott im Himmel, lass mir nicht alles wieder geraubt werden! Schenk mir Glauben und Frieden. In der Spannung stehend, muss ich hinter all mein Tun und Sagen ein Fragezeichen setzen. Du, Gott, kannst deinen Geist der Liebe über mich ausschütten, dass aus dem Fragezeichen ein freudiges Ja werde. Amen.«
Paul wird ein Beter, einer, den es im Kämmerlein89 auf die Knie zwingt. Ich darf hier ein Wort aus einer Predigt, die er über Daniel 6 am 27. September 1936 hielt, für ihn persönlich geltend machen: »Das Gebet macht aus Menschen Männer, die sich beugen allein vor Gott und die Gott bekennen vor der Welt. Das Gebet ist die Kraft Gottes für den Lebens- und Glaubenskampf.«
Pauls Liebe und Fürsorge galt in erster Linie seinen Kranken; er merkte oft, dass bei ihnen die seelische Not weit größer war als ihre leiblichen Nöte. Er mühte sich, ihre Gewissen wachzurufen und ihnen zum Sterben zu helfen. Eine sterbende junge Frau soll gesagt haben: »Eines muss ich euch noch sagen: Eine selige Sterbestunde wiegt’s ganze Leben auf! Das hat mich Pfarrer Schneider gelehrt, den könnt ihr darum fragen.«
Unsere Gemeindeschwester berichtet: »Ich denke an einen jungen Epileptiker, der von einem schweren Anfall gepackt wurde, der drei Tage und drei Nächte andauerte. Der Körper wurde hin und her gezerrt, so furchtbar, dass wir alle – eingeschlossen der Arzt – machtlos an seinem Bett standen und trotz schwerster Betäubungsmittel ihn nicht zur Ruhe bringen konnten. Der Teufel grinste uns an in diesem gequälten Menschen. Da trat Pfarrer Schneider an sein Bett, und wir lagen lange mit ihm auf den Knien und flehten zu Gott um Erbarmen. Dann nahm Pfarrer Schneider den Kranken in die Arme, redete ihm gut zu. Was keiner von den Pflegenden fertiggebracht hatte, das wurde Pfarrer Schneider geschenkt: Der Kranke wurde unter seiner Hand ruhiger und schlief ein. Wenn ich nachts an diesem Krankenbette stand und selber fast verzweifelte bei dieser schweren Pflege, dann hörte ich plötzlich das Motorrad von Pfarrer Schneider, und er kam in die Krankenstube und sagte: ›Ich wusste, dass ich hier nötig war‹, und er war es im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht selten kam mir in diesen Tagen der Gedanke an Pfarrer Blumhardt90. Alle, die dies Lager umstanden, erlebten die Kraft des Gebetes. Der junge Arzt sagte zu mir: ›Es ist doch etwas Seltsames um Pfarrer Schneider!‹ Als es mit dem jungen Mann zum Sterben ging, wurden plötzlich seine Sinne noch einmal ganz klar. Er setzte sich in seinem Bette hoch auf und sagte: ›Ich danke euch allen, dass ich aber selig sterben kann und keine Angst habe vor dem dunklen Grab, das danke ich Ihnen, Herr Pfarrer! Nun bin ich mit meinem Gott im Reinen, und der Teufel hat keine Gewalt mehr über mich!‹ Er legte sich um und starb in Pfarrer Schneiders Armen ruhig und friedlich.
Die gefährdeten Familien ließ er nicht aus dem Auge, und er redete oft sehr eindeutig, und bei aller Liebe und Güte konnte er grob werden, sodass er zum Beispiel zu einem Trinker, bei dessen Familie er bis spät in die Nacht hinein saß, sagte: ›Sie sind ein Lump!‹ Als dieser aufbrauste, da sagte er es nochmals: ›Es wird erst dann mit Ihnen besser, wenn Sie zu mir sagen: Herr Pfarrer, ich bin wirklich ein Lump!‹
Eines Tages brachte Pfarrer Schneider einen Schützling aus der Berliner Stadtmission zu einem Urlaub in unser Haus. Als er mir aus seinem Leben erzählte und ich in Abgründe hineinschaute, da sagte ich zu Pfarrer Schneider: ›Aber Herr Pfarrer, was haben Sie mir denn da für einen Menschen gebracht?‹ Da sah er mich ganz traurig an: ›Was soll denn der Herr Christus mit uns machen, wenn wir so von unserem Bruder denken? Ich hatte gedacht, Sie könnten mir beten helfen.‹ Ich schämte mich und war entwaffnet.
Am 30. Januar 1934 schreibt mir Pfarrer Schneider: ›Wir wollen es immer besser lernen, dass das meiste, was uns zu schaffen machen soll, worüber wir uns zu bekümmern haben, unsere Sünde sein soll, um so auch besser die Sünden anderer priesterlich tragen zu lernen.‹ – Und im April 1937: ›Nur im Geiste rechter Buße können wir mit Vollmacht beten um Gottes Segen für unsere jungen Paare, um Gottes Hilfe gegen die Geister der Krankheit und der Seelennot. Wir wollen bei uns selber anfangen, uns gewiss nicht besser halten als andere. Dass alle menschliche Gerechtigkeit und aller menschlicher Ruhm zunichte werde und ganz allein übrig bleibe Christi Gerechtigkeit, die er uns am Kreuz erworben. Darin allein findet unsere Blöße und Fluchwürdigkeit ihre Deckung. Solange wir noch fromme und tüchtige und gerechte Leute sein wollen, geht uns Christi Gerechtigkeit nichts an.‹«
Auffallend wenig berichtet Margarete Schneider über ihre Kinder, von denen vier in Hochelheim geboren wurden: Dieterich, genannt Dieter, am 20. April 1927; Eva-Maria, genannt Evmarie, am 1. September 1929; Paul Hermann, genannt Hermann, am 6. Dezember 1930; Gerhard am 8. Februar 1933. Das rührt daher, dass M. S. gern sich und ihr eigenes Erleben in den Hintergrund rückt. Sie will ja ein Buch über den Weg ihres Mannes schreiben. Doch zeigen alle Berichte über das Aufwachsen der Kinder – etwa in den »Rundbüchern« an die Geschwister91 –, dass nicht nur sie, sondern auch ihr Mann Paul mit großer Freude an den Kindern hingen. Wir bringen, um diesen Aspekt nicht untergehen zu lassen, einiges über die Kinder, das in den »Rundbüchern« zu finden ist.
Über das erste Kind Dieter schreibt M. S. am 3. Januar 1928, wie er es nicht lang im »Stühlchen« aushält und ständig auf ihren Schoß will; wie sie ihn vor der Kälte im Pfarrhaus schützen muss; wie er zahnt und dabei einen »feuerroten Backen« hat. Oder am 6. April 1928, wie er kein höheres Vergnügen kennt, als ständig Schranktüren auf- und zuzuschlagen. Er werde allmählich ein rechter Bub, an dem seine Mutter zärtliche Regungen noch vermisse. »Ich muss auf der Hut sein, dass er nicht zu eigenwillig wird, die Gefahr ist groß, dass ihn die Kindsmagd zu sehr verwöhnt!«
Von Evmarie berichtet ihre Mutter am 21. Oktober 1930, sie sei »ein liebes, sehr lebhaftes Dingle, und ist in der letzten Zeit auch recht kräftig geworden. Ich hoffe, dass sie doch noch, bis ihr ›Schwesterle‹92 anrückt, das Laufen lernt, so ganz zaghaft probiert sie es manchmal … Es ist gelungen, wenn Dieter Evmarie das Laufen beibringen will, dann zerrt er sie an beiden Händen in der Stube herum, bis sie alle beide auf der Nase liegen. Besser geht es schon, wenn er mit dem Schwesterle um die Wette krabbelt, aber das tut den Strümpfen so weh … ich muss jeden Tag Löcher in die Knie stopfen!« Und am 21. Juni 1932 wieder über Evmarie: »… ich habe manchen Verdruss mit ihrem erheblichen Eigensinn auszufechten, sie gibt nicht klein bei, wenn richtig ernst gemacht wird. Der Vater ist sehr entzückt von seinem Töchterchen. Es ist ja auch wahr, es gibt nichts Herzigeres als so ein kleines Mädle.«
Bezogen auf ihr Kind Hermann schreibt M. S. am 21. Juni 1932: »Das Hermännle ist ein so liebes Büble geworden, krabbelt schon ein bissle und wird allmählich auch flinker auf den Beinen; er kann ein so liebes schelmisches Gesichtle machen, dass man seine weniger schönen Seiten eben auch gern in Kauf nimmt.«
Über ihr viertes Kind Gerhard schreibt M. S. Jahre später an ihren gefangenen Mann: »Unser Gerhard interessiert sich nun für vieles … Er sieht Dir so ähnlich, dass man sich hüten muss, ihn deshalb extra liebzuhaben!«93
Was beschäftigte die Kinder im oder beim Hochelheimer Pfarrhaus? »Unsere Kinder vertreiben sich meist die Zeit am Sandhaufen im Hof, nachmittags ist aber dann gewöhnlich der Ausgang mit dem Leiterwägele in den Garten vor dem Dorf, wo ich bis jetzt immer auch allerhand Arbeit habe und nun auch das Ernten allmählich anfängt« (Rundbuch 21. Juni 1932).
Man kann sich unschwer vorstellen, dass M. S. mit ihren Kindern alle Hände voll zu tun hatte. Denoch fand sie Zeit, als »Pfarrfrau« sich voll einzusetzen bei Besuchen in der Gemeinde, auch bei Schwerstkranken. Sie berichtet im Rundbuch am 21. Juni 1932 erschüttert vom Todeskampf eines schwer epileptischen jungen Mannes, der unter tagelangen Krämpfen sterben musste; ebenso von dem jungen Nachbarn, der »nach zu starkem Luminalgenuss auf dem Sterbelager lag«. Man stehe vor dem Rätsel, ob der junge Mann absichtlich oder im Dämmerzustand vor oder nach einem Anfall die tödliche Dosis genommen habe. Es ist deutlich, dass die junge Pfarrfrau sich bald auch als »Mutter der Gemeinde« fühlte und sich gelegentlich im Zwiespalt zwischen ihrer Sorge für die Kinder und der Rolle der fürsorglichen Pfarrfrau wiederfand, weshalb sie im Blick auf ihre noch kinderlose Schwägerin Luise Dieterich94, die Frau ihres Bruders Karl, schreiben konnte: »Die liebe Luise in Rötenberg hat eines vor uns anderen Pfarrfrauenschwestern voraus: Wenn sie auch das Glück mit eigenen Kindern bis jetzt entbehren muss, 95 sie kann doch eine rechte Pfarrfrau ihrer Gemeinde sein und läuft nicht mit dem beständigen Stachel im Gewissen herum, dass man zu wenig zu Gemeindebesuchen kommt und zu sehr sich selbst und seinem eigenen Reich lebt!«
Auf die kirchliche Sitte wird gehalten. Jede Altersgruppe geht zweimal im Jahr an ihrem bestimmten Sonntag zum Abendmahl. Die feierliche Abendmahlstracht der Frauen gibt diesen Sonntagen ein besonderes Gepräge. Jeder Neuling ist beeindruckt von der Ehrwürdigkeit dieser kirchlichen Sitte. Paul aber weiß, dass sie im Gegensatz steht zu der zunehmenden Verweltlichung und Entkirchlichung, die besonders bei der Jugend eingesetzt hat. Zwar wird am Abendmahlsgang festgehalten, aber wo kann da noch Ehrfurcht sein, wo Sündenerkenntnis, wo Buße, wo Bereitschaft, sich von Christus beschenken zu lassen, wenn man sonst selten oder nie unters Wort kommt?96 Lässt man sich nicht nur vom Rhythmus des Althergebrachten bestimmen? Paul wurden die Abendmahlsfeiern der jüngeren Gruppen mehr und mehr zur Last. Ältere Amtsbrüder rieten Paul, diese Sonntage als missionarische Gelegenheiten zu werten, aber er, der volksmissionarisch Begabte, war gerade an diesen Sonntagen gehemmt. Trug er als Seelsorger nicht mit die Verantwortung, wenn viele mit gleichgültigem Herzen zum Herrenmahl kamen? In der Beichtansprache bat er die Jugend – wohl nicht nur in dem einen mir bekannten Fall –, doch den Mut zu haben und in den Bänken zu bleiben, er achte sie darum – wenn sie doch nicht von ihrem alten Treiben lassen wollten. Sie taten’s nicht. Am Abend aber besuchte sie der Pfarrer im Tanzlokal. Paul wies immer wieder hin auf die Notwendigkeit des selbstständigen Beichtgottesdienstes und die persönliche Anmeldung zum Abendmahl, wie es ja auch in früheren Zeiten gute Sitte war.
Der selbstständige Beichtgottesdienst mit Beichtansprache, Sündenbekenntnis und Zuspruch der Vergebung, der in der Regel etwa drei Tage vor dem Abendmahl gefeiert wurde, sollte dem Abendmahlsgast die Gelegenheit geben, seine Lebenspraxis vor Gott selbstkritisch zu bedenken, eventuell auch mit Verfeindeten Frieden zu schließen, nach dem Wort Jesu: »… wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe« (Matthäus 5,23f). Die persönliche Anmeldung zum Abendmahl – sie geschah in vielen Gemeinden an einem bestimmten Abend in der Sakristei der Kirche – sollte dem Pfarrer Gelegenheit geben, dem sich Anmeldenden unter Umständen ein seelsorgerliches, etwa auch ein vermittelndes Gespräch anzubieten. P. S. vertrat die Auffassung, die Dietrich Bonhoeffer97 1937 in seinem Buch »Nachfolge« ausgeführt hat: »Billige«, d. h. folgenlose Gnade, Gnade als Schleuderware, Vergebung für Sünden, die man weder bereut noch künftig lassen will, ist »der Todfeind der Kirche«. »Teure« Gnade, die Jesus das Leben gekostet hat, verändert, wenn sie als kostbares Geschenk empfangen wird, das Leben dessen, der aus ihr lebt. P. S. mühte sich, der drohenden »Banalisierung« des Abendmahls entgegenzutreten.
Paul erstrebte eine Abendmahlsfeier inmitten der mitsingenden und betenden Gemeinde, die in kürzeren Abständen jeden rief und jeden anging, der sich rufen und dienen lassen wollte. Mit seinem Presbyterium98 kam er darüber nicht überein. Weihnachten 1933 schien ihm das Jugendabendmahl in der alten Form unmöglich zu sein; er setzte dafür ohne Beschluss des Presbyteriums99 beim letzten Adventswochengottesdienst ein Gemeindeabendmahl an. »An Weihnachten konnte ich nun nicht mehr wie nun 7 Jahre lang das Jugendabendmahl nach alter Sitte abkündigen und abhalten. Es war nachgerade ein Unfug, dass bei dem im Übrigen recht spärlichen Gottesdienstbesuch der Jugend – Sport und Hitlerdienst haben einer Gottesdienstsitte der Jugend den Rest gegeben – sich zu diesem Fest-Abendmahl alles drängte und so seine Verpflichtung gegen Kirche und Gott ablöste. Nun habe ich also den Zwang der Sitte zerbrochen. Ich rief zu einer Bekenntnisfeier mit anschließendem freiwilligen Abendmahl auf« (Brief vom 29. Januar 1934). – Die Gemeinde wird »nicht entlassen«, eine kleine Schar – Junge und Alte – lässt sich rufen. Wer etwas weiß von Dorfgemeinschaft, Gebundenheit an Dorfsitte bis hin zur feierlichen Kleidung, der mag ermessen, wie schwer es jedem Einzelnen geworden ist. Auch einer der sechs Presbyter erhob sich und trat ruhig und feierlich heraus. Dies ist Pauls letztes Abendmahl in Hochelheim gewesen. Der Bruch mit seinem Presbyterium wurde darüber endgültig. Sein »eigenmächtiges Handeln« wurde dem Konsistorium100 angezeigt. Paul wusste, dass er gegen die presbyteriale Ordnung101 verstoßen hatte, er hoffte aber, dass er sich um der Sache willen mit seinen Presbytern wieder zusammenfände, aber diesem Ringen wurde vom Konsistorium und von der NSDAP bald ein Ende gesetzt. (Siehe den Bericht am Ende dieses Abschnittes über Hochelheim.)
Da der Konflikt um das Abendmahl, den P. S. vor allem Ende 1933/Anfang 1934 durchzustehen hatte, P. S.s Anspruch an die Wahrhaftigkeit kirchlichen, besonders gottesdienstlichen Lebens eindrücklich zeigt, auch weil dieser Streit wesentlich dazu beigetragen hat, dass sich P. S. in Hochelheim als Pfarrer nicht mehr halten konnte, hier noch einige Einzelheiten:
Wenn wir die Gewissensnöte des Pfarrers P. S. im Blick auf die traditionellen Jahrgangsabendmahle – sie haben sich in Jahren verdichtet – verstehen wollen, müssen wir uns vor Augen führen, wie M. S. sie im Gespräch mit P. Dieterich beschrieben hat: Zirka hundertfünfzig bis zweihundert hauptsächlich jugendliche Abendmahlsgäste – es werden meist vier Jahrgänge zusammengefasst – kommen nacheinander gruppenweise vor den Altar, stehen da, zum Teil die Hände in den Hosentaschen, signalisieren einander mit eindeutigen Gesten ihr bares Unverständnis, ja ihre Verachtung dessen, was hier abläuft. Sie verhalten sich wie Leute, die sich durch die allmächtige Sitte, durch Elterndruck und Dorfsitte, zu einer Handlung, die sie im Innersten ablehnen, genötigt fühlen. Der Pfarrer denkt derweilen an 1. Korinther 11,27-29: »Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet (oder: nicht unterscheidet), der isst und trinkt sich selber zum Gericht.« P. S.s Anspruch an die Wahrhaftigkeit seines Tuns wird von Jahr zu Jahr tiefer verletzt. Er fühlt sich schuldig, der Zeremonienmeister eines die jungen Leute verderbenden religiösen Theaters zu sein. Immer wieder hat er versucht, den Presbytern seine Bedenken verständlich zu machen. Ohne Erfolg. Ihnen ist die kirchliche Sitte wichtiger als die Gewissensnot des Pfarrers, die sie nicht verstehen.
In dieser seiner Not ändert er kurz vor Weihnachten 1933 die Abendmahlssitte. Das heißt – so sein Bericht an den Superintendenten:102 »Am 3. Advent forderte ich die Gemeinde auf, den 3. Adventsgottesdienst der Woche am Mittwoch als solchen Bekenntnisgottesdienst zugleich zu beachten, und lud zu einer anschließenden freiwilligen Abendmahlsfeier, die adventlichen und bekenntnismäßigen Charakter tragen sollte, ein. Zugleich setzte ich … das seitherige Weihnachtsabendmahl der Jugend aus und lud die Jugendlichen, die das Bedürfnis nach weihnachtlichem Abendmahlsgang hätten, auf Mittwochabend ein. Weil ich mir vom Presbyterium nur Hemmung und keine Förderung versprechen konnte, tat ich es allein auf meine Verantwortung. Hinterher bat ich das Presbyterium um sein Einverständnis. Das bekam ich nicht, sondern das Presbyterium … erhob Einspruch …« Er habe zu einer Gemeindeversammlung mit Aussprache über die örtliche Abendmahlssitte eingeladen. Viele Männer und Jugendliche seien gekommen. »Ich fand Widerspruch und Zustimmung … Als mir dann in einer eindringlichen Mahnung zum Bekenntnisgottesdienst im Vergleich mit den Massenabendmahlen das Wort ›Hammelherde‹ entfiel, benutzten es die Böswilligen zum Protest zum Weggehen. Der größte Teil blieb im Saal, und wir hatten hin und her noch eine fruchtbare Aussprache …«
Warum diese Änderung? Dem Superintendenten gegenüber erinnert P. S. daran, »dass in den sieben Jahren, die ich hier bin, die Abendmahlsgottesdienste mit ihrer starren Sitte, mit den vor dem Tisch des Herrn zahlreich auftauchenden Gesichtern derer, die sonst die Kirche und Gottes Wort nicht brauchen, die größte Last gewesen sind und ich dann meinen Dienst immer mit einem Anstoß meines Gewissens verrichtet habe, weil die Sitte allzu sehr die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit erstickte, ich auch keines Segens dieser Abendmahlsfeier froh werden konnte. Dem unwürdigen und unbußfertigen Besuch des Abendmahls musste ein Halt zugerufen werden, beziehungsweise die Gemeindeglieder mussten vom Zwang der Sitte befreit werden.« Nicht umsonst habe ein früherer Pfarrer von Hochelheim in der Kirche gesagt, es gäbe kein verlogeneres Wort als das »Ja« der Beichte beim heiligen Abendmahl.
Nach dem Mahl in neuer Form sei er froh gewesen, »dass wir den Abendmahlsgottesdienst und das Abendmahl so zu einem Bekenntnis geformt haben. Ich war froh, dass hier der Durchbruch durch die starre und zur Unsitte gewordene Abendmahlssitte erfolgt war, die den Sinn und die Bedeutung des Abendmahlsganges nicht mehr deutlich werden ließ.« Er versichert: »Ich konnte nicht anders. Der Anfang ist nun gemacht. Zurück kann ich nicht mehr. Ich bitte Herrn Superintendenten um freundliches Verständnis oder gar Billigung meines Handelns. Wir möchten Gemeinde werden in dieser entscheidungsschweren Zeit, in der uns vielleicht schwere Stürme bevorstehen.«
Vier Presbyter aus Hochelheim beschwerten sich wegen des Vorgehens ihres Pfarrers in der Frage der Abendmahlssitte beim Konsistorium in Koblenz.103 Sie schilderten die Sitzung des Presbyteriums, die eine Stunde vor der Gemeindeversammlung stattgefunden habe. Der Pfarrer habe sie mit seinen Argumenten nicht überzeugt. Er sei plötzlich von ihnen weggeeilt. Er achte seine neuen Presbyter nicht, habe einen eigensinnigen Charakter. »Wir, die Unterzeichneten, erklären, dass unter solchen Umständen unsere Mitarbeit unmöglich erscheint, und bitten um schleunigste Abhilfe.«
Hier einige Sätze aus der Stellungnahme, die P. S. auf dem Dienstweg dem Konsistorium zukommen ließ:104 Er schreibt, die Vorschriften der Kirchenordnung seien ihm wohl bewusst gewesen, es müssten doch aber auch nach der Meinung der Kirchenordnung Herkommen und Sitte nicht unabänderliches Recht sein. »Es muss in einer evangelischen Gemeinde das Recht bestehen, eine offenbar zur Unsitte gewordene Sitte, die Gottes Anspruch und Forderung nicht mehr deutlich werden lässt, nach dem höheren Recht eines in Gott gebundenen Gewissens und an die Schrift gebundenen Handelns zu brechen.« Er habe »der Heiligkeit der Abendmahlsfeier, der Möglichkeit ernster Selbstprüfung für alle Abendmahlsgäste, zu der uns die Schrift ermahnt, und dem Abendmahl als einem freiwilligen Bekenntnisakt zu unserem Herrn … Geltung verschaffen wollen. Das christliche Gemeinwesen und die rechte Auffassung vom heiligen Abendmahl muss zerstört werden, wenn unversöhnliche Nachbarn und solche Gemeindeglieder, die in argen Gerichtshändeln liegen, wenn diejenigen, die sich grober Unsittlichkeit schuldig gemacht haben und dafür bekannt sind, ohne Einspruch des Presbyteriums und ohne Kirchenbuße zum heiligen Abendmahl zugelassen werden.« Die Dorfsitte ersticke den Ernst der Verantwortung und die Freiwilligkeit, die doch jedes Bekenntnis bei sich haben müsse, vollkommen. Dass Jesus sein Mahl auch mit Judas gefeiert habe, das überzeuge ihn nicht als Rechtfertigung der Jahrgangsabendmahle. Denn Jesus habe beim Mahl ja doch den Verräter bezeichnet. »Höchstens könnten wir uns schuldig machen, dass wir durch diese der Sitte folgende, aber schriftwidrige Art der Abendmahlsfeier noch Judasse großziehen, und das will unser Heiland sicher nicht.«
Da er wohl weiß, dass dieser Konflikt die Frage aufrollen wird, ob er in der Gemeinde als Pfarrer noch tragbar sei, weist er zum Schluss darauf hin, »dass das gottesdienstliche und kirchliche Leben der Gemeinde durchaus nicht gestört erscheint, Gottesdienste und Frauenhilfe sind besser besucht als früher, ein Mütterschulungskurs in der kommenden Woche wird voll besetzt sein und eine Volksmissionswoche Mitte Februar erwarten wir mit Freuden. Ich habe die Überzeugung, dass ohne Eingriffe von außen unser Gemeindeleben sich aufs Beste ordnen wird.«
Die rechte Stellung zu den Sakramenten nicht ohne Kirchenzucht!
Während des Kampfes der Bekennenden Kirche (BK) im Dritten Reich bekam die Kirchenzucht, besonders als »Lehrzucht«, bei den Auseinandersetzungen mit den Irrlehren der Deutschen Christen (DC) neue Bedeutung. Aber auch die Frage, ob bei mutwilliger Zerstörung der Bekennenden Gemeinden oder bei brutalem, menschenverachtendem Lebenswandel von Kirchenmitgliedern nicht Kirchenzucht geübt werden müsse, hat da und dort bekennende Christen beschäftigt. Oft unterblieb die Diskussion aber auch, weil Pfarrer und Gemeindeälteste den Konflikt mit den Parteigewaltigen scheuten.
In P. S.s pfarramtlicher Praxis spielte die Kirchenzucht durchaus eine Rolle. Seine Ausübung der Kirchenzucht hat sowohl in Hochelheim als auch besonders später in Dickenschied und Womrath die Konflikte verschärft, die seinen ferneren Lebensweg bestimmen sollten. Umso wichtiger ist es, dass der Leser sich mit der Frage befasst, was Kirchenzucht in den evangelischen Kirchen bedeutet und wie P. S. sie verstanden hat.105
Vater Schneider hielt in seiner Amtszeit streng gesetzlich darauf, dass der Rest von Kirchenzucht, der sich durch die Jahrhunderte erhalten hatte, geübt wurde. Es handelte sich dabei um Verstöße gegen das sechste Gebot. Brautpaare, die ein Kind erwarteten, wurden ohne Brautschmuck und ohne jede Feierlichkeit in der Studierstube getraut. Eine große häusliche Feier war nicht erwünscht. Stille Trauungen106 waren am Werktag, festliche Hochzeiten immer am Sonntag. Es kam auch vor, dass der Pfarrer vor der Taufe eines Kindes sagte: »Die Eltern dieses Kindes haben Gott und die Menschen belogen«107, u. a. m. – Paul war von den ersten Tagen seines Pfarramts an gezwungen, sich um die rechte Ausübung der Kirchenzucht zu mühen. Er wurde förmlich unter Druck gesetzt – durch Unterschriften des Presbyteriums, durch einen »Streik« eines Brautpaares – am Vortag seiner Amtseinführung! –, die alte Form zu lockern. Er konnte auch aus eigener Überzeugung des Vaters Kurs nicht halten. – »Zu meinem Empfang warteten statt der Kutsche am Bahnhof gleich vier Amtshandlungen, darunter zwei nicht ganz erquickliche: eine Trauung, bei der ich den letzten Rest von Kirchenzucht in Gestalt der Stilltrauung einstweilen fahren ließ, indem ich sie am Sonntag feierlich in der Kirche vornahm, was mir in Anbetracht des darauffolgenden lärmenden Festes wieder leidtun wollte, und dann die Beerdigung eines Selbstmörders aus unserem Studentenkreis, bei der ich nun umgekehrt mich an die kirchliche Ordnung bindend – gegen alle Bitten der Gemeinde – nur im schwarzen Rock auf dem Friedhof amtierte, 108 Text Jesaja 48,17.18 109. Recht gemacht werde ich es auch diesmal nicht haben« (Brief vom 6. September 1926 an Marie und Karl Dieterich). – »Der Kampf um die Kirchenzucht in den Gemeinden ist noch nicht ganz ausgetragen und wird wohl noch mit meiner Niederlage enden, die mir selbst am Ende nicht so unlieb ist.110 Da bleibt nachher nur noch der Kranz und die Krone (Tracht) als Ehrenzeichen und die stille Trauung für die, die guten Willens sind« (Brief vom 21. Oktober 1926). – Von nun an rang Paul während seiner ganzen Amtszeit um das Verständnis der reformatorischen Kirchenzucht. Über Kirchenzucht sagt Calvin: »Sie ist die Sehne der Kirche. Wenn man diese Sehne zerschneidet, dann ist der ganze Leib kraftlos.«111 In seinem Filial versuchte er in Einheit mit seinem Presbyterium, sie im Glaubensgehorsam auszuüben, wo immer ein öffentlicher Verstoß gegen Gottes heilige Zehn Gebote der christlichen Gemeinde Ärgernis112 gab. Diese Kirchenzucht wurde von einem großen Teil der Gemeinde im Glauben angenommen, von anderen mit heftigstem Widerspruch abgelehnt. Ein Beispiel:
Da hat der Streit zweier Nachbarn ein solches Ausmaß angenommen, dass der Pfarrer einschreitet und beide vor dem Abendmahlsgang vors Presbyterium lädt, um ihnen Gelegenheit zur Versöhnung zu geben. Der eine kommt, der andere nicht, ist aber dann dennoch beim Abendmahlsgottesdienst. Der Pfarrer lässt ihn vor der Beichte durch den Küster bitten, die Kirche zu verlassen. Er bleibt. Da wendet sich nach der allgemeinen Beichtfrage der Pfarrer ganz persönlich an ihn, den im Dorf einflussreichen Mann. Nun steht er auf und geht hinaus. Erst später, nach einem Unfall und langem Krankenlager des Betreffenden, kommt diese Geschichte zu einem guten Ende. – Wer dreimal unentschuldigt in der Christenlehre fehlte, wurde ein Jahr lang nicht zum Patenamt113 zugelassen. Da dort die jungen Paten sehr beliebt waren und man bis zu sechs Paten hatte, musste man schon aufpassen! Getauft wurde nur in der Kirche im Gemeindegottesdienst114 und nur in Gegenwart des Vaters bzw. der Eltern. – In Hochelheim hielt das Presbyterium im Wesentlichen nur an der sehr gelockerten Trauzucht fest. In der Seelsorge ging Paul persönlich ratend und mahnend darüber hinaus. Er hat sich dadurch manche Feindschaft zugezogen, wie z. B. die des Stützpunktleiters der NSDAP115, der Pauls Stellung zum NS-Staat darum doppelt scharf unter die Lupe nahm.116
Unser großes Anliegen war die Erfassung der Gemeindejugend. Das gelang wohl im Filial etwas besser als im Hauptdorf. »In Dornholzhausen sind die Verhältnisse anders als hier, ich möchte sagen alttestamentlicher! Geiz, Alkohol und Unsittlichkeit unter der Jugend sind auch dort mächtig. Aber in der Evangelisation vor Totenfest 117 durch einen Berliner Freund wurde das Wort im Ganzen willig aufgenommen, und es bietet sich dem missionarischen Willen der Kirche weit mehr Einflussmöglichkeit auf das ganze Dorf.« – »In Hochelheim trafen wir einen Jungfrauenverein und Jünglingsverein an, und da es kaum gelang, aus der Dorfjugend neue Glieder dazuzugewinnen, hielten wir auch offene Abende. Wie oft stand aber die Tür des Pfarrhauses umsonst offen!« Auch durch Freizeiten suchten wir Eingang zu gewinnen. Paul konnte mit der Jugend von Herzen froh sein. Spielen, Basteln, Turnen, Wandern und besonders Singen waren ja auch seine Freude! Selbstverständlich aber war ihm, dass die Bibelbesprechung im Vereinsleben nicht fehlte und dass man von denen, die kamen, auch etwas verlangte an christlicher Lebenszucht und Mitarbeit im Gemeindeleben. Es war ein Auf und Ab in unserer Jugendarbeit. Oft mussten wir einsehen, dass »zu viel gemacht und zu wenig gewachsen war«.
Am 3. Januar 1928 berichtet M. S. im Rundbuch voll Freude: »Jede Woche kommen 30 bis 40 Mädchen zu uns ins Pfarrhaus. Es sind neben den Mädchen von Gemeinschaftsleuten118 auch noch ein paar andere. Die Konfirmandenmädchen sind uns bis jetzt auch treu geblieben.119 In Dornholzhausen haben wir’s nett, da sind wir mit den Mädchen schier jede Woche in einem anderen Haus.« Dass ihr großer Einsatz für die jungen Mädchen der Gemeinde seiner Frau aber nicht nur Freude brachte, das lässt P. S. im Rundbuch am 26. Juni 1932 durchblicken: »Die liebe Gretel ist hier in Hochelheim leider gar nicht auf Rosen gebettet, wie sie es doch verdient hätte, nachdem sie landfremd geworden120, mein Volk zu ihrem Volk121, mein Amt zu ihrem Amt gemacht hat … Mit wie viel Liebe und Freudigkeit hatte sich Gretel von Anfang an um die jungen Mädchen bemüht, und schließlich glaubten wir unser Liebeswerben mit Erfolg gekrönt, als sich im Anschluss an eine schön verlaufene Jungmädchenfreizeit im vorletzten Winter aus der ganzen Umgebung 37 Mädchen zu einem Ev. Jungmädchenbund sammelten. Doch … bald zeigte es sich, dass sich die Herzen fester banden an eine neu auftretende Damenriege des Turnvereins, an den weltlichen Gemischten Chor u. a. als an uns, und als ich an Weihnachten unserer vergnügungsseligen Jugend im Wirtshaus entgegentrat, kam unser Jungmädchenbund zu Bruch und auch die Ansätze in der Burschenarbeit, die sich gebildet hatten … Es war doch niederdrückend und ein Stück Herzweh für uns und besonders für Gretel, … so zurückgeworfen zu werden, nachdem wir Haus und Stube, Zeit und Kraft und Familienleben – fast keinen Abend hatten wir im Winter für uns selbst – hergegeben hatten.«
Fast noch härter trafen die beiden Pfarrleute die Vorgänge um die Krankenpflegestation in Hochelheim, die sie mit der Kirchengemeinde im Sommer 1931 eingerichtet hatten. M. S. hatte mit großem Eifer die nötigen Einrichtungsgegenstände zusammengetragen, hatte mit der »Frauenhilfe« einen Gemeindeabend mit Verlosung organisiert, dessen finanzieller Erlös den ersten Baustein für die Einrichtung der Krankenpflegestation brachte. Die neue Krankenschwester freilich zeigte von Anfang an dem Pfarrhaus die kalte Schulter und, so berichtet P. S. im Rundbuch am 26. Juni 1932, »nachdem ich ihr dann schließlich auch über ihre Amtsführung einmal etwas hatte sagen müssen, paktierte sie mit dem unchristlichen Teil des Dorfes, hetzte sozusagen fast das ganze Dorf gegen mich auf, und als sich dann das Mutterhaus, von dritter Seite darauf aufmerksam gemacht, energisch einmischte, antwortete sie mit Austritt aus dem Mutterhaus und ließ sich nun … von einem sich aus weitaus des Dorfes Mehrheit bildenden Krankenpflegeverein anstellen. Unsere Kirchenvertretungen hatten bei dem Handel völlig versagt, ja dazu die Hand geboten und überließen nun auch die Einrichtung leichten Herzens und billig dem Krankenpflegeverein.« Die Schwester tue nun ihren Dienst durchaus nicht im Geist christlicher Diakonie. »Das Ganze war uns wie ein Keulenschlag, und Gretel hat mehr als eine bittere Träne geweint.« P. S. gibt zu erkennen, dass diese Entwicklung in ihnen eine Krise ausgelöst habe, sie hätten sehr um ihre Treue zur Gemeinde ringen müssen. Auch hätten andere Gemeinden sie gern als Pfarrleute gehabt. Er habe es aber nicht über sich gebracht, »aus den Schwierigkeiten und ungelösten Verhältnissen, mancherlei Anfängen und unvollendeten Aufgaben einfach wegzugehen. So wollen wir in Hochelheim bleiben und mit neuem Mut und Vertrauen und neuer Liebe, die uns Gott schenken möge, weitermachen.« Wacker behauptet habe sich in diesen Auseinandersetzungen die Frauenhilfe!
In beiden Dörfern entstanden bald Frauenhilfen122. An diese Arbeit kann ich nur mit großer Freude und Liebe zurückdenken. Unsere beiden Frauenhilfen standen uns tätig und hilfsbereit zur Seite, sei es in der Armenpflege, sei es bei der Einrichtung einer Schwesternstation. In allen Stürmen blieben die Frauenkreise bestehen, verfestigten sich immer mehr unter Gottes Wort und waren auch während des Dritten Reiches ein Bollwerk der Bekennenden Kirche (BK). Nach unserem Weggang durften wir ihre Treue erleben. Wir wurden mit Omnibussen besucht, durften Gegenbesuch mit unseren Hunsrückern machen. Am Grab meines Mannes standen diese treuen Frauen, und noch heute reißt die Verbundenheit nicht ab.
Mit Vergnügen berichtet M. S. am 21. Oktober 1930 im Rundbuch von einem Ausflug »ihrer« Frauenhilfe nach Bad Nauheim: »Natürlich sahen wir viele Ausländer im Weltbad und staunten die Mode an, meine Frauen wurden ihrerseits in ihrer Festtagstracht auch gehörig besichtigt und angeranzt. Unser Frauenverein ist uns bis jetzt die größte Freude und Aufmunterung; da haben wir wirklich einen Stamm, der treulich zusammenhält …«
Gerne fuhr Paul zu Singwochen123 und kirchlichen Freizeiten. Erfüllt kam er heim, aber das »Heimkommen ist doch immer das Schönste«. – »Und wie freundlich fügt es Gott, dass er uns über dem Ärger und der Enttäuschung draußen in der Gemeinde die Freude an unseren Kindern drinnen schenkt, gleichsam als Ausgleich. Nein, wir wollen und dürfen nicht klagen und haben doch noch viel mehr Ursache zum Loben und Danken!«
Auf seinem Rad, später Motorrad, war Paul vielfach unterwegs, da er die synodale Betreuung der Fürsorgezöglinge124 hatte. Sie waren in »dauernder Bewegung«125, und es gab viel zu helfen und zu raten. Auch bei Bastelkursen für Arbeitslose in der Kreisstadt tat er mit, überall der sozialen Not unseres Volkes an seinem Teil steuernd. – In unserem Dorf war ein primitives Obdachlosenheim für fahrende Leute. Wie oft hat er sich um sie bekümmert! Zweimal hatten wir selbst längere Einquartierung von obdachlosen Familien. Aus einem Brief an die Mutter: »Es ist ein Wort so recht für unsere Tage, dass der rechte Sozialismus nicht auf der Straße, sondern in der Familie anfange.«
Schwester Anna Groth aus Gießen erzählt von ihrer ersten Begegnung mit Paul Schneider: »Mir fehlten Gardinenschnüre für Vorhänge; ein Telefonanruf hatte mir gemeldet, dass ein Handwerker mir in kurzer Zeit das Fehlende bringen werde. Da sprang ein hochgewachsener Mann im Lodenmantel und mit einem Rucksack auf dem Rücken in großen Sätzen die Treppe herauf. ›Na endlich, schön, dass Sie kommen. Nehmen Sie nur gleich die Leiter mit!‹ Paul Schneider strahlte über das ganze Gesicht. ›Gut, wir wollen uns schnell dranmachen. Wie oft habe ich meiner Mutter schon dabei geholfen!‹ Und dann stellte er sich vor: ›Der neue Pfarrer von H.‹ Wie oft haben wir danach über diesen Irrtum gelacht! Ernster wurde dann später unsere Begegnung an dem Sterbebett einer jungen Mutter, die eine Schar unversorgter Kinder zurückließ. Die Forderung des jungen Pfarrers, sich nur ungesäumt mit Freuden zu einem seligen Sterben zu rüsten, schien mir unmenschlich, und ich sagte ihm das. Wir kamen nicht überein, und auch ihn ließ dieses Sterbebett so bald nicht mehr los. Eines Tages bat er mich, ihn und seine junge Frau doch einmal in H. zu besuchen, wir könnten dort in Ruhe über diese Dinge sprechen. Im Laufe der Jahre bin ich dann so manches Mal dort eingekehrt, und immer war unsere Begegnung eine lebendige. Waren wir uns über irgendeine Fragestellung und ihre Beantwortung nicht ganz im Klaren, so bekam ich ein Buch in die Hand gedrückt, dessen Seiten mit zahlreichen Notizen, Frage- und Ausrufungszeichen bedeckt waren.
Bei der Lebhaftigkeit seines Geistes und Temperamentes konnte er manchmal heftig dreinfahren; das blieb nicht aus. Meine ›Toleranz‹ ärgerte ihn oft; für ihn gab es nur schwarz oder weiß, Feuer oder Wasser. Seit er sich unter schweren Kämpfen seinen Glauben errungen hatte, stand dieser Glaube fest wie ein kantiger, aus dem Boden gewachsener Felsen, an dem die Wasserwirbel emporschäumen und sich, wenn auch unter Toben und Brausen, teilen mussten. Niemals habe ich einen Menschen gekannt, der so völlig unbeirrt, so kompromisslos seinen Weg gegangen wäre. Der junge Kämpfer nötigte einem schon Hochachtung ab, wenn auch seine Jugendkraft über das Ziel hinausschießen konnte. Regelmäßig kam er dann hinterher, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen.
Einmal schrieb er mir: ›Es war mir doch eine große Erleichterung, als Sie mir auf meinen etwas kriegerischen Brief eine so freundliche Antwort schrieben. Hinterher habe ich es nämlich doch mit der Angst gekriegt, ob es recht war, so zu schreiben, wie ich es tat. Christen sollten sich doch immer ganz ernst nehmen und einander gelten lassen.‹ – Dieser seiner herzlichen Art konnten sich nur wenige Menschen verschließen. Dazu kam eine großzügige Gastfreundschaft des Pfarrhauses. Es war in den Jahren der großen Arbeitslosigkeit. Menschen zogen mit Kind und Kegel durch das Land, um für sich und die Ihren das tägliche Brot zu finden. Als ich wieder einmal nach H. kam, herrschte im Pfarrhaus Hochbetrieb. Eine zehnköpfige Familie war dort ohne Unterkunft und Barmittel hängengeblieben. Was war natürlicher, als dass sie im Pfarrhaus Aufnahme fanden? Schnell wurde auf der Scheuer Heu ausgebreitet zum Nachtlager. Wir kletterten die steile Leiter hinauf; da konnte man zwischen den krabbelnden Kindern den großen Mann sitzen sehen, mit ihnen spielen und ihnen von dem großen Kinderfreund erzählen hören. Unvergesslich stehen diese Bilder mir vor Augen. Damals wohnte das sorglose Glück im Pfarrhaus, strahlend und leuchtend und andere an seiner Wärme teilnehmen lassend …«
Dass die vielseitige Beanspruchung es auch bewirkte, dass M. S. sich Sorgen um die Gesundheit ihres Mannes machte, kann nicht verwundern. Im Rundbuch schreibt sie am 21. Oktober 1930: »Paul wird bei all dem Umtrieb natürlich keineswegs dicker, es ist nur ein Glück, dass seine Nierengeschichte bis jetzt keine Fortschritte macht … Heute erlebten wir eine komische Enttäuschung: Wir hielten ein festes, rundes Kügelchen, das deutlich an Pauls Oberschenkel zu fühlen war, für die Schrappnellkugel, die Paul als Kriegsandenken mit sich rumträgt. Der Arzt auf dem Versorgungsamt schickte heute Paul in die Klinik zur »Operation«, dort haben sie auch geschnitten, aber es war keine Kugel zu finden, die »Kugel« war nur ein kleines Talggeschwulst. Eine Röntgenaufnahme zeigte dann den richtigen Platz. Sie sitzt ganz fest und unverändert am Beckenknochen und muss eben dort sitzen bleiben.«
In diesem bewegten Pfarrersleben hatte die große Politik nicht viel Raum, doch äußerte sich Paul im geschwisterlichen Rundbrief 1932 nach der Beschreibung einer großen Radtour mit einigen Burschen der Gemeinde darüber so: »lm Übrigen bewege ich mich auf viel faulere Weise mit dem Motorrad im gelben Staubanzug fort, den Pfarrer bis zur Unkenntlichkeit verleugnend und von den Kindern und andern begeisterten Hitlerinnen mit den typischen Heilrufen gegrüßt. Wir sind dieser modernen Volksbewegung – ich drücke mich vorsichtig aus, um in unsern geschwisterlichen Kreis keine politische Trennung zu tragen – noch nicht zum Opfer gefallen, sondern halten es viel lieber mit dem gut schwäbischen Gewächs des christlichen Volksdienstes, haben uns treu und offen zu Hindenburg bekannt bei den Wahlen, was mir meine Stellung freilich noch erschwerte und mir eine Beschwerde des Gauführers der NSDAP beim Superintendenten eintrug, sind aber mit Hindenburgs neuesten Taten nicht ganz einverstanden.«
P. S. äußert sich hier im Kreis der Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger darüber, wo er derzeit politisch steht. Der Christlich-Soziale Volksdienst (CSVD) war eine konservative Partei, die vom evangelischen Christentum her eine den Erfordernissen der modernen Welt Rechnung tragende Staats- und Sozialpolitik vertrat. Auch gewerkschaftlich-sozialpolitisch orientierte Leute, die von den Deutschnationalen abgesplittert waren, fanden sich in ihr. Im Jahr 1924 hat der Christlich-Soziale Volksdienst, der seine Wurzeln im Berlin der Neunzigerjahre des 19. Jahrhunderts hatte, sich mit dem in der evangelischen Bevölkerung Württembergs angesehenen »Christlichen Volksdienst« vereinigt. Der CSVD erreichte bei der Reichstagswahl am 6. November 1932 immerhin vierzehn Abgeordnetensitze (2,5 Prozent). Er fand aber zu keiner festen Gestalt, erhielt bei der nächsten – der letzten freien – Reichstagswahl am 5. März 1933 nur noch ein Prozent der Stimmen und war dann so gut wie verschwunden.126
Der CSVD bejahte die Weimarer Demokratie. An einer Regierung der Weimarer Republik war er nie beteiligt. Er wollte im christlichen Sinn das Volk versöhnen, statt zu spalten; daher stand er jeweils den verschiedenen demokratisch gewählten Regierungen nahe. An der NSDAP kritisierte er heftig die rassistische Ideologie. In der politischen Arbeit sah er »Gottesdienst und Missionsaufgabe« (Art. 1 der Leitsätze des CSVD). Als Ziel verfolgte er die uneingeschränkte Herrschaft Gottes in Familie, Gesellschaft, Volk, Staat und Völkerleben (Art. 2). In der Kulturpolitik widmete er sich dem Kampf gegen Schund und Schmutz und gegen den Alkoholismus. Wenn sich P. S. zum CSVD bekannte, lag er, obwohl der Christliche Volksdienst in den evangelischen Kreisen Württembergs viele Anhänger hatte, damit doch nicht auf der Normallinie des deutschen Protestantismus, der sich vorwiegend durch die Deutschnationale Volkspartei vertreten sah.127
P. S. erinnert an seine öffentliche Unterstützung von Hindenburg: Im Vorfeld der Wahlen des Reichspräsidenten, die am 13. März und am 10. April 1932 stattfanden (Ergebnis: 53,93 Prozent der Stimmen für Hindenburg, 36,68 Prozent für Hitler, 10,13 Prozent für Thälmann128), nahm P. S. mehrfach öffentlich für Hindenburg Stellung, was ganz auf der Linie des CSVD lag. Das tat er wohl auch, um seinen Gemeinden ein Zeichen zu setzen gegen deren aufkommende Begeisterung für die NSDAP. In Dornholzhausen stimmten nämlich im ersten Wahlgang der Reichspräsidentenwahl 68,5 Prozent (!) für Hitler, nur 28,3 Prozent für Hindenburg. Spektakulär war Schneiders Stellungnahme, als er vor der Wahl zusammen mit einem gegenüber wohnenden Lehrer ein Transparent vom Pfarrhaus zu dessen Haus über die Straße spannte mit der Aufschrift: »Wählt unseren Besten!« Jeder im Ort wusste, wen der Pfarrer meinte.
Über diese Wahlwerbung des Pfarrers beschwerte sich der Stützpunktleiter der NSDAP beim zuständigen Superintendenten Wieber.129 P. S. verteidigte seine Meinungsäußerung für Hindenburg, die er vor allem als eine Auseinandersetzung mit der NSDAP verstand. Er kritisierte die »heidnisch-völkischen Stimmungen« in der NSDAP und nannte in diesem Zusammenhang Alfred Rosenberg, den Verfasser des »Mythus des 20. Jahrhunderts«130. Er monierte »die unchristliche Haltung der Bewegung gegen Altes Testament und Juden«.
M. S. und P. S. pflegten mit aller Selbstverständlichkeit freundschaftlichen Kontakt mit Juden in Hochelheim. Am Sabbat erledigten P. S. oder Familienglieder für die jüdische Nachbarswitwe, Franziska Jordan, die notwendigsten Hausarbeiten, die Juden am Sabbat nicht verrichten dürfen. P. S. hatte sogar einer Jüdin auf deren Bitte hin ihr hebräisches Gebetbuch ins Deutsche übersetzt.131
Die Stellungnahme P. S.s zur Wahl zeigt, dass er immer weniger die strikte Trennung zwischen Kirche und Politik vertrat, die für viele Evangelische aus Luthers Lehre folgte.
Der Superintendent von Wetzlar gab dem Stützpunktleiter die Auskunft, er sehe keinen Anlass zu einem dienstlichen Vorgehen gegen Pfarrer Schneider. In einem Brief an P. S. kritisierte er jedoch, dass »Sie sich in die politische Wahlagitation tiefer eingelassen haben, als es der Stellung des Geistlichen dienlich ist.«132
Inwiefern war P. S. »mit Hindenburgs neuesten Taten nicht ganz einverstanden«? Wahrscheinlich gefiel es ihm nicht, wie viel Raum Hindenburg den Nationalsozialisten gab in der Meinung, er könne sie zügeln, indem er sie in die Regierungsverantwortung einbinde.
Ganz im Sinne des CSVD fährt P. S. im Rundbuch fort mit der Klage:
»O des unseligen Parteigeistes! 133 der sich so versündigt am Volksganzen von hüben und drüben. Wo sind die gerecht urteilenden christlichen Gewissen, die weder vom Nationalismus noch vom Sozialismus, sondern vom Evangelium her die Maßstäbe für ihr politisches Handeln gewinnen? Aus dieser Quelle bezieht sie aber der Nationalsozialismus auch noch nicht; wird er dann wirklich die beiden Pole vereinigen und unser Volk der sittlich-religiösen Erneuerung entgegenführen können, deren es so dringend bedarf?« – Im Februar 1933 schreibt er, an einer Lungen- und Rippenfellentzündung schwer daniederliegend: »Heute deutscher Abend mit deutschem Tanz. Ob das nun ein anderer Tanz ist als der gewöhnliche? Aber zu Lichtbildervorträgen, Bibelstunden lädt man das Gros der Leute vergeblich ein. Was sind unsere evangelischen Gemeinden? Und doch sind es Gottes Zeiten und hat Gott sein Werk irgendwie unter uns, daran gilt es festzuhalten und fröhlich vorwärts zu glauben.«
Ehe wir Paul Schneiders Weg in Hochelheim weiterverfolgen, wollen wir uns an die politischen Ereignisse in Deutschland am Vorabend des Dritten Reiches und im Jahr 1933 erinnern. In immer stärkerem Maß wurde Deutschland von der Weltwirtschaftskrise von 1929 betroffen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg von 2,8 Millionen im Jahr 1928 auf 6,3 Millionen im Jahr 1933.134 Von der staatlichen Arbeitslosenunterstützung konnten die wenigsten ihre Familie ernähren. Hitler versprach »Arbeit und Brot«, suchte in den Juden die Schuldigen und kündigte den gnadenlosen Kampf gegen das Judentum an. Immer mehr wurde Hitler zum »Führer« der Enttäuschten. So kann es nicht verwundern, dass seine Partei bei der Wahl des neuen Reichstags am 31. Juli 1932 von zwölf auf hundertsieben Mandate (!) zulegte. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Die NSDAP feierte das mit großen Aufmärschen als »nationalen Aufbruch«. Schon am 1. Februar erreichte Hitler, dass Reichspräsident von Hindenburg den Reichstag auflöste und seine Neuwahl auf den 5. März 1933 festsetzte.
Am 1. Februar versicherte Hitler in einem Aufruf, dass das Christentum »die Basis unserer gesamten Moral« sei. Er schloss seinen Aufruf mit den Worten: »Möge der allmächtige Gott unsere Arbeit in seine Gnade nehmen, unseren Willen recht gestalten, unsere Einsicht segnen und uns mit dem Vertrauen unseres Volkes beglücken.«135 Punkt 24 des Parteiprogramms der NSDAP lautete: »Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen. Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, dass eine dauernde Genesung unseres Volkes nur erfolgen kann von innen heraus auf der Grundlage: Gemeinnutz vor Eigennutz.«136
Bewusst wählte Hitler die christlich-nationale Tarnung, berief sich immer neu auf christliche Werte; SA137-Formationen marschierten geschlossen in Kirchen, es gab Massentrauungen von SA-Leuten. Gern stellte sich Hitler mit hohen Kirchenführern oder kaiserlichen Feldmarschällen zur Schau. Ein nationalistischer Trance-Zustand ergriff sehr viele Deutsche, in den auch viele Christen jedes Bildungsstandes verfielen. Es wuchs in den Protestanten die Genugtuung, Reichspräsident von Hindenburg habe gegen das Eindringen des atheistischen Bolschewismus eine christlich-konservative Regierung zustande gebracht. Nur wenige Christen sahen die Verbrechen, die von Anfang an Hitlers Machtergreifung begleiteten.
Einstweilen brachte Hitler den alten Reichspräsidenten von Hindenburg dazu, in einer ersten Notverordnung »Zum Schutz des deutschen Volkes« die Presse-, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit erheblich zu beschränken. Der Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933 gab Hermann Göring138 den Vorwand, in der Nacht zum 28. Februar mehr als viertausend kommunistische Funktionäre und Abgeordnete zu verhaften. Viele wurden gefoltert, zahlreiche ermordet. Die Kirchen schwiegen dazu. Schon am 28. Februar erfolgte – von langer Hand vorbereitet – die Zweite Notverordnung Hindenburgs, in deren Paragraf 1 es heißt: »Es sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des Rechts der freien Meinungsäußerung, einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe in das Brief-, Post-, Telegrafen- und Fernsprechgeheimnis, Anordnungen von Haussuchungen und von Beschlagnahmen sowie Beschränkung des Eigentums auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig.« Der Reichstagsbrand – wer immer ihn gelegt haben mag – war für die Nationalsozialisten die große Gelegenheit, die individuellen Freiheitsrechte der Bürger deutlich einzuschränken.
Bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933 erhielten die Nationalsozialisten 43 Prozent der Stimmen. Unmittelbar danach wurde die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) verboten. Nun hatte die NSDAP zusammen mit der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) und den bürgerlichen Parteien wie dem Zentrum die Zweidrittelmehrheit im Reichstag. Beim Festakt zur Eröffnung des Reichstages, am großen »Tag von Potsdam«, 21. März, in der Potsdamer Garnisonskirche am Grab Friedrichs des Großen vollzog der neue Reichskanzler zusammen mit dem greisen Feldmarschall von Hindenburg eine spektakuläre Inszenierung, mit der er sich als der legitime Erneuerer preußischer Tradition in Szene setzte. Kanonen schossen Salut, Glocken läuteten, das Glockenspiel der Garnisonskirche intonierte »Üb immer Treu und Redlichkeit«.
Auch die Abgeordneten des Zentrums, der DNVP und der kleineren Parteien stimmten in der ersten Sitzung des neugewählten Reichstages, am 23. März, für das Ermächtigungsgesetz, mit dem Hitler die alleinige Macht erhielt und das bald darauf die Auflösung oder das Verbot ihrer eigenen Parteien besiegelte. Lediglich die SPD stimmte dagegen.
Nun vollzog sich in atemberaubender Geschwindigkeit die »Gleichschaltung«: Am 21. März wurde das »Heimtückegesetz« beschlossen, das jeden bedrohte, der »vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, das Wohl des Reiches oder eines Landes oder das Ansehen der Reichsregierung oder einer Landesregierung oder der hinter diesen Regierungen stehenden Parteien oder Verbände schwer zu beschädigen.« Ein Gesetz, das künftig wie ein Damoklesschwert über jedem hing, der an Staat oder Partei Kritik übte. Reichskommissare oder Reichsstatthalter wurden in verschiedenen Ländern wie Bayern, Baden und Württemberg eingesetzt. Die Beamtenschaft wurde von nichtarischen139 oder regimekritischen Leuten gesäubert. Göring wurde preußischer Ministerpräsident. Studentenschaft, Universitäten, die Presse, alle Kulturtreibenden wurden gleichgeschaltet. Die SS (Schutzstaffel) und die Gestapo (Geheime Staatspolizei) wurden gegründet, die Gewerkschaften wurden aufgelöst. Mit dem Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 wurde das Volk auf den Antisemitismus140 der Nationalsozialisten eingeschworen. Bei der öffentlichen Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 wurde ein Zeichen des Terrors gegen missliebige Schriftsteller gesetzt. Auch hierzu schwiegen die Kirchen.
Hitler begann eine systematische Aufrüstungspolitik und tarnte sie mit pathetischen Friedensreden. Am 20. Juli 1933 gelang es ihm, mit der römisch-katholischen Kirche ein »Reichskonkordat«, d. h. eine vertragliche Sicherung der Rechte der Kirche, zu schließen, mit welcher Papst Pius XI. und sein Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., glaubten, die Freiheits- und Einflussrechte der katholischen Kirche im deutschen Reichsgebiet zu sichern. Sie erreichten damit vorerst vielmehr, dass die NS-kritischen deutschen Kardinäle ihre Kritik am Dritten Reich zurückstellten.
Am 14. Oktober trat Deutschland aus dem Völkerbund aus. Am 12. November ließ Hitler seine Politik durch eine Volksbefragung bestätigen. 96 Prozent der Wähler stimmten mit Ja. Im Reichstag saßen nun 639 Abgeordnete der NSDAP und 22 Gäste. Die Demokratie war gründlich beseitigt. Die Abgeordneten hatten nur noch die Regierungserklärungen anzuhören, die vorgelegten Gesetzesentwürfe einstimmig anzunehmen und am Schluss der kurzen Sitzung – als »teuerster Gesangverein der Welt« – »Deutschland, Deutschland, über alles« und das Horst-Wessel-Lied »Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen« zu singen.
Im Dorf zieht der Nationalsozialismus langsam ein, viele stehen noch abwartend, die neuen politischen Machthaber des Dorfes werden kritisch betrachtet. Ein Handwerker spricht aus: »Der einzige National-Sozialist ist hier der Pfarrer, und der ist keiner!«141 – Dass aber der 1. Mai 1933 das ganze Völkchen mit all ihren Gaben und Verschiedenheiten vereint und alles beim Feldgottesdienst142 und den Kundgebungen durchs Radio zugegen ist, das erfüllt Paul nun doch mit Freude. Er fängt an, dem »sozialen Wollen Hitlers Vertrauen zu schenken«. – »Wenn wir nur auch als Kirche den positiven Beitrag zum inneren Aufbau unseres Volkes leisten können, den wir ihm schuldig sind in unserer eigentlichen Amtsarbeit!« – Dass aber der Stützpunktleiter alle Augenblicke sich der Kirchenglocken zum nationalen Festläuten bemächtigen will, 143 den kirchlichen Jugendgruppen das Existenzrecht streitig macht, von den kirchlichen Körperschaften Reverse144, die er nur bedingt unterschreibt, gefordert werden, das und noch viel mehr erfüllte ihn immer wieder mit Misstrauen. – Den »deutschen Gruß« hat er nie über seine Lippen gebracht, er konnte die »fromme Auslegung« 145 desselben nicht leiden. – Den Arierparagrafen als solchen, und im Besonderen im Raum der Kirche, lehnte er ab.146 Nur mit allergrößtem Missbehagen stellte er von nun an die arischen Nachweise147 aus, die im Dritten Reich jedem Dorfpfarrer so viel Zeit nahmen. Es bedurfte manchen Zuredens, dass er nicht einfach ablehnte, sie auszustellen, und sie gingen manchmal mit Zusätzen ab, z. B. der »Arier« solle seine ersten Eltern148 nicht vergessen!
Um P. S.s Verhalten einordnen zu können, ist es nötig, an einige Vorgänge zu erinnern, die im Frühjahr und Sommer des Jahres 1933 die evangelische Kirche in Deutschland und im Rheinland erschüttert haben. Das gilt auch für Ereignisse, die nicht sofort und direkt in sein Leben eingriffen. Sie sind der Hintergrund, aus dem heraus bald auch die Entwicklung seiner persönlichen Haltung zu verstehen ist.
Der Ruf nach starken Kirchenführern, unter deren Einfluss die Kirche sich erneuern würde, wurde immer lauter. Ungeklärt blieb dabei zunächst die Frage, ob eine erneuerte Kirche dem Staat gegenüber ihre Unabhängigkeit behaupten oder ob sie eine nationalsozialistisch orientierte Kirche werden solle. Vielen verschieden denkenden Christen gemeinsam war der Wille – der ja auch P. S. stark bewegt hat –, als evangelische Kirche bei der sittlichen Erneuerung des Volkes mitzuwirken.
Immer zahlreicher wurden die Anhänger der Glaubensbewegung »Deutsche Christen« (DC). Hatte P. S. genügend Gelegenheit, ihre »Theologie« wirklich wahrzunehmen? Oder ließ er sich zunächst nur von ihrem volksmissionarischen Eifer beeindrucken? Es gab im Frühjahr viele Anhänger dieser Bewegung, die relativ wenig durchschauten, was die Wortführer der DC bewegte: der Eifer für ein den NS-Staat nachahmendes »Führerprinzip in der Kirche«; für ein »artgemäßes« Christentum; für die »Schöpfungsordnungen« Volk, Rasse, Blut und Boden; für eine »natürliche«, d. h. aus der Natur herkommende Gotteserkenntnis. Nicht alle, die zu dieser Bewegung stießen, verklärten wie ihre »Führer« »die Stunde« der Machtergreifung Hitlers, durch die Gott zum deutschen Volk spreche. Nicht alle propagierten jenen »heldischen Jesus«, der germanische Art gegen »jüdische Hinterlist« verkörpere. Die wenigsten erkannten, wie sich hier uralter theologischer Antijudaismus mit dem rassistischen Antisemitismus der Nationalsozialisten verband. Nicht alle wollten das Alte Testament als ein »Judenbuch« durch die germanischen Heldensagen ersetzen und das Neue Testament in einer Säuberungsaktion »entjuden«149. Nicht alle stimmten ein in die selbstgerechte Ethik der »Söhne des Lichtes«, die gegen die »Söhne der Finsternis«, Juden und Bolschewisten, kämpften. Viele, die damals zu den DC stießen, durchschauten deren unbiblische Irrlehren zunächst wenig. Sie wollten schlicht dazu beitragen, dass die Kirche Jesu Christi im Volk ihren großen Auftrag wahrnehme und dass das Evangelium von Jesus Christus den Menschen des deutschen Volkes auch im Dritten Reich nahegebracht werde. Einig waren sich die DC lediglich im Wunsch, eine deutsche, »germanische« Nationalkirche zu schaffen mit einem starken Reichsbischof an der Spitze. Und darin, dass der Königsberger Wehrkreispfarrer Ludwig Müller150, der als der »Vertrauensmann des Führers« galt, dieses Amt erhalten müsse.
Um einen deutsch-christlichen Reichsbischof Müller zu verhindern, wählten die deutschen Landeskirchen am 23. Mai 1933 mit großer Mehrheit den im deutschen Volk hoch angesehenen Friedrich von Bodelschwingh151 zum Reichsbischof. Gegen ihn setzte freilich sehr bald eine immer stärkere Kampagne der DC und der NSDAP ein.
In dieser Situation griff – alle Rechte der Kirche missachtend – der Staat ein. Der preußische Ministerpräsident Hermann Göring ernannte den Landgerichtsrat August Jäger152 zum Staatskommissar »für den Bereich sämtlicher Landeskirchen Preußens«. Dieser löste sofort alle gewählten kirchlichen Gremien auf und ernannte für die sieben Landeskirchen in Preußen Bevollmächtigte, für das Rheinland den DC-Führer Landrat Dr. Krummacher 153. Reichsbischof von Bodelschwingh trat nach diesen Gewaltmaßnahen von seinem Amt zurück.
Krummacher übernahm, mit der braunen SA-Uniform bekleidet, mit einem »Sieg Heil« auf den Führer und Absingen des Horst-Wessel-Liedes154 die Führung des Konsistoriums der Rheinischen Kirche in Koblenz. Nun seien die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen beendet, der Staat würde jetzt die Deutsche Evangelische Kirche neu aufbauen.155 Der rheinische Generalsuperintendent Stoltenhoff 156 meinte, den Eingriff des Staates rechtfertigen zu müssen. Viele Pfarrer folgten seinem Kurs der Anpassung, Widerstand sei zwecklos. In Massenveranstaltungen der DC erklärte Krummacher, der Eingriff des Staates sei aus Liebe zu Kirche und Volk geschehen. Er rief auf zum »Kampf für Kirche, Volk und Vaterland« und kündigte eine Säuberung der theologischen Lehrstühle der Universität Bonn an. Wer den Deutschen das Evangelium verkünden wolle, müsse »von ganzem Herzen Nationalsozialist sein«.157 Protest von Pfarrern gegen den staatlichen Eingriff sei »Verrat an der Kirche« und werde mit Dienstentlassung und Streichung der Pensionsbezüge geahndet.158 Tatsächlich ließ er einzelne Pfarrer, die aufbegehrten, verhaften und beurlauben.
Lang dauerte das Regime des Staatskommissars und seiner Helfer nicht. Der Protest verschiedener Landeskirchen war zu stark. Am 14. Juli wurde das Staatskommissariat Jägers und damit auch die Herrschaft Dr. Krummachers im Rheinland beendet. Aber es wurden – wieder gegen alles geltende Recht – vom Staat für den 23. Juli Kirchenwahlen angesetzt. Diese kurze Frist war »eine abenteuerliche Zumutung«159. Sie ließ den DC-kritischen Kräften keine Zeit, sich gegen die gut organisierte Glaubensbewegung DC zu formieren. In aller Eile versuchten ihre Gegner Wahllisten unter der Bezeichnung »Evangelium und Kirche« aufzustellen. In den allermeisten ländlichen Gemeinden – auch in Hochelheim – wurden freilich »Einheitslisten« aufgestellt, in denen die Kandidaten sich nicht kirchenpolitisch offenbaren mussten.
Dr. Joachim Beckmann160 lud für den 17. Juli zur Gründung einer »Rheinischen Pfarrbruderschaft« ein, die sich verpflichte, »Angriffe auf den Bekenntnisstand der Kirche durch entschlossenes Bekennen abzuwehren und für die einzutreten, die um solchen Bekenntnisses willen bedrängt werden«. Dieser 17. Juli 1933 war sozusagen der Geburtstag der »Bekennenden Kirche« im Rheinland.
Den Wahlkampf konnte diese Gründung nicht mehr wirklich beeinflussen. Die NSDAP, die Reichspropagandaleitung, die Gauleiter unterstützten die DC mit allen Mitteln. Gemeindeglieder wagten nicht mehr, gegen die DC zu kandidieren, weil sie sonst als »Verräter am nationalsozialistischen Staat« bedroht worden wären. An vielen Orten wurde gegen opponierende Gemeindeglieder Terror ausgeübt. Die Presse, auch die kirchliche, hetzte gegen sie. Hitler selbst griff noch am Vorabend der Wahl in den Wahlkampf ein und gab mit bedrängenden Worten seiner Hoffnung Ausdruck, dass die DC und damit jene neuen Kräfte gewählt würden, »die unsere neue Volks- und Staatspolitik unterstützen«. Ergebnis der Wahl: Etwa achtzig Prozent der Sitze in den Presbyterien fielen an die DC.
Wie stand nun in diesen folgenreichen Wochen P. S. zur Glaubensbewegung DC? M. S. berichtet:
Mitte Juli 1933 ist eine Kundgebung der DC in Wetzlar mit einer Rede des Frankfurter Pfarrers Probst. Aus seiner Unruhe heraus, ob es nicht doch eine Stelle gäbe, bei der er guten Gewissens beim Aufbau mithelfen könnte, geht Paul hin. Er hört dort etwa das, was ihn über Gemeindeaufbau und -arbeit lange beschäftigt, und glaubt nun guten Willens, sich auch einreihen zu können.161 Es ist ihm aber »nicht so recht wohl dabei«, und er fürchtet, »der wirklich positive Flügel der DC (Deutsche Christen) könne sich doch nicht durchsetzen« (August 1933).
Zum »wirklich positiven Flügel« der DC zählte P. S. offenbar Christen, denen die Volksmission besonders am Herzen lag, die sich für eine sittliche Erneuerung des deutschen Volkes einsetzen wollten und die Kräfte dafür im Evangelium sahen; denen auch der diakonische Einsatz für die Armen im Volk wesentlich war. So verstand er z. B. den Frankfurter Pfarrer Georg Probst, der ein gemäßigter »Deutscher Christ« war, zugleich ein mitreißender Redner. Probst sah 1933 im Dritten Reich eine besondere »volksmissionarische Gelegenheit«.162
Auf einer Singwoche Ende August 1933 findet Paul bei Freunden Klärung und Befreiung. Und da er von Grund seines Herzens ein bußfertiger Christ war, so konnte es nicht fehlen, dass er alsbald vor seine Gemeinde trat und sagte, er wolle ein schlichter evangelischer Christ bleiben und sich hierbei das Vorzeichen »Deutsch« schenken, das verstünde sich von selbst. Von da an war seine Haltung eindeutig, sodass ein Freund bezeugen kann: »Niemand, den ich kenne oder dessen Geschichte mir zu Ohren gekommen ist, hat diesen Kampf unserer Kirche schlichter und einfältiger, zugleich lauterer und unerbittlicher geführt als mein Freund und Bruder Paul Schneider.«163
Friedrich Langensiepen164 beschreibt in seinen Erinnerungen165 diese Wende P. S.s so: »Auch im Jahre 1933 erschien Paul Schneider auf der Gödenrother Singwoche – als Deutscher Christ! Nicht kluge Politik der Gleichschaltung, sondern gutgläubiges Vertrauen auf die Phrase von der großen volksmissionarischen Stunde der Kirche hatte ihn zum Anschluss bewogen. Es war ihm aber schon selbst nicht mehr geheuer bei seinem Entschluss, denn er merkte, dass die Dinge einen weit anderen Kurs zu nehmen begannen und auf die Auflösung jeder kirchlichen Substanz hinzielten. Er hoffte, im Gespräch mit uns Klarheit und Wegweisung zu finden.« Ein Gespräch mit Langensiepens Frau Hildegard habe P. S. »von seinem gutgläubigen Irrtum« überzeugt. »Er war von Grund seines Herzens ein bußfertiger Christ … Paul Schneider war immer sofort bereit zuzugeben, dass er geirrt habe.«
Was folgte unmittelbar auf die Kirchenwahl des 23. Juli 1933? Kaum hatten die DC ihren famosen Sieg errungen, da erließen der Generalsuperintendent und das Konsistorium ein »Wort zum Frieden«. Aber einzelne Pfarrer warnten vor diesem »faulen Frieden. Mit Tyrannen wollen wir weder zusammen beten noch arbeiten. Ihr könnt uns vergewaltigen … Wir werden uns nicht beugen«, schrieb Pfarrer Friedrich Graeber166 aus Essen. »Ihr sagt Himmelreich und meint das Dritte Reich!«
Den DC freilich war es nach diesem Wahlausgang ein Leichtes, bei der Tagung der Rheinischen Provinzialsynode am 23./24. August 1933 in Koblenz ihre kirchenpolitischen Gegner auszuschalten. Sie setzten bei den Wahlen zum Provinzialkirchenrat vor allem ihre Scharfmacher durch. Landrat Dr. Krummacher ließ die Synode zum Abschluss mit erhobener Hand »Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen!« singen.
Auf der Generalsynode der Evangelischen Kirche der Altpreußischen Union in Berlin verfolgten die DC ihre radikale Linie weiter. Kritische Redner brüllten sie nieder, kommentierten ihre Kritik ungeniert mit dem Ruf »Konzentrationslager!«, sodass die Opposition geschlossen den Saal verließ und sich nicht mehr an den Abstimmungen beteiligte.
Wenige Tage danach, am 11. September, versammelte sich die Rheinische Pfarrbruderschaft und lehnte die von der Generalsynode verabschiedeten Gesetze ab: das Bischofsgesetz, das die Kirche dem »Führerprinzip« unterwerfe; das Beamtengesetz mit seiner unkritischen, »rückhaltlosen« Bejahung des NS-Staates, die Ausschließung der Judenchristen aus der Kirche. Sie beschloss, »geistlichen Widerstand zu leisten«, d. h. »gewaltlosen Widerstand des Wortes und der Liebe«, und ebenso »öffentliches Eintreten für die Betroffenen wie brüderliche Hilfe bei Notstand der Betroffenen«. Man wolle »bekennenden Protest« gegen das unevangelische und ungeistliche Kirchenregiment aussprechen, auch wenn man Gewalt leiden müsse.
Am 13. September rief Martin Niemöller167 zur Gründung eines Pfarrernotbundes auf, um die bösen Folgen der Generalsynode aufzuhalten. Am 21. September gründete Pastor Karl Immer168 den »Coetus [d. h. Zusammenschluss] reformierter Prediger Deutschlands«, um mit ihm »für die uneingeschränkte und unvermischte Geltung des Wortes Gottes zu kämpfen und zu leiden« und nicht durch Stillschweigen am Ungehorsam der Kirche mitschuldig zu werden. Das Bischofsgesetz bedeute »die Aufrichtung eines säkularen Papsttums« in der Kirche. Nach der Heiligen Schrift und dem reformierten Bekenntnis sei die Überordnung eines Bischofsamtes über andere kirchliche Ämter nicht möglich. Leitungsorgan der Gemeinde sei allein das Presbyterium.
Unbeeindruckt von der Formierung des Protestes berief am 5. Oktober 1933 der Kirchensenat den 38-jährigen DC-Führer Pfarrer Dr. Heinrich Oberheid169 zum Bischof im neu ausgerufenen »Bistum Köln-Aachen«170. Oberheid hatte in jungen Jahren eine erstaunliche Karriere bei der Firma Stinnes gemacht, hatte danach im Jahr 1933 sein abgebrochenes Theologiestudium beendet. Direkt nach dem Examen wurde er Bischof! Der Generalsuperintendent von Koblenz, Ernst Stoltenhoff, begrüßte ihn bei seiner Einführung mit dem Paulus-Wort: »Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus.«171 Er versprach, dass die Männer des Konsistoriums »mit Herz und Hand zu ihm stünden«.
In einem Grußwort an die Gemeinden wies der neue Bischof darauf hin, dass die Kirche ihre gegenwärtige Erneuerung Adolf Hitler und der nationalsozialistischen Bewegung zu verdanken habe. »Der lebendige Gott hat uns den Führer gegeben. Dafür sei ihm Lob, Preis und Dank in der Gemeinde.«
Eine Welle von Sympathie kam ihm entgegen. Aber auch Protest. So von Pfarrern um Joachim Beckmann: Die Deutsche Evangelische Kirche sei eine Unkirche geworden. In ihr gälte nicht das Bekenntnis zu Jesus Christus, vielmehr gälten die bekenntniswidrigen Prinzipien Führerprinzip, Machtprinzip, Arierprinzip. Darum müsse geistlicher Widerstand geleistet werden. Die Leitung der opponierenden Pfarrbruderschaft übernahmen die Pfarrer D. Paul Humburg172, Dr. Joachim Beckmann und Heinrich Held173. Bald zählte die Bruderschaft im Rheinland dreihundertfünfzig Mitglieder.
Bischof Oberheid reiste nun im Land umher zu synodalen Pfarrkonferenzen. Um kritische Pfarrer zu gewinnen, kündigte er an, das Bischofsamt »Landespfarramt« zu nennen. Dennoch wurde er mit viel Protest empfangen. Etwa in Düsseldorf, wo Beckmann eine scharfe Anklage gegen die DC verlas: Sie hätte die Macht in der Kirche mit brutalem Einsatz weltlicher Mittel, durch politische Verleumdung ihrer Gegner, durch üble Verdächtigung, durch den Missbrauch der NSDAP errungen. In Bonn erklärten Pfarrer dem Bischof Oberheid, die Ariergesetzgebung und das Führerprinzip seien mit dem innersten Wesen der Kirche nicht vereinbar. Wer eine »völkische« Kirche bauen wolle, verrate die evangelische Kirche an die neuheidnische »Deutsche Glaubensbewegung« und an das Schwärmertum.
Was erlebte in diesem Herbst 1933 P. S. in Hochelheim? M. S. berichtet:
Die letzten Monate in Hochelheim. Über die Vorgänge der letzten Monate lasse ich Paul aus seinen Briefen an meine Mutter selbst reden. »Am 8. Oktober, in Dornholzhausen schon 8 Tage früher, hatte ich von der Kanzel und im kirchlichen Bekanntmachungskasten gegen den Aufruf von Röhm gegen das ›Muckertum‹ protestiert.174 Ich wurde natürlich, wie ich das vorausgeahnt hatte, angezeigt. Um mich vor einer Verhaftung zu schützen, beurlaubte mich das Konsistorium schnellstens. Wir waren gerade fröhlich beim Singkreis in Dorlar, als der Herr Superintendent mit dem Auto vorfuhr. Am nächsten Tage wurde ich nach Koblenz befohlen, vor einen Konsistorialrat und unseren neuen Bischof, Dr. Heinrich Oberheid (ein führender deutscher Christ). Ich musste mich unterrichten lassen, dass der Röhmsche Aufruf in der Hauptsache sich gegen das unberechtigte Vorgehen von SA- und SS-Leuten175 gegen dritte Personen gerichtet habe und dass ich in einer geführten Kirche als Einzelner nicht eine so wichtige Sache vom Zaune brechen dürfe … Ich ließ mich bestimmen, soll ich sagen, verleiten?, meinen Protest öffentlich zurückzunehmen.
Die Kreisleitung gab sich aber noch nicht zufrieden, sondern dort war ich schon seit Langem angeschwärzt als politisch unzuverlässig176, und Stützpunktleiter und Kreisleitung waren sich offenbar dahin einig geworden, dass ich mindestens versetzt werden solle. Durch den Widerstand von Wetzlar konnte das Konsistorium die Beurlaubung nicht aufheben. Ich willigte ohne weitere Beweisgründe natürlich nicht in eine solche Versetzung. Es kamen zwei Vertreter des Konsistoriums; sie waren zuerst bei mir und dann bei den Stützpunktleitern. Inzwischen war eine erhebliche Unruhe und Auflehnung gegen die Stützpunktleiter in beiden Gemeinden wach geworden … So waren diese schließlich froh, wieder einlenken zu können. Ich habe am letzten Sonntag wieder gepredigt über Römer 1,16«177 (Brief vom 26. Oktober 1933). – »Ich glaube nicht, dass unsere evangelische Kirche um eine Auseinandersetzung mit dem NS-Staat herumkommen wird, dass es nicht einmal geraten ist, sie noch länger aufzuschieben, bei allem schuldigen christlichen Gehorsam« (Brief vom 29. Januar 1934). – Die Stützpunktleiter rühmten sich nachher, dass sie des Pfarrers Schicksal in der Hand gehabt hätten. Paul gab dagegen bekannt, nur das Vertrauen der Gemeinde hätte ihn in Hochelheim gehalten. Er fühle sich frei von einer Bindung.
Da die Auseinandersetzung um Röhms Aufruf gegen das »Muckertum« der erste größere Konflikt mit den 1933 zur Herrschaft gekommenen Gewalten ist, da in diesem Zusammenhang auch zum ersten Mal geäußert wird, Pfarrer Schneider gehöre in ein Konzentrationslager, schildere ich hier – den bei Wentorf 178 veröffentlichten Dokumenten folgend – die oben erwähnten Vorgänge näher:
Der Aufruf Röhms gegen das »Muckertum« liest sich zunächst wie eine Zurechtweisung an SA- und SS-Führer, Frauen gegenüber keine spießigen Forderungen aufzustellen, wie z. B. dass sie in Lokalen nicht rauchen dürften. Ihm lägen Meldungen vor, »dass auch SA- und SS-Führer und -Männer sich öffentlich zu Moralrichtern aufwürfen und weibliche Personen in Badeanstalten, Gaststätten oder auch auf der Straße belästigt hätten«. Es müsse einmal eindeutig festgestellt werden, »dass die deutsche Revolution nicht von Spießern, Muckern und Sittlichkeitsaposteln gewonnen worden sei, sondern von revolutionären Kämpfern«. Diese allein würden sie auch sichern. Es gehe darum, Deutschland durch eine »freie und revolutionäre Kampfgesinnung hochzureißen«. Ein SA-Mann dürfe sich nicht »zum Handlanger verschrobener Moralästheten hergeben«.
Wen wollte Röhm mit diesem Aufruf treffen? Einzelne SA-Führer? P. S. verstand den Aufruf als eine Verächtlichmachung christlicher Moralbegriffe. Röhm versuche in ihm, diejenigen, die sich nicht an »NS-Kämpfern« orientierten, der Lächerlichkeit preiszugeben. P. S. erwartete einen Protest der offiziellen Kirche. Als ein solcher nicht kam, verlas er bei den Abkündigungen im Gottesdienst seinen eigenen und gab ihn im Aushängekasten der Kirchengemeinde am Pfarrhaus der Bevölkerung zu lesen. Er stellt fest, Röhm spreche sich »gegen die Geltung von sittlichen Grundsätzen und gegen das Eintreten dafür in unserem Volksleben in einer Weise aus, dass man vom Standpunkt evangelischen Glaubens nur aufs Schärfste gegen Geist und Inhalt dieses Aufrufs protestieren« könne. Er folgert: »Wenn Stabschef Röhm meint, dass der Aufbau unseres Volkes und die Aufgabe der SA nichts mit Sittlichkeit und Keuschheit zu tun habe, und wenn er von diesen Dingen als von ›verschrobenen Moralstützen‹ spricht, so irrt er und hat mit diesem Aufruf unserem Volk einen schlechten Dienst geleistet.«
Als der NSDAP-Stützpunktleiter Johannes Mehl von diesem Aufruf hörte, ließ er P. S. bitten, ihm diesen auszuhändigen. Als der Pfarrer das verweigerte, ließ er den ganzen Kasten von der Wand abmontieren, um zu Hause die Stellungnahme aus ihm zu entfernen und den leeren Kasten dem Pfarrer zurückzuschicken. Mehl forderte P. S. schriftlich auf: »Für die Zukunft bitte ich Sie, Schriftstücke politischer Art vor der Veröffentlichung mir vorzulegen.«
Mehl benachrichtigte die NSDAP-Kreisleitung Wetzlar über den Vorgang, diese informierte das Landratsamt (was nicht nötig gewesen wäre, denn Kreisleiter Grillo war zugleich Landrat). Der Vertreter des Landratsamtes teilte dem Konsistorium in Koblenz mit, die NSDAP verlange, Pfarrer Schneider sofort in Schutzhaft zu nehmen, um ihn vor der empörten Öffentlichkeit zu schützen. Um nicht die Autorität des Pfarrers vor seiner Gemeinde durch eine Verhaftung zu beschädigen, möge das Konsistorium ihn bis zur Aufklärung der Sache beurlauben. In einem zweiten Anruf am selben Tag erklärte der Vertreter des Landratsamtes, wenn das Konsistorium nicht sogleich die Beurlaubung verfüge, sei Schutzhaft nicht zu vermeiden. Daraufhin beauftragte Oberkonsistorialrat Siebert Superintendent Wieber, sofort P. S. aufzusuchen, ihm die Beurlaubung auszusprechen und ihn zu einer Aussprache in das Konsistorium zu bestellen.
Einstweilen schrieb die Kreisleitung Wetzlar an den Landrat: »Ich bitte Sie, den Landjäger aufmerksam zu machen, dass er sofort diesen Kasten für alle Zukunft verbietet, und dass Sie Pfarrer Schneider in Schutzhaft nehmen. Dieser Mensch gehört in ein Konzentrationslager und nicht auf die Kanzel.« Die Kreisleitung Wetzlar hat zugleich die Gauleitung in Frankfurt/Main schriftlich über diesen Vorgang informiert.
Was das Gespräch des neuen Bischofs Dr. Heinrich Oberheid – er war drei Tage zuvor in das neu errichtete »Evangelische Bistum Köln-Aachen« eingeführt worden – mit P. S. betrifft, so berichtete M. S., ihr Mann sei danach äußerst deprimiert nach Hause gekommen. Oberheid, in SA-Uniform auf dem Schreibtisch sitzend, Zigarette rauchend, habe es durch sein Auftreten verstanden, dem kleinen Landpfarrer deutlich zu machen, dass er mit seinem Angriff auf Röhm sich und die Kirche blamiert habe. Dem Landrat und Kreisleiter der NSDAP, den er mit »Euer Hochwohlgeboren« anspricht, berichtet Oberheid noch am selben Tag über dieses Gespräch: »Ich habe ihm sein Vorgehen ernst verwiesen.« P. S. habe sich seinen Vorhaltungen bereitwillig geöffnet. Er habe folgende Erklärung unterschrieben: »Nachdem ich mich durch meine vorgesetzte Kirchenbehörde habe unterrichten lassen, dass Sinn und Abzweckung des Aufrufes des Herrn Stabschef Röhm an die SA und SS gegen das Muckertum anderer Art gewesen ist, als ich es in meinem Protest vom 8. ds. Mts. glaubte annehmen zu sollen, bedauere ich, dass ich diesen Protest gefasst habe, und nehme ihn hiermit zurück.« Er, Oberheid, sei »der Zuversicht, dass Pfarrer Schneider hinfort die richtige Einstellung zu den Maßnahmen des Staates und der Partei finden wird«, er bitte, »deshalb von weiteren Erwägungen über die Verhängung der Schutzhaft absehen zu wollen«. Dann könne er auch die Beurlaubung rückgängig machen.
Schon am nächsten Tag antwortete der Landrat dem Bischof, er hielte es nicht für angängig, wenn die Beurlaubung zurückgezogen werde, ehe die Angelegenheit völlig geklärt sei. Schneiders Verhältnis zu den beiden Stützpunktleitern seiner Gemeinde sei zu gespannt. »Herr Pfarrer Schneider hat durch seine Haltung den Eindruck erweckt, als ob er nicht voll auf dem Boden des heutigen Staates steht. Es liegen über ihn eine ganze Reihe von Eingaben bei der Kreisleitung der NSDAP vor.« Der Bischof solle vor Ort klären lassen, ob P. S. in der Gemeinde bleiben könne. Er gibt dem Bischof zu bedenken: »Ich persönlich glaube kaum, dass sich die Angelegenheit anders erledigen lässt als durch die Versetzung des Pfarrers Schneider … Die ausgesprochene Beurlaubung kann m. E. nicht zurückgenommen werden.« Erstaunlich, wie ungeniert der Landrat dem neuen Bischof sagt, was die Kirche gegen P. S. zu tun habe.
Getreu dem Rat des Landrats sandte das Konsistorium zwei Beauftragte, Konsistorialrat Dr. Jung179 und Pfarrer Wolfrum180, nach Hochelheim und Dornholzhausen, die erkunden sollten, ob P. S. in seinen Gemeinden noch den nötigen Rückhalt habe. Die beiden gingen freilich zuerst zum Landrat nach Wetzlar und ließen sich von ihm und vom stellvertetenden Gauleiter der NSDAP sagen, dass Schneider wegen der Erregung der beiden Stützpunktleiter versetzt werden müsse. Sie sprachen daraufhin in Hochelheim mit P. S. Davon berichtet Dr. Jung:181 »Pfarrer Schneider bestritt, dem nationalen Staat ablehnend gegenüberzustehen.« Seinen Austritt aus der Glaubensbewegung Deutsche Christen habe er deswegen der Gemeinde mitgeteilt, weil er ihr bei einer vorherigen Gemeindeversammlung seinen Eintritt mitgeteilt habe. Er halte sich für verpflichtet, »die Gemeinde von seiner kirchenpolitischen Stellung in Kenntnis zu setzen«. Die Presbyter und Gemeindeverordneten von Dornholzhausen hätten einstimmig eine Vertrauenskundgebung für ihren Pfarrer beschlossen. Auch in Hochelheim hätte eine solche Kundgebung beschlossen werden sollen, doch habe der Lehrer die Leute gewarnt, sie könnten sich damit Ungelegenheiten bereiten. Daher sei sie in Hochelheim unterblieben.
Pfarrer Schneider habe ferner berichtet, Stützpunktleiter Mehl in Hochelheim habe öffentlich angeschlagen und mit der Ortsschelle182 bekanntgeben lassen, wer etwas gegen ihn, den Stützpunktleiter, sage, der werde einer strengen Bestrafung zugeführt werden. Der Polizeidiener habe an diese Bekanntgabe die Bemerkung geknüpft: »Jetzt bringen wir ihn weg«. Zu einem Gespräch mit dem Presbyterium in Hochelheim hätten nur zwei Presbyter kommen können. Diese hätten sich entschieden für Pfarrer Schneider und sein Verbleiben in der Gemeinde ausgesprochen. Sie hätten gesagt, die übrigen Presbyter seien der gleichen Auffassung. Dr. Jung fasst als Gesamteindruck von Pfarrer Schneider zusammen: »… dass er ein etwas eigensinniger und eigenwilliger Mensch ist, der nicht leicht von seinen Ansichten abzubringen ist und infolgedessen auch für die Zukunft noch Anlass zu Schwierigkeiten geben wird. Er sieht jedoch ein, dass er in vielen Fällen zumindest unklug gehandelt hat, und sagte zu, sich hinsichtlich der Politik fortan völlig zurückzuhalten. Er ist bereit, sich aus Hochelheim versetzen zu lassen, bat jedoch, eine solche Maßnahme zu verschieben, um nicht mit dem Makel mangelhafter nationaler Gesinnung behaftet zu scheiden.«
Pfarrer Wolfrum, der auch Mitglied der NSDAP war, berichtet183 von seinem Gespräch mit den beiden NSDAP-Stützpunktleitern von Hochelheim und Dornholzhausen, zunächst hätten sie behauptet, Pfarrer Schneider sei für sie untragbar, eine seelsorgerliche Tätigkeit des Pfarrers in Hochelheim käme nicht mehr infrage. Seine Nachfrage habe aber ergeben, dass beide, was den Charakter des Pfarrers betreffe, keine gewichtigen Einwände hätten. Er handle oft im Übereifer, mische sich in persönliche Angelegenheiten, mache da mehr schlecht als gut, vor allem aber: Er habe noch nicht das notwendige Verhältnis zur NSDAP. Die beiden Stützpunktleiter hätten schließlich erklärt, sie seien damit einverstanden, dass der Pfarrer im Amt und in Hochelheim tätig bleibe. Aber er müsse beim nächsten Gemeindeabend seine Bereitwilligkeit zur loyalen Mitarbeit mit den örtlichen Führern der NSDAP erklären. Er solle künftig im Anschluss an die Predigt alle Bemerkungen zu politischen Vorgängen unterlassen, solle sich auch der persönlichen Einmischung in örtliche Verhältnisse und Streitigkeiten enthalten. Andererseits habe der Stützpunktleiter versprochen, die Hitlerjugend zum Besuch des Gottesdienstes und der kirchlichen Veranstaltungen anzuhalten(!). »Er werde es auch begrüßen, wenn der Pfarrer der Hitlerjugend durch Vorträge und dergleichen dienen würde.« Wolfrum folgert: »Es ist meine Überzeugung, dass bei einigermaßen gutem Willen ein wirklich gedeihliches Zusammenarbeiten mit der Gemeinde möglich sei; wenn Pfr. Schneider die gebotene Zurückhaltung bewahren wird, dürfte der Fall erledigt sein. Der Urlaub des Pfr. Schneider kann somit sofort aufgehoben werden.
P. S. hat in einem Brief an den Stützpunktleiter Johannes Mehl184 Verständnis gezeigt für Mehls Handlungen den kirchlichen Bekanntmachungskasten betreffend. Er möge aber bedenken, dass sein, Schneiders, Protest gegen den Röhmschen Aufruf für ihn Gewissenssache gewesen sei. »Es ist nach Luther nicht geraten, etwas gegen sein Gewissen zu tun oder zu unterlassen.« Dem gegenwärtigen Staat gegenüber sei er loyal eingestellt. Gern wäre er ihm, wenn ihm Gelegenheit gegeben würde, noch mehr in positiver Mitarbeit verbunden. P. S. kommt auf das Verhältnis zwischen Hitlerjugend und kirchlicher Jugendarbeit zu sprechen und schreibt: »Ich würde mich von Herzen freuen über eine gelegentliche Einladung zu einem Abend mit der Hitlerjugend …, wo wir Lebensfragen besprechen, Lieder aus der Singbewegung singen könnten, wie sie ja z. T. schon in der Hitlerjugend eingeführt sind, wo wir Gottes Wort jugendgemäß zu uns reden lassen können, aber auch harmlos-fröhlich in christlicher Atmosphäre Geselligkeit pflegen können … Selbstverständlich würde ich mich dann jedes Werbens für unsere kirchliche Gruppe enthalten, sondern ganz der Hitlerjugend zu dienen suchen. So können Sie an Ihrem Teil zum Frieden helfen und würde die jetzt bestehende unfreundliche Spannung und die drohende Entfremdung von Jugend und Kirche vermieden.«
Liest man diesen freundlich-versöhnlichen Brief, so spürt man, dass es P. S. um den Frieden im Ort zu tun war. Er erhielt auf diesen Brief allerdings nie eine Antwort.
Nach dem Abschluss der Untersuchungen fasste das Konsistorium in Koblenz den Beschluss, »die Beurlaubung des Pfarrers Schneider in Hochelheim aufzuheben und zu gegebener Zeit ihn in ein anderes Pfarramt zu versetzen«.185 Dem Landrat in Wetzlar teilte das Konsistorium die Aufhebung der Beurlaubung mit.186 Das Konsistorium gebe sich »der Erwartung hin, dass er gemäß seiner Zusage alles vermeiden wird, was als mangelhafte Übereinstimmung zu den neuen Staatsgewalten angesehen werden könnte«. Vertraulich lässt das Konsistorium durchblicken, »Pfarrer Schneider mit Rücksicht auf kirchliche Erfordernisse später zu gegebener Zeit in ein anderes Pfarramt zu versetzen«.
Konsistorialrat Dr. Jung teilte P. S. am 21. Oktober mit, 187 seine Beurlaubung sei mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Er verbindet mit dieser Mitteilung scharfe Mahnungen: »Wir benutzen diesen Anlass, um Ihnen aufs Neue einzuschärfen, dass Sie eine völlige Zurückhaltung auf staatspolitischem Gebiet zu üben haben und jede unüberlegte Handlung, die auch nur entfernt Anlass zu Missverständnissen oder Verdächtigungen geben könnte, unterlassen werden muss.« P. S. möge die loyale Zusammenarbeit mit den örtlichen Führern der NSDAP pflegen und »Rücksicht auf die Erfordernisse der Gegenwart nehmen. Es muss von Ihnen wie von einem jeden Geistlichen erwartet werden, dass Sie dem heutigen Staat in ehrlicher Mitarbeit dienen und in einer den gegebenen Verhältnissen entsprechenden Weise ein gedeihliches Zusammenarbeiten mit allen Gliedern Ihrer Gemeinde zur Pflicht machen. Wir werden darüber wachen, dass Sie Ihr künftiges Verhalten dementsprechend einrichten, und vertrauen darauf, dass auch ohne weitere Maßnahmen unsererseits Sie Ihrer Zusage entsprechend alles vermeiden, was als mangelnde Zustimmung zu den neuen Staatsgewalten angesehen [werden] und erneut zu Schwierigkeiten führen könnte.«
Was tat sich einstweilen in der kirchenpolitischen Großwetterlage in Deutschland? Wir berichten davon, weil die gereizte Stimmung in Kirche und Gesellschaft und die Nervosität im Konsistorium, auf die P. S. im Januar 1934 traf, nicht ohne diese Ereignisse zu verstehen sind.
Am 13. November 1933 fand im Berliner Sportpalast eine Massenversammlung der DC statt, in der vor etwa zwanzigtausend Menschen und fast der gesamten von den DC bestimten preußischen Kirchenleitung der Berliner DC-Gauobmann Dr. Krause188 ein völkisches »Christentum« verkündete, das mit der biblischen Christusbotschaft fast nichts mehr zu tun hatte. Gott habe »durch die Kraft unseres Führers« die Deutschen ein Volk werden lassen. Nun wolle er die eine völkische, nationalsozialistische Kirche, die das Alte Testament mit seinen Viehtreiber- und Zuhältergeschichten beseitige und das Neue Testament reinige von allem Jüdischen. Seine »Bekenntnisse« gipfelten in dem Satz: »Unsere Religion ist die Ehre der Nation im Sinne eines kämpfenden heldischen Christentums.«
Die Folge war ein Orkan der Empörung gegen die DC. Die Pfarrbruderschaft verlas am Bußtag eine Erklärung gegen die »Verfälschung der Wahrheit« und erklärte, an eine Fortführung der Gespräche mit Landespfarrer Dr. Oberheid sei nicht zu denken. Von vielen Pfarrbruderschaften, u. a. auch von der des Hunsrück mit dem Superintendenten Ernst Gillmann189, wurde der Reichsbischof aufgefordert, die Schirmherrschaft über die DC niederzulegen und alle Mitglieder der Kirchenleitung, die den Reden des Dr. Krause ohne Protest zugehört hätten, zu entlassen. Vor allem die Absetzung des Bischofs Hossenfelder190 als Vizepräsident des preußischen Oberkirchenrats wurde gefordert. Sehr viele gemäßigte Deutsche Christen traten aus der Glaubensbewegung aus. Es war die Frage, ob die Glaubensbewegung in sich zusammenfallen würde. Um das zu verhindern, entließ der Reichsbischof den DC-Gauobmann Dr. Krause aus allen kirchlichen Ämtern. Er legte die Schirmherrschaft über die DC nieder und setzte auch das Beamtengesetz mit dem Arierparagrafen außer Kraft.
Die Stellung des Reichsbischofs wurde immer unsicherer. Um sie durch den Staat zu festigen, machte er – ohne Rücksprache mit den deutschen Bischöfen und gegen den ausdrücklichen Willen der Leitung der evangelischen Jugendverbände – dem Führer Adolf Hitler ein besonderes Geschenk: Er unterzeichnete am 19. November den sogenannten Jugendvertrag, mit dem er die Eingliederung der evangelischen Verbandsjugend unter 18 Jahren in die Hitlerjugend anordnete.
Nur die DC bejubelten diese Tat und gaben sich der Illusion hin, nun könnten die evangelischen Jugendlichen erst richtig in der Hitler-Jugend (HJ) volksmissionarisch tätig werden; die HJ-Führer würden nun den Kirchgang für Hitler-Jungen zur Pflicht machen. Die Bischöfe, hinter deren Rücken dieser Vertrag mit Reichsjugendführer Baldur von Schirach191 ausgehandelt worden war, äußerten Empörung. Der württembergische Landesbischof Theophil Wurm192 sprach von einem wahren Schurkenstreich. Die evangelischen Jugendverbände protestierten heftig. Der Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch193 telegrafierte an den Reichsbischof, er wolle über eine Jugend verfügen, die ihm nicht gehöre. Busch wurde aus seinem Amt suspendiert, dann aber auf Fürsprache einer Delegation mit Dr. Gustav Heinemann194 wieder in sein Amt eingesetzt.
Reichsbischof Müller holte Bischof Dr. Oberheid zu seiner Hilfe nach Berlin und machte ihn zum »Chef des Stabes«, d. h. er gab ihm alle Macht über die Kirchen. Oberheid beauftragte den Mülheimer Pfarrer D. Dr. Heinrich Forsthoff 195, einen DC-Mann, als »Stellvertretenden Landespfarrer« mit der Leitung der Rheinischen Kirche. Dr. Krummacher versuchte, die DC im Rheinland neu zu festigen, indem er sie in drei Obergaue einteilte und den Obergau Köln-Trier der Führung von Pfarrer Rudolf Wolfrum übergab. Dieser löste sich mit seinen Anhängern aber bald von der Landesleitung der DC, schlug einen radikal-völkischen Kurs ein und landete schließlich bei den »Thüringer Deutschen Christen«, denen er damit im Rheinland viel Einfluss verschaffte. Mit ihnen hatte es P. S. später auf dem Hunsrück zu tun. Die Häufung von DC-Massenveranstaltungen im Rheinland konnte es nicht hindern, dass die Glaubensbewegung DC zusehends zerfiel, während die BK sich formierte und in den Gemeinden an Boden gewann.
Was hat vor dem Hintergrund dieser »Großwetterlage« P. S. Anfang des Jahres 1934 in Hochelheim erlebt?
Anfang Januar wird Paul um eine Probepredigt in Monschau gebeten. Da ja Paul wegen »seines schriftgemäßen Verstandes der Abendmahlsfeier und der ernstzunehmenden Beichtfrage« im Konflikt mit seinem Hochelheimer Presbyterium stand, drängte das Konsistorium auf dessen Beschwerde hin auf Pauls Wegmeldung, aber noch fühlte er sich gebunden, und sein Weggehen wäre ihm als Fahnenflucht196 erschienen. So zieht er nach der Probepredigt seine Meldung zurück.
Aber die Dinge gestalteten sich immer schwieriger. Paul hatte eine Äußerung gegen den Goebbels’schen »Moralin«-Aufsatz, der durch alle Zeitungen gegangen war, gemacht, und gerade als er sich im Februar 1934 wegen der Abendmahlsbeschwerden vor dem Konsistorium zu verantworten hatte, lief ein Telefongespräch vom Landrat ein, das seine Beurlaubung deshalb forderte.
Der Aufsatz mit dem Titel »Mehr Moral, aber weniger Moralin«197, mit dem Josef Goebbels bewusst in die Kerbe schlug, die Ernst Röhm mit seinem Aufruf gegen das »Muckertum« geschlagen hatte, bezog sich wie jener zunächst darauf, dass engherzige, lebensfeindliche, zu kurz gekommene Nationalsozialisten, die im Grunde keine seien, »Sittenriecherei« verbreiteten. »Naturfremde Menschen, die entweder das Leben schon hinter sich haben oder nicht verdienen, dass sie noch eins vor sich haben, machen im Namen unserer Revolution in Moral. Diese Art von Moral hat oft mit wahrer Sittlichkeit nicht viel zu tun. Sie stellt ethische Gesetze auf, die vielleicht das Gemeinschaftsleben in einem Nonnenkloster zur Not regeln könnten, die aber in einem modernen Kulturstaat vollkommen verfehlt sind. Das ist Moralin statt Moral, und die dafür eintreten, sind von allen guten Geistern verlassen.«
Diese Sittenrichter würden am liebsten »in Stadt und Land Keuschheitskommissionen einsetzen, die die Aufgabe hätten, das Ehe- und Liebesleben von Müller und Schulze zu überwachen. Sie würden, wenn es nach ihnen ginge, das nationalsozialistische Deutschland in eine Einöde von Muff und Muckertum verwandeln, in der Denunziation, Bettschnüffelei und Erpressung an der Tagesordnung wären …« Seine Quintessenz: »Mehr Lebensbejahung und weniger Muckertum! Mehr Moral, aber weniger Moralin.«
Was Goebbels hier in seiner grob polemischen, auf die Zustimmung der Massen abzielenden Sprache schreibt, das könnte ein liberal denkender Mensch inhaltlich vermutlich bejahen. Aber P. S. spürte in diesem Aufsatz wie in Röhms Aufruf die sehr wohl berechnete Nebenwirkung: dass christliche Moral als lebensfeindliches »Muckertum« der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Wir wissen heute, wie sich später bei den nationalsozialistischen Siegern diese Art von »Moral« des »freien Herrenmenschen« ausgewirkt hat.
P. S., der eigentlich Grund gehabt hätte, sich zurückzuhalten, nahm nun auch gegen Josef Goebbels Stellung. Er tat es in seiner Predigt vom 28. Januar 1934 über Matthäus 8,23-27, in welcher er unter dem Titel »Die Sturmfahrt der Kirche Christi und Jesu Herrlichkeit« sich heftig auseinandersetzte sowohl mit den Irrlehren der DC wie mit dem nackten Heidentum der »Deutschen Glaubensbewegung« und Rosenberg, dem Verfasser des »Mythus des 20. Jahrhunderts«. In diesem Zusammenhang hieß es da: »Wir sagen es auch offen, dass wir uns als evangelische Christen nicht mit allen Äußerungen und Reden mancher führender Männer des neuen Deutschland einverstanden erklären können. Uns schiert nicht der Vorwurf des Muckertums, wir fragen auch nicht nach ›Moral und Moralin‹, aber wir haben Gottes klares Gebot wider Hurerei und Ehebruch, das uns Luther in unserem Katechismus auslegt: ›Wir sollen keusch und züchtig leben in Worten und Werken …‹«
Schon am Tag darauf informierte der NSDAP-Stützpunktleiter von Dornholzhausen die Kreisleitung der NSDAP über Schneiders Angriff gegen Goebbels. Und er gab ihr den Tipp, für den nächsten Tag sei Pfarrer Schneider zu seiner vorgesetzten Dienststelle in Koblenz vorgeladen. »Es wäre gut, wenn diese vor seinem Eintreffen schon über seine gestrige Hetzpredigt orientiert wäre.«
Dazu kam, dass Paul Ende Januar 1934 die Notbund-Erklärung gegen den Reichsbischof-Erlass vom 4. Januar 1934 nach seiner Predigt über »Die Sturmfahrt der Kirche Christi und Jesu Herrlichkeit« (Matthäus 8,23-27) verlesen hatte: »Obwohl ich im Allgemeinen nicht Kirchenpolitik oder Politik auf die Kanzel bringe, sprach ich in dieser Predigt recht scharf gegen die DC und wies auch auf die Gefahren hin, die vom Volksleben und dem Staat auch im Dritten Reich dem Schifflein der Kirche Jesu Christi drohen« (Brief vom 4. Februar 1934).
Auch das hat der Stützpunktleiter von Dornholzhausen dem Kreisleiter in Wetzlar geschrieben, dass Schneider nach seiner Predigt in kirchlichen Angelegenheiten gegen Reichsbischof Müller protestiert und gesagt habe, es seien schon einige Pfarrer da, die dagegen protestierten. Ihnen würde er sich anschließen. Der Stützpunktleiter fügt hinzu: »Zum Schluss gab er noch zu, dass er sich diese Äußerungen nicht erlauben dürfe, aber sein Gewissen würde ihm keine Ruhe lassen.«
Bei der Verordnung, gegen die P. S. am 28. Januar 1934 protestierte, handelte es sich um den sogenannten »Maulkorb-Erlass« des Reichsbischofs Ludwig Müller, der seit dem Sportpalastskandal immer heftigerer Kritik ausgesetzt war. In seiner Unsicherheit verfiel Müller auf die Idee, im Erlass vom 4. Januar 1934198 den Pfarrern zu verordnen: »Der Missbrauch des Gottesdienstes zum Zwecke kirchenpolitischer Auseinandersetzung, gleichviel in welcher Form, hat zu unterbleiben. Freigabe sowie Benutzung der Gotteshäuser und sonstigen Räume zu kirchenpolitischen Kundgebungen jeder Art wird untersagt. Kirchliche Amtsträger, die das Kirchenregiment oder dessen Maßnahmen öffentlich oder durch Verbreitung von Schriften, insbesondere durch Flugblätter oder Rundschreiben, angreifen, machen sich der Verletzung der ihnen obliegenden Amtspflichten schuldig.« Gegen sie »ist unter sofortiger vorläufiger Enthebung vom Amt unverzüglich das förmliche Disziplinarverfahren einzuleiten. Für die Dauer der vorläufigen Amtsenthebung ist vorbehaltlich weitergehender Bestimmungen der Disziplinargesetze das Einkommen um mindestens ein Drittel zu kürzen.«
Gegen diesen Erlass des Reichsbischofs verlas P. S. nach seiner Predigt über die Sturmfahrt der Kirche Jesu Christi die »Kanzelabkündigung der Bekennenden Kirche«199, die an diesem Sonntag von vielen Kanzeln verlesen wurde: »Wir erheben vor Gott und dieser christlichen Gemeinde Klage und Anklage dahin, dass der Reichsbischof mit seiner Verordnung ernstlich denen Gewalt androht, die um ihres Gewissens und der Gemeinde willen zu der gegenwärtigen Not der Kirche nicht schweigen können, und zum anderen bekenntniswidrige Gesetze von Neuem in Kraft setzt, die er selbst um der Befriedung der Kirche willen aufgehoben hatte. – Wir müssen uns auch dem Reichsbischof gegenüber nach dem Wort verhalten: ›Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!‹200«
Unverzüglich schrieb nun Kreisleiter und Landrat Grillo aus Wetzlar an das Ev. Konsistorium der Rheinprovinz in Koblenz im Blick auf P. S. u. a.: »… bitte ich dringend, seine sofortige Suspendierung aussprechen zu wollen, da ich mich andernfalls nach Lage der Verhältnisse gezwungen sehen würde, Pfarrer Schneider in Schutzhaft zu nehmen«.
Das in Aussicht gestellte Gespräch des Konsistoriums mit P. S. führte am 30. Januar 1934, dem Jahrestag der Machtergreifung Hitlers, in Koblenz Oberkonsistorialrat Euler201. Am nächsten Tag sandte P. S. die umstrittene Predigt vom 28. Januar über die »Sturmfahrt der Kirche Jesu Christi« an das Konsistorium in Koblenz. Er erklärte dabei:202 »Im Allgemeinen pflege ich kirchenpolitische oder politische Dinge nicht in die Predigt zu bringen. Ich glaube, dass es verkehrt war, den Namen des Herrn Dr. Goebbels zu nennen. Dass ich doch wieder trotz der vorausgegangenen Röhmsache zu einem ähnlichen Aufruf eines Ministers Stellung nahm, ist zu erklären aus der Sorge, wie solche Ausführungen auf ohnehin nicht moralfeste Nationalsozialisten, wie wir sie in führender und geführter Stelle in Hochelheim haben, wirken müssen. Es wurde mir von ernsthaften und älteren Kollegen nach dem Röhmaufruf erzählt, wie böse der sich auf das Sittlichkeitsgefühl der Großstadt (Frankfurt/Berlin) ausgewirkt habe. Da wollte es mir leid gewesen sein, meinen Protest unter der mir von meiner Behörde vorgestellten Begründung wieder zurückgenommen zu haben. Es war auch ein Rest von persönlicher Unaufrichtigkeit in meinem Herzen als Stachel zurückgeblieben, der sich nun auch auf diese Weise Luft machte. Immerhin bedauere ich es, den Aufsatz von Dr. Goebbels tragischer genommen zu haben, als er es verdient, und einen eigenwilligen oder ungerechten Weg in der Reaktion darauf eingeschlagen zu haben.« Er bestätigt, dass er »in den durch das Wohlwollen des Konsistoriums mir vorgeschlagenen Weg meiner Beurlaubung selber eingewilligt habe« und bittet, mit Landrat Grillo zu klären, ob seine Äußerungen denn wirklich eine Verhaftung begründen würden. Er bittet aber auch, an geeigneter Stelle darauf hinzuweisen, dass Pfarrer ernste Besorgnis hätten betreffend die Wirkung solcher »immerhin missverständlicher Aufrufe und Erlasse«. Sein Brief schließt: »Ich gebe zu, dass ich in meinen kirchenpolitischen Äußerungen zu allzu großer Schärfe mich habe fortreißen lassen vor der Gemeinde, und gebe meinem Bedauern darüber Ausdruck mit der Bitte um Entschuldigung.«
Trotz seiner zweiten Beurlaubung fühlte Paul sich um des Gemeindeteils willen, der treu hinter ihm stand, zum Bleiben verpflichtet. Aber am 19. Februar 1934 kommt das amtliche Schreiben mit seiner Versetzung nach Dickenschied. Sein Bleiben sei in Hochelheim nicht mehr möglich, besonders nicht von seiten der staatlichen Stellen. Bis zum Umzug, Ende April, sei kein Dienst mehr gestattet.
Mit Datum vom 15. Februar 1934 teilte das Konsistorium P. S. mit, 203 es habe dem Landrat geschrieben, dass er, P. S., sich bis auf Weiteres als beurlaubt zu betrachten hätte und sobald wie möglich in eine andere Pfarrstelle versetzt werden müsse. Es wird festgestellt, dass er in seiner Predigt »mehrere Leiter des heutigen Staates mit Nennung ihrer Namen einer scharfen Kritik unterzogen« habe. Die Sachbearbeiter hätten ihm seine Verfehlungen eindringlich vor Augen gehalten. Da er eine Bitte um Entschuldigung ausgesprochen habe, sehe das Konsistorium davon ab, disziplinarische Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen. »Indessen ist der Übergang in eine andere Pfarrstelle möglichst bald herbeizuführen.« Das Konsistorium habe für ihn die Pfarrstelle Dickenschied/Womrath in Aussicht genommen. Es werde dieses der Gemeinde mitteilen. »Wir fordern Sie auf, uns innerhalb einer Woche Ihre Bereitwilligkeit mitzuteilen, dass Sie diese Pfarrstelle übernehmen wollen.« Diese Bereitschaft hat P. S. dem Konsistorium mitgeteilt.204
Langensiepen schreibt hierzu in seinen »Erinnerungen«, S. 233f: »Er war drauf und dran, seiner Beurlaubung nicht nachzukommen: ›Auf eine Verhaftung will ich es dabei ankommen lassen.‹ Ein Brief von mir bewegte ihn doch endlich zum Nachgeben, da die Verhältnisse in der in Aussicht genommenen Gemeinde Dickenschied und in unserer Synode für ihn ungleich günstiger liegen würden als in Hochelheim. Es hat ihn aber Zeit seines Lebens bedrückt, dass er damals von seiner alten Gemeinde gewichen ist und den Kampf nicht ausgefochten hat. Dies erklärt manches an seinen Entschlüssen, die er später anlässlich seiner Ausweisung aus Dickenschied fasste.«
Das war eine schwere Probe für Paul, innerhalb der Gemeinde zu stehen und zu wohnen und doch Predigt und Unterricht anderen überlassen zu müssen. In einem Brief vom 1. März 1934 schreibt er an einen Freund: »Mein Hochelheimer Presbyterium stellte sich nicht hinter mich, und bei im Übrigen sehr vielen Sympathien in den Gemeinden sind nur sehr wenige da, die für ihren Pfarrer den Kopf hinhalten wollen.«
Eine Abordnung zweier gutgesinnter Männer musste sich auf dem Konsistorium belehren lassen, dass es für den Pfarrer das Allerbeste sei, er gehe. Paul hatte also keinen Auftrag mehr in Hochelheim.205 Er wäre sonst bereit gewesen, die Treue zu halten.
Er schied in Frieden; die, die ihm am meisten schadeten, können es bezeugen. Aber die Sorge um seine ersten Gemeinden ließ ihn nicht los, und so wurde ihm sein Weggang immer wieder zur Anfechtung.
Die Gemeinden erwirkten bei den politischen Leitern die Genehmigung, Abschiedsfeiern im Vereinshaus bzw. in der Turnhalle für den Pfarrer halten zu dürfen. Dabei kam dann Paul auch noch einmal zu Wort. Von der Feier im Filial Dornholzhausen erzählt eine Freundin: »Paul Schneider sah angegriffen und abgezehrt aus. Mächtiger noch als sonst wölbte sich der starke Schädel mit der gebuckelten Stirn vor, die Augen lagen tief in ihren Höhlen. Aber eine große Stille lag wie ein Glanz auf seinen Zügen. Wir machten uns schweigend in dieser abendlichen Stunde auf den Weg. Ein Auto überholte uns – eine Frau mit einem amputierten Bein ließ sich herbeifahren, um in dieser Stunde nicht zu fehlen. Mir gegenüber äußerte sie sich dahin, durch Pfarrer Schneiders Seelsorge sei in ihr bisher unstetes Leben Ruhe und Frieden eingekehrt. Da saßen nun in dem Saal die Menschen, Kopf an Kopf, mit stillen, in sich gekehrten Gesichtern. Der Mädchenchor begann mit Liedern, die sie bei ihrem Pfarrer gelernt hatten, die Frauen sagten Gedichte und brachten als Abschiedsgabe ein Bild ihres Kirchleins. Ein Presbyter trat vor und erklärte, lange habe er in der Hl. Schrift nach einem Trostwort für seinen Pfarrer gesucht, und nun wolle er ihm diesen Trostpsalm vorlesen. So begann er mit der eintönigen Stimme, wie es Landleute häufig tun, oft vor Bewegung stockend, zu lesen. – Dann erhob sich Paul Schneider und sprach zum letzten Mal zu der Gemeinde seiner Heimat. Nun gelte es, Abschied zu nehmen. Er bat seine Gemeinde, es seinem Nachfolger nicht schwer zu machen, jeder habe nun einmal eine andere Art. – Aber es gelte nun auch, Rechenschaft abzulegen. Diese seine Gemeinde sei seine erste große Liebe im Amt gewesen, und um sie habe er im Zorn und in Liebe geeifert … Wäre ihm noch einmal vergönnt gewesen, ihnen das Wort Gottes zu verkündigen, so hätte es in größerer Liebe geschehen sollen. Das erkenne er in dieser Stunde, und darum bäte er sie alle, ihm zu verzeihen, wo er gefehlt habe, denn es bliebe dabei: Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.206 Denn der Grund, auf dem sie erbaut seien, Jesus Christus207, der Sohn des lebendigen Gottes, der müsse unwandelbar bis in alle Ewigkeit bestehen bleiben; seine letzte Bitte könne nun keine andere sein, als in Gehorsam und Glauben auf diesem Boden, was auch kommen möge, zu beharren. Dann schritt er durch die Reihen und reichte allen die Hand. Es herrschte eine lautlose Stille, in das Scharren der Füße klang das unterdrückte Weinen der Frauen. – Die Frauenhilfe hatte zu einem Abschiedskaffee eingeladen. Da saßen nun die Frauen auf den Bänken aufgereiht, immer noch fand keine das erlösende Wort. Das Dorf hatte seiner scheidenden Pfarrfrau eine vollständige Hessentracht mit den gefalteten Röcken, Häubchen und breiten Bindebändern zum Abschied geschenkt. Als Gretel Schneider nun, gekleidet wie alle andern, mit einem herzlichen Wort zu den Frauen trat, war der Bann gebrochen.«
Auch die Hochelheimer Frauenhilfe richtete uns einen Familienabend größten Ausmaßes, bei dem Humor und Fröhlichkeit nicht fehlten.208 Wir wollten uns gegenseitig den Abschied nicht zu schwer machen. – Unter dem Gesang der Frauen fuhren wir dann am 25. April zum Dorf hinaus.