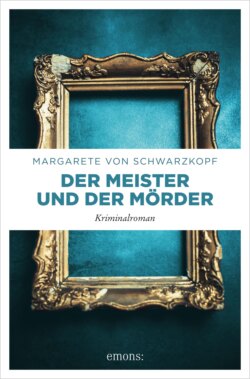Читать книгу Der Meister und der Mörder - Margarete von Schwarzkopf - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Intermezzo
ОглавлениеDer Raum lag im Halbdunkel. Das einzige Licht kam von einer Lampe, deren Strahl das Bild an der Wand fokussierte. Dieses Bild war seine Leidenschaft, sein Quell der Freude. Doch seit er erfahren hatte, dass dieses Gemälde nur eine, wenn auch gelungene, Fälschung war, schienen die Farben stetig zu verblassen. Das tiefe Grün des Drachen schimmerte nur noch matt, das leuchtende Weiß des mächtigen Schimmels, auf dem der heilige Georg saß, zeigte Grautöne, der rote Mantel des Ritters verschwamm zu einem dunklen Rosé. Dass dies eine optische Täuschung war, wusste er. Nichts hatte sich an dem Bild verändert. Noch immer stürmte Sankt Georg auf seinem strahlend weißen Ross in schimmernder Rüstung und wehendem dunkelroten Mantel auf das tiefgrüne Ungeheuer zu, noch immer erwartete es den Todesstoß, noch immer hielt die zarte junge Frau den Drachen an einem Band. Aber die Erkenntnis, dass er seit so vielen Jahren mit einer Fälschung gelebt hatte, verschob seine Perspektive, trübte seinen Blick und schmerzte ihn jeden Tag mehr.
Innerlich verfluchte er sich, dass er je den Auftrag erteilt hatte, die Provenienz des Bildes zu erforschen. Wie viel besser wäre es gewesen, das Gemälde weiterhin so zu sehen, wie er es jahrelang voller Freude genossen hatte – als eine frühe Fassung von »Der heilige Georg und der Drache« von Paolo Uccello. Es gab zu diesem Thema noch drei weitere Gemälde des großen Florentiner Malers, dem laut seinem allerersten Biografen Giorgio Vasari »die Natur ein feinsinniges und subtiles Talent geschenkt hatte«. Doch nur zwei von diesen drei bekannten Bildern waren mit seinem Bild vergleichbar, bei dem Uccello eindeutig genaue Studien zur Perspektive betrieben hatte, was sein Markenzeichen werden sollte.
Hätte er doch nur seine Neugierde gezügelt! Aber irgendwann war der Wunsch in ihm unerträglich geworden, die Geschichte des Bildes zu erfahren, das in einem verborgenen Winkel seines Hauses hing, fernab von neugierigen Blicken und damit gefeit vor möglichen Fragen. Woher stammte das Gemälde ursprünglich, wer hatte es vor langer Zeit besessen? Es gab eine Verbindung des Bildes zu seiner Familie, wie er von seinem Vater erfahren hatte. Im Familienarchiv lag ein Schreiben, das dies bestätigte. Es war im 17. Jahrhundert über Umwege in ihren Besitz gelangt. Doch dann verschwand das Bild aus unbekannten Gründen zu Beginn des 19. Jahrhunderts und war wie durch eine Fügung des Schicksals vor sechzig Jahren zu ihnen zurückgekehrt. Und nun hatte es ihn gedrängt, die Wahrheit zu erfahren.
Seine Sammlung umfasste eine Vielzahl bedeutender Werke, einige davon auf Auktionen erstanden, andere auf weniger legalen Wegen zu ihm gekommen. Doch dieses eine Gemälde war es, das ihn wirklich faszinierte, von dem eine Ausstrahlung ausging, die ihn immer wieder seltsam berührte. Und nun musste er sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass er eine Fälschung verehrte. »Es könnte sein, dass dies nicht die einzige Fassung ist, die von diesem Werk existiert«, hatte der von ihm beauftragte Detektiv vor zwei Wochen bei einem Treffen gemutmaßt. Dieser Detektiv, geboren in Manchester, war viele Jahre für eine Agentur tätig gewesen, die sich mit der Echtheit und Provenienz von Bildern befasste. Dann aber hatte er sich mit seinem Arbeitgeber überworfen, die Agentur verlassen und arbeitete nun als Freiberufler. Ein tüchtiger Mann, auch wenn seine Weste vielleicht nicht ganz blütenweiß war.
Zwei Jahre hatte der Detektiv mit der Recherche zu diesem Bild verbracht, zwei teure Jahre. Und dann das niederschmetternde Ergebnis. Er hatte in der British Library in London einen Brief aus dem Jahr 1690 entdeckt, dem er die Wahrheit entnahm. Es hatte einiges an Überredungskünsten bedurft, den Kurator der Abteilung für alte Dokumente, Sir Hugo Stevenson, zu überzeugen, den Brief kopieren zu dürfen. Erst als der Detektiv verriet, für wen er diesen Brief brauchte und dass er vielleicht der Schlüssel zu einem lang verborgenen Geheimnis sein könnte, stimmte der Kurator zu.
Der Mann in dem abgedunkelten Zimmer hatte zunächst nicht glauben wollen, was er las. Aber der Brief war, wie ihm ein Grafologe bestätigte, authentisch und bezog sich auf genau diesen von ihm gesuchten heiligen Georg. Es war kein Zweifel möglich. Doch anstatt sich den Tatsachen zu fügen, war in ihm der kalte Zorn hochgestiegen. Sein Vater hatte jahrelang nach dem Bild gesucht, bis er endlich auf eine heiße Spur gestoßen war. Er kannte nicht alle Details, weil er damals noch ein Kind gewesen war. Angeblich hatte sein Vater das Bild nach dem Zweiten Weltkrieg einem russischen Emigranten abgekauft. Der Urgroßvater dieses aus Russland geflüchteten Kyril Petronow, ein gewisser Sergej Petronow, hatte es um 1900 in Paris in einer Auktion ersteigert. Von da an hatte es sich im Familienbesitz der Petronows befunden und war ins Exil gerettet worden. Bei seiner Flucht hatte Kyril seine Familie in der Sowjetunion zurückgelassen. Doch dann entschloss er sich, sie doch in den Westen zu holen, und brauchte dringend Geld. Viel besaß er nicht mehr, einige Ikonen, zwei Fabergé-Eier, zwei frühe Iwan Schischkins und dieses italienische Werk. Kyril wollte seine russische Kunst nicht hergeben. Sie erinnerte ihn an seine verlorene Heimat, aber den Italiener, der in seinen Augen zwar ein wenig der Ikonenmalerei des 18. Jahrhunderts ähnelte, verkaufte er ohne Bedauern. Der sonderbare Engländer, dem er das Bild überlassen hatte, zahlte eine anständige Summe.
Und nun diese Enthüllung! Seit Jahren hatte seine Familie also eine Fälschung wie ihren Augapfel gehütet und verborgen. Was ihn schon als Jungen gewundert hatte, denn andere Bilder wie der van Dyck, der Raffael und der Caravaggio waren stolz präsentiert worden. Gelegentlich kamen sogar Kunstexperten ins Haus und standen bewundernd vor diesen Gemälden, und immer wieder gab es Angebote für deren Erwerb. Aber sein Vater lehnte alles ab. Den Uccello jedoch zeigte er niemals. Also musste es im Zusammenhang mit diesem Florentiner irgendeine dunkle Geschichte geben. Fälschungen gab es schon seit der Antike. Das war nichts Neues. Vielleicht hatte ja ein Zeitgenosse Uccellos dieses Bild geschaffen und es als Werk des wahren Meisters ausgegeben? Auf jeden Fall musste irgendwo noch das Original sein. Wo aber war das hingeraten? Hoffentlich war es nicht im Laufe der Zeit zerstört worden oder in Privatbesitz gelandet, unerreichbar für andere Menschen.
Auf dem kleinen Tisch neben ihm lagen zwei Postkarten mit Abbildungen der beiden anderen Gemälde, die Uccello vom heiligen Georg gemalt hatte. Eines davon befand sich in der National Gallery in London, das andere im Museum Jacquemart-André in Paris. Es gab Ähnlichkeiten, aber auch auffallende Unterschiede zwischen diesen drei Versionen desselben Motivs. Zwar war der Drache auf allen drei Gemälden dunkelgrün, Georg saß auf einem Schimmel, und die Prinzessin stand fast schüchtern in der linken Ecke. Auf dem Londoner Bild aber trug sie ein dunkelgrünes Gewand, auf dem Pariser Gemälde ein rotes. Vor allem die Drachen jedoch waren auf allen Gemälden unterschiedlich dargestellt. Der Londoner Drache stand vornübergebeugt in geduckter Haltung dem Ritter gegenüber, der Pariser Drache schien mit seinem vorgestreckten und erhobenen linken Hinterbein dem Reiter entgegenzustapfen. Auf der Fälschung dagegen kauerte der Drache am Boden wie ein sprungbereites Raubtier mit gespreizten Klauen und einer schlangenähnlichen Zunge. In den rostroten Augen lag ein dunkles Glimmen. Während auf dem Londoner Gemälde Georgs Speer in das linke Auge des Drachen eingedrungen war und auf der Pariser Darstellung die Speerspitze sich durch sein Maul gebohrt hatte, streifte Georgs Speer auf seinem Bild das Monster nur seitlich am Rumpf. Diesen Drachen schien nichts wirklich erschüttern zu können. Er wirkte unbezwingbar.
Er würde alles daransetzen, das Original, falls es noch existierte, in seinen Besitz zu bringen. Koste es, was es wolle. Es gehörte ihm, nicht in ein Museum oder in andere Hände. Kyril Petronow war inzwischen gestorben, aber sein Sohn Grigori lebte noch. Er kontaktierte ihn, doch Grigori erinnerte sich nicht mehr an den Uccello, er besaß immer noch die Ikonen und die Fabergé-Eier und hatte seine eigene Sammlung um viele Kunstwerke bereichert. »Ich sammele nur russische Kunst«, sagte Grigori. »Italiener sind nicht mein Ding.«
Sein Detektiv hatte für ihn schließlich mit einem ehemaligen Kunstdozenten in Deutschland Kontakt aufgenommen, der sich zwar mit dem italienischen Künstler befasst hatte, aber offenbar nichts über das Schicksal des Drachenbildes oder gar eine mögliche erste, frühere Fassung der beiden anderen Werke wusste. Nun war dieser Mann, ein recht bedeutender Sammler von italienischen und niederländischen Werken, gestorben; der Verdacht bestand sogar, wie er aus einer sicheren Quelle erfahren hatte, er sei ermordet worden. Sein Detektiv wollte sich damit ausgiebiger befassen und ihn informieren.
Auch seine Mails an einen Experten in Italien und an einen Kunsthistoriker in Wien zeitigten keine brauchbaren Ergebnisse. Der österreichische Kunsthistoriker gab ihm zu verstehen, dass er nicht an eine frühe Fassung des Gemäldes glaube, der Experte in Italien, der für die Uffizien arbeitete, meinte, er habe zwar davon gehört, dass Uccello um 1450 eine Art von »Pionierfassung« geschaffen habe. Doch wenn dem so sei, dann wäre dieses Gemälde wohl im Strudel der Zeiten untergegangen. Es gebe ein Gerücht, es sei im Jahr 1455 aus einem Palast der Medici geraubt worden. Eine alte Chronik vermerkte, dass der Palastaufseher dabei zu Tode gekommen war. Gleichzeitig sei auch ein Biondo verschwunden, weniger wertvoll, aber dennoch ein Kunstwerk der Frührenaissance. Der Kunsthistoriker mit dem klangvollen Namen Eduardo di Monte Albero erklärte, er habe einer weiteren Chronik entnommen, die Bilder hätten sich irgendwann im 16. Jahrhundert im Besitz der damals sehr einflussreichen, inzwischen ausgestorbenen Familie Buarotti befunden. Aber die Gemälde aus dieser Sammlung waren alle im 19. Jahrhundert, nach dem Tod des letzten nachweisbaren Verwandten der Buarotti, als Schenkung in den Uffizien gelandet. Doch weder der Uccello noch der Biondo seien unter den rund einhundertsechzig Werken gewesen. Falls es diese beiden Bilder wirklich gegeben hatte, so Monte Albero, waren sie schon lange verschollen.
Er war sich nach diesen Nachforschungen inzwischen fast sicher, dass das Original nach England gelangt war. Es war aber irgendwann vor längerer Zeit gefälscht oder kopiert worden, aus welchem Grund auch immer. Sein Vater hatte geglaubt, er habe das Original erstanden, sich aber nicht weiter mit dem Bild beschäftigt. Anders als sein Sohn. Er würde weder Mittel noch Wege scheuen, der Geschichte des Bildes auf den Grund zu gehen.
Dieser Brief aus der British Library bedeutete nicht das Ende der Recherche. Im Gegenteil. Er motivierte ihn vielmehr, das Geheimnis des Werkes zu enträtseln. Er rief seinen Detektiv an. »Suchen Sie weiter«, befahl er ihm. »Ich will dieses Bild, und ich verlasse mich auf Sie.«
Er konnte nicht ahnen, dass sein Detektiv auf seinem Weg von England nach Deutschland gerade den Tunnel unter dem Kanal hinter sich gelassen hatte und auf die belgische Grenze zufuhr. Seinem größten Coup entgegen, wie er glaubte.