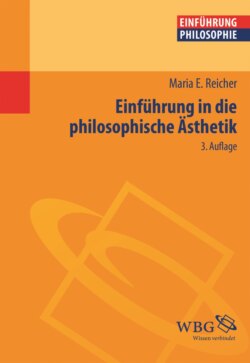Читать книгу Einführung in die philosophische Ästhetik - Maria Reicher - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Die Gegenstände der philosophischen Ästhetik
ОглавлениеIch beginne mit der Frage nach den Gegenständen der Ästhetik. An dieser Stelle ist eine terminologische Anmerkung angebracht, die einen Terminus betrifft, der in diesem Buch allgegenwärtig ist, nämlich den Terminus „Gegenstand“. Ich verwende diesen Terminus in einem etwas technischen (das heißt: vom natürlichen Sprachgebrauch abweichenden) Sinn. Im natürlichen Sprachgebrauch benützen wir „Gegenstand“ häufig in derselben Bedeutung wie „Ding“. Mit „Ding“ meinen wir normalerweise mittelgroße materielle (und unbelebte) Gegenstände, also die Art von Sachen, die wir sehen und angreifen können. Dinge sind also zu unterscheiden von Ereignissen, Zuständen, Eigenschaften, Gedanken, Gefühlen, ja sogar von Lebewesen. Ich gebrauche den Ausdruck „Gegenstand“ in einem sehr viel weiteren Sinn. In meinem Gebrauch sind auch Ereignisse, Zustände, Eigenschaften, Gedanken, Gefühle und selbstverständlich auch Lebewesen Gegenstände. Ein Gegenstand ist alles, worüber man nachdenken kann, wovon man sprechen kann, worüber man etwas wissen oder von dem man etwas glauben kann. Kurz: Alles ist ein Gegenstand in diesem Sinn.
Dieser Gebrauch des Ausdrucks „Gegenstand“ kommt dem in Redewendungen wie „der Gegenstand des Gesprächs“, „der Gegenstand der Debatte“ oder „der Gegenstand der Untersuchung“ sehr nahe. Der Gegenstand einer Debatte oder einer Untersuchung muss nicht unbedingt ein Ding sein. Gegenstand einer Untersuchung kann zum Beispiel ein Todesfall sein (also ein Ereignis), Gegenstand eines Gesprächs kann etwa die Freude über einen Besuch sein (also ein Gefühl).
Die Frage „Mit welchen Gegenständen beschäftigt sich die Ästhetik?“ ist also in einem sehr weiten Sinn zu verstehen. Als Gegenstände der Ästhetik kommen grundsätzlich nicht nur Dinge in Frage, sondern auch Ereignisse, Zustände, Eigenschaften, Gefühle und anderes. Jedenfalls ist nichts davon durch die Verwendung des Ausdrucks „Gegenstand“ in der Formulierung der Frage ausgeschlossen.
Drei traditionelle Definitionen der Ästhetik
Auf die Frage, welches die Gegenstände der Ästhetik seien, versuchen auch die drei bekanntesten traditionellen Definitionen der philosophischen Ästhetik eine Antwort zu geben. Diese Definitionen lauten:
1. Ästhetik ist die Theorie der Kunst.
2. Ästhetik ist die Theorie des Schönen.
3. Ästhetik ist die Theorie der sinnlichen Erkenntnis.
Selbstverständlich lassen sich auch jeweils zwei oder sogar alle drei dieser Charakterisierungen zu einer einzigen Definition zusammenfassen, wie in der schon erwähnten Charakterisierung von Ästhetik als Theorie des Schönen und der Kunst. Aus systematischen Gründen ist es aber zweckmäßig, diese drei zunächst getrennt zu diskutieren. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Sie sind weder einzeln noch zusammen genommen adäquat als Definitionen der Ästhetik.
Zweifellos ist die Theorie der Kunst ein wichtiger Teilbereich der Ästhetik. Sehr viele ästhetische Schriften beschäftigen sich mit Fragen, die zur Theorie der Kunst zu rechnen sind. Die Grundfrage der Kunsttheorie lautet: „Was ist Kunst?“ Diese und andere, speziellere, Fragen der Kunsttheorie werden im letzten Kapitel diskutiert werden.
Ästhetik ist nicht nur Theorie der Kunst
Trotzdem kann man die Ästhetik nicht mit der Theorie der Kunst identifizieren, und zwar aus folgendem Grund: Ein zentrales Thema der Ästhetik ist die ästhetische Erfahrung bzw. das ästhetische Erlebnis. (Ich verwende die Ausdrücke „Erfahrung“ und „Erlebnis“ hier und im Folgenden als austauschbar.) Nun ist es zweifellos so, dass viele ästhetische Erlebnisse durch Kunstwerke zustande kommen bzw. Kunstwerke zum Gegenstand haben. Wir können ästhetische Erlebnisse haben, wenn wir Musik hören oder ein Gedicht lesen oder ein Gemälde betrachten, und so fort. Der springende Punkt ist aber: Ästhetische Erlebnisse kommen nicht ausschließlich durch Kunstwerke zustande. Ästhetische Erlebnisse können von ganz banalen Alltagsdingen und in ganz alltäglichen Situationen verursacht werden. Ein ästhetisches Erlebnis kann man haben, wenn man eine Spiegelung in einer Fensterscheibe sieht, oder einen liebevoll gedeckten Tisch, oder das Muster einer Tapete, und so weiter.
Außerdem können ästhetische Erlebnisse sogar von natürlichen Dingen und Ereignissen ausgelöst werden, zum Beispiel von Pflanzen, Tieren, nicht von Menschenhand geformten Steinen, Naturlandschaften oder Naturereignissen (wie einem Gewitter oder einem Regenbogen). Mit „natürlichen Dingen“ bzw. „Naturdingen“ ist hier, grob gesagt, alles gemeint, was nicht von Menschen oder anderen intelligenten Wesen geschaffen wurde, sondern was sozusagen „von selbst“, auf natürliche Weise entstanden ist. (Es gibt allerdings Argumente für die Annahme, dass in speziellen Fällen auch ein Naturding ein Kunstwerk sein kann. Dieses Thema wird im letzten Kapitel diskutiert werden.) In der ästhetischen Literatur findet man in diesem Zusammenhang oft den Ausdruck „das Naturschöne“. Blumen, Berge und Regenbögen sind normalerweise keine Kunstwerke, aber sie können auf uns ästhetisch wirken, das heißt, sie können ein ästhetisches Erlebnis in uns auslösen. Aus diesem Grund ist es zu eng, philosophische Ästhetik als Theorie der Kunst zu definieren.
Ästhetik ist nicht nur Theorie des Schönen
Die Auffassung, dass Ästhetik die Theorie des Schönen ist, vermeidet den Einwand, der soeben gegen die Auffassung, dass Ästhetik Kunsttheorie ist, vorgebracht wurde: Schön können sowohl Kunstwerke als auch Naturdinge sein. Die Theorie des Schönen gehört auch zweifellos zur Ästhetik. Trotzdem ist die Definition der Ästhetik als Theorie der Schönheit nicht adäquat, und zwar vor allem aus zwei Gründen:
1. Die Theorie der Kunst geht nur zu einem kleinen Teil in der Theorie des Schönen auf. Natürlich hängen Kunst und Schönheit zusammen. Viele Menschen erwarten – ausgesprochen oder unausgesprochen – von einem Kunstwerk, dass es schön ist; und viele Kunstwerke sind auch schön. Zur Theorie der Kunst gehört aber auch Vieles, das nichts mit Schönheit zu tun hat. Das Problem der Authentizität von Aufführungen, oder das Problem der Beziehung zwischen Originalen und Fälschungen, und viele andere Fragen der Kunsttheorie, gehören nicht unmittelbar zur Theorie des Schönen.
Hässlichkeit in der Kunst
2. Nicht alle Kunstwerke sind schön. Nun kann man natürlich die Auffassung vertreten, dass es nicht-schöne Kunstwerke nicht geben kann, weil ein Gegenstand, der nicht schön ist, per definitionem kein Kunstwerk ist. Wer so argumentiert, der verwendet einen Kunstbegriff, der Schönheit einschließt. Wenn man einen solchen Kunstbegriff verwendet, dann gilt notwendigerweise: Alles, was ein Kunstwerk ist, ist schön.
Vom Begriff der Kunst und seinen Problemen wird, wie gesagt, noch ausführlich die Rede sein. Für den Augenblick soll der Hinweis genügen, dass ein solcher Kunstbegriff jedenfalls nicht dem allgemeinen Verständnis von Kunst entspricht. Das heißt: Es gibt viele Gegenstände, die allgemein als Kunstwerke anerkannt sind, die aber nicht schön sind bzw. nicht als schön gelten. Man denke zum Beispiel an die Arbeiten der Wiener Aktionisten in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts oder an die Bilder Gottfried Helnweins (geb. 1948) oder an die Karikaturen von Manfred Deix (geb. 1949), die mit Absicht erschreckend und abstoßend hässlich sind. Man kann aber auch weiter zurückgehen in der Kunstgeschichte, um Beispiele für hässliche Kunst zu finden, etwa Caravaggios Gemälde Medusa (um 1600), welches, auf sehr realistische Weise, den schlangenbewachsenen Kopf einer Frau mit grässlich verzerrtem Gesicht darstellt. Wer nichts von dem als Kunst gelten lässt, nur weil es nicht schön ist, der spricht offensichtlich von Kunst nicht im üblichen Sinn.
In allen erwähnten Beispielen ist die Hässlichkeit von den Künstlern beabsichtigt. Ein Kunstwerk kann aber, so scheint es jedenfalls, auch deshalb der Schönheit ermangeln, weil es misslungen ist. Wer leugnet, dass das möglich ist, der verwendet den Ausdruck „Kunstwerk“ als gleichbedeutend mit „gelungenes Kunstwerk“. Von einem „misslungenen Kunstwerk“ zu sprechen, wäre dann ein Widerspruch in sich. Ein misslungenes Kunstwerk wäre so unmöglich wie ein rundes Viereck oder ein verheirateter Junggeselle. Auch hier ist es mindestens fraglich, ob ein derart eingeschränkter Kunstbegriff nicht zu eng ist. Man muss sich fragen, ob es wirklich ein Widerspruch in sich ist, von einem „misslungenen Kunstwerk“ zu sprechen.
Die Vielfalt ästhetischer Eigenschaften
3. Schönheit und Hässlichkeit sind nicht die einzigen ästhetischen Eigenschaften, die es gibt. Schöne Dinge können in uns ästhetische Erlebnisse auslösen, und zwar, wie es scheint, aufgrund ihrer Schönheit. Schönheit berührt uns ästhetisch. Aber es gibt auch andere Eigenschaften von Gegenständen, die uns ästhetisch berühren können.
Das Vokabular des Ästhetischen enthält mehr als die beiden Prädikate „schön“ und „hässlich“. Mit ästhetischen Prädikaten werden wir uns in Kapitel III gründlich beschäftigen. Vorläufig sollen nur einige Beispiele gegeben werden für ästhetische Prädikate, die sich nicht auf „schön“ und „hässlich“ reduzieren lassen: „anmutig“, „erhaben“, „anrührend“, „poetisch“, „kitschig“, „sinnlich“, „ausdrucksstark“, „seicht“, „langweilig“, „humorvoll“.
Ästhetik ist also nicht nur die Theorie des Schönen. Mit anderen Worten: Ästhetik als Theorie des Schönen zu definieren, ist zu eng. Es ist aber auch nicht adäquat, Ästhetik als Theorie des Schönen und der Kunst zu definieren. Denn Gegenstände, die weder Kunstwerke noch schön sind, können ja nichtsdestotrotz ästhetische Qualitäten haben und somit Gegenstände ästhetischer Erfahrung sein. Solche nicht-schönen Gegenstände, die keine Kunstwerke sind, sollten also auch zum Gegenstandsbereich der Ästhetik gezählt werden. Es gibt ästhetische Erfahrungen, die weder Kunsterlebnisse noch Schönheitserlebnisse sind; und auch diese ästhetischen Erfahrungen gehören zum Gegenstandsbereich der Ästhetik. Ästhetik muss also mehr sein als Theorie des Schönen und der Kunst.
Wenden wir uns nun Baumgartens Definition zu: „Ästhetik ist die Theorie der sinnlichen Erkenntnis (also der sinnlichen Wahrnehmung).“ Im Licht unseres modernen Alltagsverständnisses mag diese Definition weit hergeholt klingen. Aber sie ist in der Geschichte der Ästhetik sehr tief verwurzelt.
Es ist klar, dass für die Ästhetik eine Theorie der sinnlichen Wahrnehmung sehr wichtig ist. Denn für ästhetische Erlebnisse spielt die sinnliche Wahrnehmung eine zentrale Rolle. Nicht nur, dass die meisten (wenn nicht alle) Arten der ästhetischen Erfahrung ohne sinnliche Wahrnehmung gar nicht möglich wären. Ob wir in einer bestimmten Situation ein ästhetisches Erlebnis haben oder nicht, hängt wesentlich davon ab, was wir in dieser Situation sinnlich wahrnehmen und wie wir es wahrnehmen. Man wird also in einer umfassenden Ästhetik sicher nicht ohne eine Theorie der sinnlichen Wahrnehmung auskommen. Das heißt: Man muss sich darüber Gedanken machen, wie sinnliche Wahrnehmung funktioniert, wie sie gesteuert werden kann, welche Ebenen und Elemente der sinnlichen Wahrnehmung wir unterscheiden können, wodurch sinnliche Wahrnehmung beeinflussbar ist, und anderes mehr. Diese Fragen sind für die Ästhetik wichtig.
Ästhetik ist nicht Theorie der sinnlichen Wahrnehmung
Dennoch ist es nicht adäquat, die Ästhetik mit einer Theorie der sinnlichen Wahrnehmung zu identifizieren, und zwar aus zwei Gründen:
1. Es ist nicht jedes Wahrnehmungserlebnis ein ästhetisches Erlebnis. Mit anderen Worten: Nicht jede Wahrnehmung ist eine ästhetische Wahrnehmung. Sinnliche Wahrnehmung ist eines unserer wichtigsten Erkenntnis-instrumente. Die Erkenntnis ästhetischer Qualitäten ist nur eine unter vielen möglichen Anwendungen dieses Instruments. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von Ästhetik als Theorie der sinnlichen Erkenntnis viel zu weit.
2. Nicht jedes ästhetische Erlebnis ist ein Wahrnehmungserlebnis. Denken wir zum Beispiel an die Literatur. Literatur gehört sicher zum Gegenstandsbereich der Ästhetik. Literarische Texte haben ästhetische Qualitäten. Aber die ästhetischen Qualitäten von literarischen Texten sind nur zum Teil Sinnesqualitäten. Mit „Sinnesqualitäten“ meine ich Qualitäten, die sinnlich wahrnehmbar sind. Rhythmus- und Klangeigenschaften eines Gedichtes oder Prosatextes sind sinnliche ästhetische Qualitäten. Aber ein literarisches Werk kann auch andere ästhetische Qualitäten haben, zum Beispiel Spannung, Poesie und Witz. Diese ästhetischen Qualitäten können sehr wesentlich sein für ein literarisches Werk, aber sie sind keine Sinnesqualitäten. Wenn wir uns eine Geschichte vorlesen lassen in einer Sprache, die wir nicht verstehen, dann können wir diese nicht-sinnlichen ästhetischen Qualitäten allenfalls aus dem Tonfall der Vorleserin erahnen, aber wirklich erfassen können wir sie nicht. In diesem Sinn ist die Charakterisierung von Ästhetik als Theorie der sinnlichen Erkenntnis zu eng.
Ästhetik als Theorie der sinnlichen Erkenntnis zu charakterisieren ist also einerseits zu weit, weil das Gebiet der sinnlichen Erkenntnis vieles umfasst, was nicht zur Ästhetik gehört. Die Charakterisierung ist aber andererseits auch zu eng, weil die Ästhetik vieles umfasst, was nicht zur sinnlichen Erkenntnis gehört.
Wir können also festhalten, dass keine der drei berühmtesten traditionellen Definitionen von Ästhetik adäquat ist. Jede einzelne ist entweder zu eng oder zu weit, oder sogar beides: in einer Hinsicht zu eng und in einer anderen Hinsicht zu weit. Es ist im Lichte des Gesagten unschwer einzusehen, dass auch keine Kombination der drei diskutierten Charakterisierungen eine adäquate Definition ergibt.
Eine alternative Definition der Ästhetik
Ich schlage nun eine Definition der Ästhetik vor, die sowohl die Theorie der Kunst als auch die Theorie des Schönen als auch einige Aspekte der Theorie der sinnlichen Wahrnehmung einschließt. Sie lautet:
Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften.
Auf den ersten Blick könnte es scheinen, dass diese Definition zirkulär ist. Eine Definition ist zirkulär, wenn man das Definiens (das ist der „erklärende“ Teil der Definition) nur dann verstehen kann, wenn man bereits das Definiendum (das ist der Terminus, den es zu definieren gilt) verstanden hat. Im vorliegenden Fall ist das Definiendum der Terminus „Ästhetik“; das Definiens ist „Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften“. Die Definition wäre also zirkulär, wenn man die Ausdrücke „ästhetische Erfahrung“, „ästhetischer Gegenstand“ und „ästhetische Eigenschaft“ erst dann verstehen könnte, wenn man bereits wüsste, was „Ästhetik“ bedeutet.
Es ist klar, dass eine zirkuläre Definition mangelhaft ist; denn sie verhilft uns nicht zu einem besseren Verständnis des definierten Ausdrucks – und das ist schließlich der Zweck einer Definition. Aber die vorgeschlagene Definition von „Ästhetik“ ist nicht zirkulär. Zwar sind die Termini „ästhetische Erfahrung“, „ästhetischer Gegenstand“ und „ästhetische Eigenschaft“ gewiss noch erklärungsbedürftig. (Ein großer Teil dieses Buchs ist dieser Aufgabe gewidmet.) Aber sie müssen nicht mit Hilfe des Terminus „Ästhetik“ definiert werden. Die Definition wäre zirkulär, wenn zum Beispiel „ästhetische Erfahrung“ definiert werden würde als die Art von Erfahrung, mit der sich die Ästhetik beschäftigt (und analog für „ästhetischer Gegenstand“ und „ästhetische Qualität“). Aber dieser schwere Fehler lässt sich leicht vermeiden.
Die Ergebnisse der folgenden Untersuchungen können hier noch nicht vorweggenommen werden. Aber man kann doch versuchen, eine erste Idee davon zu vermitteln, was gemeint ist, wenn von ästhetischen Erlebnissen, ästhetischen Gegenständen und ästhetischen Eigenschaften die Rede ist.
Die Begriffe des ästhetischen Erlebnisses, des ästhetischen Gegenstandes und der ästhetischen Eigenschaft hängen sehr eng zusammen, und zwar in der Weise, dass sie wechselseitig durch die jeweils anderen definierbar sind. Man könnte zum Beispiel den Begriff des ästhetischen Gegenstandes und den Begriff des ästhetischen Erlebnisses mit Hilfe des Begriffs der ästhetischen Eigenschaft definieren:
Ästhetischer Gegenstand
Ein ästhetischer Gegenstand ist ein Gegenstand, der (mindestens) eine ästhetische Eigenschaft hat.
Ästhetisches Erlebnis
Ein ästhetisches Erlebnis ist ein Erlebnis, welches das Erfassen einer ästhetischen Eigenschaft einschließt.
In diesen Definitionen wird der Begriff der ästhetischen Eigenschaft benutzt, um den Begriff des ästhetischen Gegenstandes und den Begriff des ästhetischen Erlebnisses zu erklären. Diese Definitionen sagen freilich nichts darüber, was wir unter einer ästhetischen Eigenschaft verstehen sollen. Man könnte nun den Begriff der ästhetischen Eigenschaft folgendermaßen definieren:
Ästhetische Eigenschaft
Eine ästhetische Eigenschaft ist eine Eigenschaft, die nur durch ein ästhetisches Erlebnis erfasst werden kann.
Diese Definition erklärt den Begriff der ästhetischen Eigenschaft mit Hilfe des Begriffs des ästhetischen Erlebnisses. Diese Definition ist, für sich allein genommen, nicht zirkulär, ebenso wenig wie die Definition des ästhetischen Erlebnisses. Aber diese beiden Definitionen zusammen genommen ergeben einen Zirkel: Ein Begriff A wird durch einen Begriff B erklärt; und der Begriff B wird durch den Begriff A erklärt.
Selbstverständlich ist so etwas als Definition mangelhaft. Denn wenn wir den Ausdruck „A“ nur verstehen können, wenn wir den Ausdruck „B“ verstehen, und wenn wir „B“ nur verstehen können, wenn wir „A“ verstehen, dann verstehen wir entweder sowohl „A“ als auch „B“ oder weder „A“ noch „B“. In beiden Fällen wäre eine Definition eines Begriffes A durch B (oder umgekehrt) nutzlos. Im ersten Fall wäre sie nutzlos, weil wir ja die Bedeutung von „A“ und „B“ bereits verstehen, also keine Definition brauchen. Im zweiten Fall wäre sie nutzlos, weil sie uns nicht weiterhilft.
Das bedeutet allerdings nicht, dass Definitionszirkel in jeder Hinsicht völlig nutzlos sein müssen. Wenn wir bereits ein Verständnis von „A“ oder „B“ (oder sogar von beiden) haben, dann kann es auch ein Erkenntnisgewinn sein, wenn uns klar wird, welche Beziehungen zwischen den Begriffen A und B bestehen.
Das ändert aber nichts daran, dass wir nicht, in ein und derselben ästhetischen Theorie, den Begriff des ästhetischen Erlebnisses durch den Begriff des ästhetischen Gegenstandes definieren können und den Begriff des ästhetischen Gegenstandes durch den Begriff des ästhetischen Erlebnisses. Wir können höchstens eine dieser Definitionen als Definition in unsere ästhetische Theorie aufnehmen. Der jeweils andere Begriff muss entweder anders definiert werden oder er muss undefiniert bleiben.
Undefinierte Begriffe
Undefinierte Begriffe gibt es in jeder Theorie, und zwar notwendigerweise. Denn, wie an unseren Beispielen schon ersichtlich ist, für jede Definition eines Begriffs müssen wir wiederum Begriffe benutzen. Wir können freilich diese Begriffe ihrerseits definieren, wozu wir wieder Begriffe brauchen, und so fort. An irgendeinem Punkt müssen wir allerdings diese Definitionskette abbrechen – ganz einfach deshalb, weil wir endliche Wesen sind. Da jede Theorie nur endlich viele Definitionen enthalten kann, müssen in jeder Theorie einige Begriffe undefiniert bleiben (vorausgesetzt, wir wollen Zirkularität vermeiden).
Diese unvermeidliche Konsequenz unserer Endlichkeit kann man unbefriedigend finden, aber sie ist nicht fatal. Denn zum Glück gibt es viele Ausdrücke, die wir recht gut verstehen, ohne sie jemals definiert zu haben. Vermutlich können Sie mit den Ausdrücken „ästhetischer Gegenstand“, „ästhetische Eigenschaft“ und „ästhetisches Erlebnis“ irgendeinen Sinn verbinden, wenn auch vielleicht keinen sehr klaren. Aber es dürfte ein Grundverständnis vorhanden sein, das als Ausgangspunkt dienen kann. Wenn das nicht der Fall ist, können Beispiele Abhilfe schaffen. Auf die Frage „Was ist eine ästhetische Eigenschaft?“ könnte man durch Angabe von typischen und unumstrittenen Beispielen antworten: Schönheit, Erhabenheit und Anmut sind allgemein anerkannte Beispiele für ästhetische Eigenschaften.
Falls es uns gelingt, den Begriff der ästhetischen Eigenschaft allein durch Angabe von Beispielen hinreichend klar zu machen, könnten wir diesen Begriff als undefinierten Grundbegriff behandeln und zur Definition des ästhetischen Erlebnisses und des ästhetischen Gegenstandes heranziehen, ohne in einen Zirkel zu geraten.
Später in diesem Buch wird sich allerdings zeigen, dass der Begriff der ästhetischen Eigenschaft doch problematischer ist als er auf den ersten Blick scheint. Daher schlage ich vor, lieber den Begriff der ästhetischen Erfahrung als undefinierten Begriff zu wählen. Dann kann dieser Begriff zur Definition des ästhetischen Gegenstandes und der ästhetischen Eigenschaft verwendet werden.
Vorausgesetzt, dass Schönheit eine ästhetische Eigenschaft ist, gilt: Ein Gegenstand, der schön ist, ist ein ästhetischer Gegenstand. Wenn wir die Schönheit eines Gegenstandes erfassen, dann haben wir ein ästhetisches Erlebnis. Ich spreche bewusst vom „Erfassen“ einer ästhetischen Eigenschaft und nicht vom „Wahrnehmen“. Wahrnehmen ist eine Art des Erfassens, aber nicht jedes Erfassen ist ein Wahrnehmen. Die Wahrnehmung sagt uns zum Beispiel nicht, dass ein Roman spannend ist. Die Qualität des Spannend-Seins erfassen wir nicht durch die Sinne.
Es ist leicht zu sehen, dass die vorgeschlagene Definition der Ästhetik die traditionellen Definitionen der Ästhetik ganz oder teilweise einschließt: Erstens ist gemäß dieser Definition die Theorie des Schönen ein Teilgebiet der Ästhetik, weil Schönheit eine ästhetische Eigenschaft ist. Zweitens ist gemäß dieser Definition die Theorie der Kunst ein Teilgebiet der Ästhetik, insofern Kunstwerke ästhetische Gegenstände sind. Drittens ist gemäß dieser Definition die Theorie der sinnlichen Wahrnehmung ein Teilgebiet der Ästhetik, insoweit sinnliche Wahrnehmung eine Form der ästhetischen Erfahrung ist bzw. insoweit die sinnliche Wahrnehmung ein wesentlicher Bestandteil der ästhetischen Erfahrung ist.
Der Begriff des ästhetischen Erlebnisses wird, wie gesagt, ausführlich im nächsten Kapitel erläutert werden. Ich sage bewusst, dass ein ästhetisches Erlebnis das Erfassen einer ästhetischen Eigenschaft einschließt – und nicht dass ein ästhetisches Erlebnis im Erfassen einer ästhetischen Eigenschaft besteht. Denn ein ästhetisches Erlebnis (wie der Begriff hier verstanden werden soll) kann ein sehr komplexes Erlebnis sein, das vieles einschließt – nicht nur das Erfassen ästhetischer Eigenschaften. Die Grundfrage lautet aber: Was geht in uns vor, wenn wir ästhetische Erfahrungen machen, und was unterscheidet ästhetische Erlebnisse von Erlebnissen anderer Art?
Die Frage, welche Gegenstände ästhetische Eigenschaften haben (und damit ästhetische Gegenstände sind) wird im dritten Kapitel behandelt. In diesem Kapitel wird auch die Natur ästhetischer Eigenschaften diskutiert. Die Ästhetik muss sich unter anderem mit folgenden Fragen beschäftigen: Was ist das Besondere an ästhetischen Eigenschaften? Welche ästhetischen Eigenschaften gibt es überhaupt? Welche Beziehungen bestehen zwischen ästhetischen und nicht-ästhetischen Eigenschaften? Wie kann man ästhetische Eigenschaften erkennen?
Die Gegenstände der Ästhetik
Die oben gestellte Frage „Mit welchen Gegenständen beschäftigt sich die philosophische Ästhetik?“ kann nun also wie folgt beantwortet werden: Die philosophische Ästhetik beschäftigt sich mit ästhetischen Eigenschaften, mit ästhetischen Gegenständen (das heißt: mit Gegenständen, die ästhetische Eigenschaften haben) und mit ästhetischen Erlebnissen (das heißt: mit Erlebnissen, die das Erfassen ästhetischer Eigenschaften einschließen).