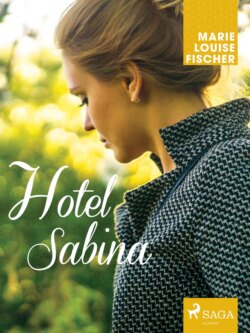Читать книгу Hotel Sabina - Marie Louise Fischer - Страница 10
6
ОглавлениеDer erste Eindruck von Genf war überwältigend.
Sabine und Stefanie überboten sich in dem Versuch, die Sehenswürdigkeiten der Stadt als erste zu entdekken. Da waren die gepflegten Uferpromenaden, die über hundert Meter hoch steigende Fontäne im See, »Jet d’eau« genannt, und das dunkle Gebirge, der »Salève«, das sich hinter den ehrwürdigen alten Bürgerhäusern abhob. Alles zusammen wirkte seltsam unwirklich, fast wie das betonierte Bild aus einem Reisekatalog. Sie staunten.
Doch als sie die Peripherie hinter sich gelassen hatten, mußte Sabine sich ganz auf den Verkehr konzentrieren. Stefanie hatte die Landkarte gegen Stadtplan eingetauscht.
»Hast du das Hotel Strasbourg entdeckt?« fragte Sabine.
»Aber sicher. Das habe ich mir schon zu Hause angestrichen.«
Die Versicherung hatte ihnen dort für die ersten Tage ein Zimmer gebucht.
»Und wie kommen wir hin?«
»Also, das ist ganz einfach: immer geradeaus und dann bei der Brücke nach rechts und dann … Pustekuchen, da fängt ’ne Fußgängerzone an.«
»Mach mich, bitte, nicht nervös!«
»Ich tue mein Bestes. Also … du fährst jetzt die nächste Straße, die Rue des Alpes, rechts rein… da muß so ’ne Art Monument sein …« Stefanie hob den Kopf, um Ausschau zu halten.
»Da vorne ist es«, bestätigte Sabine, »ein recht merkwürdiges rosa Gebilde.«
»Dann sind wir richtig. Jetzt immer weiter geradeaus, bis du links in die Rue de Pradier einbiegen kannst, und da muß dann auch schon unser Hotel sein.«
Sabine befolgte, etwas skeptisch, die Anweisungen ihrer Tochter und war angenehm überrascht, als sie ihr Ziel tatsächlich problemlos erreichten. »Das hast du gut gemacht, Stefanie«, lobte sie.
»Ich bitte dich, Maman! Kartenlesen ist doch keine Kunst.«
»Für manche Leute schon.«
»Jedenfalls bist du sehr gut gefahren.«
»Danke, Liebes.«
Die helle Sandsteinfassade des Hotels war anscheinend frisch gereinigt. Es hatte hübsche kleine Balkons. Fenster und Türen waren blau gestrichen.
Sabine hielt vor dem Eingang. Sie bat Stefanie, im Auto zu bleiben, nahm ihre Handtasche und stieg aus. Die Halle des Hotels wirkte, wenn man aus der strahlenden Sonne kam, etwas düster. Rasch nahm Sabine ihre Brille ab und sah sich um. Es war ein fast gemütlicher Raum mit bunten Orientteppichen auf dem Boden – ob echt oder falsch, das konnte sie nicht beurteilen –, alten, sehr gepflegten Möbeln, die Sitzgruppen bildeten, und einem imposanten Kronleuchter an der holzgetäfelten Decke.
Die Rezeption lag links vom Eingang.
Ein junger, sehr korrekt gekleideter Portier hieß Sabine willkommen. In ihrem immer noch etwas bemühten Französisch erklärte sie, daß die Nord-Süd Société d’assurances für sie und ihre Tochter ein Zimmer reserviert hätte. Der junge Mann wußte schon Bescheid.
»Zimmer Siebenundzwanzig, zweiter Stock«, erklärte er und drückte auf eine Klingel am Empfangspult.
Ein Page erschien und nahm den Zimmerschlüssel.
»Mein Auto steht vor dem Eingang«, erklärte Sabine.
»Würden Sie, bitte, das Handgepäck vom Rücksitz nach oben bringén lassen?«
»Selbstverständlich, gnädige Frau.«
Sabine wandte sich an den Pagen. »Warten Sie, bitte, einen Augenblick?«
»Wir werden Ihr Auto dann im Hof parken«, bot der Portier an.
»Danke, das wäre nett.«
Nach diesem Gespräch, das nach dem Muster eines Lehrbuchs abgelaufen war, begann Sabine sich sicherer zu fühlen; es war ihr nicht nur gelungen, sich in der fremden Sprache auszudrücken, sondern sie hatte auch alle Antworten verstanden.
Sie verließ das Hotel, um Stefanie zu erlösen. »Es hat alles geklappt«, erklärte sie, nicht ohne Stolz.
»Wieso auch nicht?« gab Stefanie, wenig beeindruckt, zurück.
Ein Hausdiener tauchte aus dem Souterrain des Hotels auf, und Sabine gab ihm den Wagenschlüssel. In seiner gestreiften Weste und der grünen Schürze mit dem grauen, kurzgestutzten Haar und dem gleichbleibendem Lächeln hatte er etwas geradezu Bilderbuchhaftes. Stefanie kicherte darüber, sobald sie ihm den Rücken zugewandt hatten.
Der Page fuhr mit ihnen im Luft nach oben und schloß ihnen das Zimmer auf. Er ging voraus und knipste das Licht an. Sie traten in einen fensterlosen Gang, auf dessen linker Seite eine Kofferablage und Kleiderschränke vom Boden bis zur Decke eingebaut waren. Rechts öffnete ihnen der Page eine Tür zum Bad, das sich zwar nicht mit dem in München vergleichen ließ, aber mit allem Notwendigen ausgestattet war; auf schimmernden Chromstangen hingen weiße, dicke Frottiertücher in verschiedenen Größen.
»Sehr schön«, sagte Sabine zufrieden.
Der Page war schon weitergegangen und hatte die Tür zum Zimmer aufgestoßen. Es war ein großer heller Raum mit zwei Betten, zwei Sesseln, einer Stehlampe und einem runden Tisch. An der Wand hing ein Ölgemälde, das einen mächtigen, schneebedeckten Berg zeigte.
Stefanie nahm sich ein Herz, zeigte auf das Kunstwerk und fragte: »Le Mont Blanc?«
»Oui, Mademoiselle«, erwiderte der Page lächelnd. Sabine kramte in ihrer Handtasche und gab ihm ein Trinkgeld.
»Merci, Madame«, sagte der Page, »une bonne journée!«
Mit einer Verbeugung zog er sich zurück.
»Wieso sagt der uns guten Morgen?« fragte Stefanie.
»Es ist doch längst Nachmittag.«
»Er hat nicht ›Guten Morgen‹ gesagt, das würde heißen: ›Bon jour‹. ›Une bonne journée‹ bedeutet: ›einen guten Tagesverlauf‹ – das sind so die kleinen Feinheiten, auf die man wohl erst mit der Zeit kommt.«
»Du kennst dich doch schon ziemlich gut aus, Maman.« Stefanie streifte ihr Turnschuhe von den Füßen und warf sich auf eines der Betten. »Und wie geht’s jetzt weiter?«
»Erst mal müssen wir warten, bis das Gepäck kommt, dann packen wir schnell aus, machen uns frisch, und danach machen wir uns auf zu einem Erkundungsgang. Einverstanden?«
»Oh ja, Maman! Du bist spitze.«
»Wieso das?«
»Andere Mütter hätten bestimmt gesagt: ›Jetzt ruhen wir uns erst einmal aus!‹«
Sabine lachte. »Ich wußte gar nicht, daß du soviel Erfahrung mit anderen Müttern hast«, scherzte sie. Dennoch hatte Stefanies Kompliment ihr wohlgetan. Als sie eine knappe Stunde später aufbrachen, hatten sie sich umgezogen. Sabine trug ein leichtes, braunes Leinenkleid, Stefanie einen blauen Jeansrock mit weißer Bluse; beide hatten, für den Fall, daß es kühl werden sollte, Strickjacken über die Schulter geworfen. Zuerst schlenderten sie in Richtung Rue de Mont Blanc. Der Geschäftsführer des Hotels hatte Sabine einen kleinen Stadtplan mit Veranstaltungskalender – »La semaine à Genève« – gegeben. Die Straße, die sie schon kannten, führte in der einen Richtung zum Bahnhofsplatz, in der anderen zum Pont Mont Blanc. Sie war eine typische Touristenstraße. Uhren- und Schmuckläden, Schokoladen- und Nippesgeschäfte lösten sich mit überfüllten Straßencafés ab. Hier gab es auch die unvermeidlichen Fast-food-Restaurants, von Jugendlichen aus aller Welt belagert. Die flanierende Menge wirkte kaum noch europäisch; Japaner, Amerikaner, Araber und Afrikaner beherrschten das Straßenbild.
Stefanie staunte, und Sabine gefiel es.
Vor einem imposanten Gebäude, zu dem eine breite Freitreppe hinaufführte, blieben sie stehen.
»Was ist das?«fragte Stefanie. »Die Oper?«
»Nein«, erwiderte Sabine nach einem Blick auf den kleinen Stadtplan, »nur die Hauptpost,«
»Was für ein Aufwand!«
Auch das Bahnhofsgebäude mit seiner klassizistischen Fassade wirkte beeindruckend. Darunter war eine Einkaufspassage mit luxuriösen Boutiquen angelegt. Mutter und Tochter warfen einen Blick hinein, verständigten sich aber rasch, daß sie sich diesen Bummel für heute schenken wollten. Sie wandten sich in Richtung See. Die Uferstraße, der Quai de Mont Blanc, war in beiden Richtungen hoffnungslos verstopft.
»Das muß der Rückverkehr vom Wochenende sein«, meinte Sabine, »es wird bestimmt nicht immer so zugehen.«
Schon bald sollte sich herausstellen, daß sie zu optimistisch gewesen war. Genf ist aufgrund seiner geographischen Lage für ein Verkehrschaos vorprogrammiert. Die Schweizer Stadt ist von zwei Seiten von Frankreich umschlossen. Jeder, der von Ferney nach Annemasse – das sind die beiden französischen Grenzsiedlungen – will, muß sie durchqueren. Außerdem arbeiten viele der benachbarten Franzosen als Grenzgänger – »frontaliers« – in Genf und müssen mindestens zweimal täglich die Grenze passieren. Zu allem Überfluß wird nahezu der gesamte Verkehr über den völlig überlasteten Pont Mont Blanc geleitet.
Aber darüber machten sich Sabine und Stefanie an ihrem ersten Tag in Genf noch keine Gedanken. Sie bewunderten den Mont Blanc, dessen schneebedeckter Gipfel in der Ferne leuchtete, unwirklicher als auf dem Gemälde in ihrem Zimmer, und schlenderten die Uferpromenade entlang.
Die Hitze des Tages war verschwunden, und viele Familien nützten die angenehme Kühle zu einem Spaziergang. Der hohe Anteil an Ausländern verschiedener Gesellschaftsschichten war auffallend. Indische und ceylonesische Frauen in bodenlangen Saris, tiefschwarze afrikanische Schönheiten mit ihren krausköpfigen Jungen und feingemachten, vielbezopften kleinen Mädchen und verschleierte Damen aus den Emiraten boten ein exotisches Bild. Aber auch Spanier, Marokkaner und Portugiesen, die vermutlich im Hotelgewerbe tätig waren, bevölkerten die Promenade. Stefanie kam aus dem Staunen nicht heraus.
»Genf ist für seine Internationalität bekannt«, erklärte Sabine, »hier ist der Sitz der UNO und vieler anderer internationaler Organisationen.«
»Ich weiß schon, aber so habe ich mir das doch nicht vorgestellt. Einfach toll. Endlich mal ’ne Stadt, wo niemand was gegen Ausländer hat.«
Sabine dämpfte ihre Begeisterung. »Ganz so ist es nicht. Es heißt, die Schweizer seien ausgesprochen fremdenfeindlich.«
»Das glaube ich einfach nicht.«
»Wir werden es erleben. Natürlich ist ein Saudi, der sein Geld ausgeben will, überall willkommen. Bei einem armen Schlucker sieht das anders aus.«
»Vermies mir nicht den ganzen Spaß, Maman! «
»Das hatte ich auch nicht vor, Liebling. Ich wollte dich nur darauf aufmerksam machen, daß der Schein auch trügen kann.«
Stefanie blieb stehen. »Sieh mal, da ist ja unser rosa Zuckerbäckertempelchen von vorhin! Schau doch, bitte, was in deinem schlauen Buch darüber steht!«
Sabine blätterte in ihrem Heftchen. »Das muß das Grabmal des Herzogs von Braunschweig sein.«
»Wirklich? Der ist hier begraben?«
»Scheint so.«
»Begreif ich nicht.«
»Der gute Herzog hat sich das Recht auf diese prominente Grabstätte durch Spenden an die Stadt Genf erkauft«, erklärte Sabine.
»Da haben wir es wieder: Geld regiert die Welt! Aber da hat er wohl eine Menge blechen müssen.«
»Anzunehmen.« Sabine zog ihre Strickjacke über.
»Wird dir nicht auch kalt, Liebling?«
»Ich friere überhaupt noch nicht. Sieh mal da drüben!« Sie lenkte die Aufmerksamkeit ihrer Mutter auf ein hohes modernes Gebäude aus Stahl mit dunkel getönten Fenstern. »Noga Hilton Hotel Casino« war in riesigen Lettern auf seiner Front zu lesen. »Ob das ein echtes Casino ist – wie in Monte Carlo?«
»Sehr wahrscheinlich«, meinte Sabine.
»So ein Luxus, das hältst du im Kopf nicht aus. Das müssen wir uns aus der Nähe anschauen, ja?«
»Nicht gerade heute«, wehrte Sabine ab, »ich möchte lieber weitergehen.«
Schon bald hatten sie die Menge der abendlichen Spaziergänger hinter sich gelassen. Eine schmale Landzunge, die an ihrer Spitze von einem Leuchtturm und einer mächtigen Platane beherrscht wurde, ragte ungefähr hundert Meter in den See hinein.
»Bains de pâquis«, las Stefanie mühsam und mit deutscher Aussprache, »Entrée cinquante centimes.«
»Scheint sich um ein Freibad zu handeln«, erklärte Sabine, »der Eintritt kostet…« Sie sprach es richtig aus. »….cinquante centimes. Aber was soll ›Pâquis‹ heißen? Ich kenne nur ›Pâques‹, und das heißt Ostern.«
»Sehr beruhigend, daß du auch mal passen mußt, Maman.«
Später sollten sie erfahren, daß Pâquis der Name des Viertels war, das sich unterhalb des Bahnhofes bis zum See hin erstreckte.
Hier draußen, so nahe am Wasser, war es wirklich frisch geworden, und Stefanie zog sich jetzt auch ihre Jacke an.
Es wurde allmählich dämmrig, und sie beschlossen, zum Hotel zurückzukehren, aber nicht am See entlang, sondern durch die Stadt. Sie wollten sich ein nettes Lokal suchen.
Schon bald, an der Place de Navigation, wurden sie fündig. Das Restaurant »Tamaris« pries seine türkische Küche an. Sie traten ein. Außer einem Herrn um die fünfzig waren sie die einzigen Gäste. Anscheinend wurde in Genf um diese Zeit noch nicht zum Abendessen gegangen.
Gemeinsam studierten sie die Speisekarte, bestellten sich Salat mit Ziegenkäse und Oliven und als Hauptgericht Fleischspießchen. Ein schwarzgelockter junger Kellner servierte, ein weißes Tuch um die Hüften geschlungen. Es schmeckte köstlich; der Salat war frisch und knackig und die Fleischstücke scharf gewürzt. Sabine gönnte sich ein Glas Rotwein und Stefanie eine Cola. Während des Essens plauderten sie halblaut und angeregt über ihr ersten Eindrücke von Genf.
Gerade als Sabine die Rechnung verlangen wollte, kam der Herr vom Nebentisch zu ihnen herüber; er trug einen weißen Leinenanzug und, um den Hals, ein hellblaues Seidentüchlein. Sein kahler runder Kopf war gleichmäßig gebräunt.
»Würden die Damen mir die Freude machen, sich zu einem Minzetee einladen zu lassen?« fragte er mit einer Verbeugung in fast akzentfreiem Deutsch.
»Wirklich, das ist sehr liebenswürdig, aber wir wollen gerade aufbrechen «, stotterte Sabine verwirrt und merkte zu ihrem Entsetzen, daß sie rot wurde.
»Aber, gnädige Frau, das können Sie mir nicht antun! Orientalische Gastfreundschaft darf man nicht abschlagen.« Ohne Aufforderung nahm er sich einen Stuhl und setzte sich zu ihnen an den Tisch. »Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Latif, stamme aus Kuweit und lebe schon seit fünf Jahren in Genf. Dieses kleine Restaurant ist mein Stammlokal. Tamaris, ein wundervoller Name, nicht wahr? Wissen Sie, was das bedeutet? Nein? Das ist der Name eines Baumes, der in der Mittelmeerregion wächst, aber auch in den Oasen meiner Heimat. Kommt von ›tamar‹, was auf arabisch Dattel bedeutet. Oh, wie vermisse ich die Oasen meiner Heimat!«
Sabine starrte den Mann verwundert an. War das seine Masche, sich an Frauen heranzumachen? Stefanie amüsierte sich.
»Fünf Jahre bin ich schon in Genf«, wiederholte der Fremde, »aber noch nie habe ich so entzückende Damen in diesem Restaurant gesehen.«
»Wir sind heute erst angekommen«, erklärte Sabine, die nicht wußte, ob sie sich über diesen Mann ärgern oder ihn charmant finden sollte.
»Dann hat das Schicksal uns zusammengeführt!« behauptete er mit übertriebenem Pathos.
In diesem Moment wurde der aromatisch duftende Tee in einer kleinen Silberkanne mit drei bunten Gläschen serviert.
Latif gab dem Kellner ein Zeichen und schenkte selber ein. »Vorsicht, der Tee ist sehr heiß!« warnte er.
»Und was machen Sie hier in Genf, Herr Latif?« wollte Stefanie wissen.
Sabine warf ihr einen tadelnden Blick zu; ihrer Ansicht nach bestand kein Grund, den aufdringlichen Fremden durch Fragen noch zu ermutigen.
»Ich arbeite natürlich bei der UNO – ohne Amt und Würden, als Beobachter sozusagen, sehr wichtig für meine Nation.«
Stefanie war beeindruckt. »Und wir sind…« begann sie.
Sabine fiel ihr ins Wort. »….gerade erst angekommen und zu Besuch bei Verwandten.«
»Aber wir können uns wiedersehen?«
Sabine nippte an ihrem Tee; er war stark gesüßt. »Das ist leider unmöglich. Wir bleiben nur ein paar Tage und sind völlig ausgebucht.«
»Woher können Sie so gut Deutsch?« fragte Stefanie.
»Oh, ich spreche viele Sprachen – acht? Oder neun? Habe ich gelernt in der Schule und an Universitäten in meiner Heimat. Sonst wäre ich nicht geschickt worden zu UNO.«
»Finde ich toll.«
Sabine leerte hastig ihr Glas. »Trink aus, Stefanie, wir müssen.« Sie winkte dem schwarzgelockten jungen Kellner, zahlte und stand auf. »Komm jetzt!«
Gehorsam erhob sich Stefanie und reichte Latif die Hand. »Es war nett, Sie kennenzulernen.«
»Das Vergnügen lag ganz auf meiner Seite!« Latif wandte sich wieder an Sabine. »Kann ich Sie denn wenigstens nach Hause bringen?«
»Nein, danke!« erwiderte Sabine härter als beabsichtigt.
In dem Gesicht des Fremden glaubte sie echte Enttäuschung zu sehen. Mit einem versöhnlichen Lächeln fügte sie hinzu: »Jedenfalls vielen Dank für den Tee.« Sie trat in die laue Nacht hinaus.
Stefanie folgte ihr. In der Tür drehte sie sich noch einmal um und sah Latif, der trübsinnig in sein leeres Teeglas starrte. »Warum hattest du es denn so eilig, Maman?« fragte sie. »Wir haben doch alle Zeit der Welt. «
»Weil ich keine Lust hatte, diesem Märchenerzähler weiter zuzuhören.«
»Nicht einmal deine Zigarette hast du geraucht! «
»Das hätte er als Entgegenkommen auffassen können.«
»So ein Quatsch!«
Sabine blieb stehen und sah ihre Tochter strafend an. »Stefanie, bitte!«
»Aber es ist doch wahr. Du hättest nicht so grob sein sollen. Ich fand ihn nett.«
»Mein liebes Kind, du bist naiv! So einem Orientalen darf man nicht über den Weg trauen. Hast du denn nicht gemerkt, daß er nur Phantastereien erzählt?«
»Na, wenn schon. Er hätte uns eine Menge erzählen können, und vielleicht hätte er dich sogar ausgeführt. Genf bei Nacht – interessiert dich das denn gar nicht? Vielleicht hätte er dich sogar ins Hilton Casino begleitet.«
»Danke vielmals. Ich bin nicht für Glücksspiele.«
»Aber du wolltest deine Freiheit, und du wolltest etwas erleben. Deshalb sind wir ja fort aus München. Und kaum ergibt sich eine Gelegenheit, stellst du sämtliche Haare auf.«
»Dieser Mann war nicht mein Typ.«
»Niemand hat erwartet, daß du dich in ihn verliebst. Jedenfalls wäre es eine interessante Bekanntschaft gewesen. Wenn du nur gewollt hättest.«
»Ich bin nicht zum Flirten nach Genf gekommen, sondern zum Arbeiten«, behauptete Sabine im Brustton der Überzeugung.
»Ha, ha, ha!« machte Stefanie respektlos und hakte sich bei ihrer Mutter ein. »Mir hat es leid getan, aber ich bin dir nicht böse. Wahrscheinlich mußt du dich erst akkli … schweres Wort! Akklimatisieren heißt es, nicht wahr? Das nächste Mal wird es schon besser gehn.«