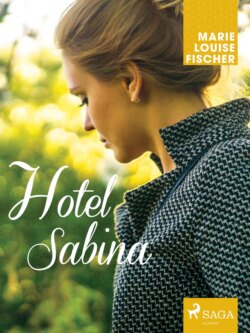Читать книгу Hotel Sabina - Marie Louise Fischer - Страница 5
1
Оглавление»Bis morgen dann, Frau Meyendorf!«
»Tschau, Sabine!«
Sabine Meyendorf erwiderte mit einem zerstreuten Lächeln die Abschiedsgrüße ihrer Kolleginnen, als sie, eilig wie alle anderen, das Gebäude der Nord-Süd-Versicherung verließ. Dann stand sie im dröhnenden Verkehr der breiten Prinzregentenstraße. Stoßstange an Stoßstange, von einer Ampel zur nächsten, drängten Pkw’s, Touristenbusse und Lastwagen zur Isar hin und in die Innenstadt von München, in der Gegenrichtung zumeist zur Autobahn nach Salzburg oder zum Flughafen. Auf der anderen Seite der Fahrbahn erhob sich mächtig die klassizistische Fassade des renovierten Prinzregententheaters.
Anders als die meisten Kollegen brauchte Sabine weder ein Auto noch ein öffentliches Verkehrsmittel, um nach Hause zu kommen. Sie ging die wenigen hundert Meter zu Fuß zu ihrer Wohnung heute beschwingter als gewöhnlich, wie sie selber spürte. Vorbei an der Weinstube »St. Georg«, einem im Souterrain des Eckhauses liegenden kleinen Lokal, überquerte sie die Possartstraße und hatte auch schon den Eingang des imposanten, an die hundert Jahre alten Sandsteingebäudes erreicht, in dem sie seit langem lebte.
Sabine schloß die schwere Haustür auf, stieg die fünf Stockwerke hinauf – einen Lift gab es nicht – und betrat ihre komfortable, liebevoll eingerichtete Altbauwohnung. Harry, ihr verstorbener Mann, hatte sie für seine Familie, für Sabine und die kleine Stefanie gekauft, und wie stets, wenn sie die hohen Räume betrat, empfand sie Dankbarkeit. Diese vier Wände boten ihr Schutz und Sicherheit in einer Welt, die, wie ihr schien, immer unruhiger und unberechenbarer wurde.
Noch in der Diele streifte sie, nachdem sie die Handtasche auf die Garderobe gelegt hatte, ihre eleganten, hochhackigen Pumps ab, hob sie auf und trug sie ins Schlafzimmer, das sie früher mit ihrem Mann geteilt hatte. Inzwischen hatte sie es durch helle Vorhänge und einen wunderschönen Aubussonteppich femininer gestaltet. Das Doppelbett war durch eine großzügig breite Liege ausgetauscht, die mit einem leuchtend bunten Überwurf bedeckt war.
Im Bad ließ sie Wasser in die große, runde Marmorwanne laufen, fügte ein paar Tropfen Öl hinzu und begann sieh auszuziehen. Kostümjacke und Rock hängte sie sorgfältig auf einen Bügel, um sie später zum Auslüften auf den Balkon zu bringen, Strümpfe und Unterwäsche warf sie in den Wäschekorb.
Während das Wasser noch in die Wanne lief, betrachtete Sabine sich kritisch im Spiegel. Sie war eine attraktive Frau von zweiunddreißig Jahren. Die recht breiten Schultern betonten ihre schmalen Hüften, ihre Beine waren sehr gerade, lang und schlank. Manchmal störte sie sich an ihrem kleinen Bauchansatz, der ihr von Stefanies Geburt geblieben war und den sie weder durch Gymnastik noch durch diverse Diäten hatte wegbekommen können. Aber es war ein liebenswertes Bäuchlein, fand sie und tätschelte die Wölbung, Stefanie war es wert gewesen.
Mit zwei Kämmchen steckte sie sich das halblange braune Haar aus der Stirn und reinigte mit einem Wattebausch gründlich das Gesicht. Ihre tiefblauen Augen waren umschattet, die Bindehaut gerötet, die Lider geschwollen. ›Witwenaugen‹, hatte Bernhard Heuss sie, gerührt und belustigt zugleich, genannt. – Ach, der gute Bernhard! schoß es ihr durch den Kopf. Nie hätte sie gedacht, daß er ein Problem für sie werden könnte, aber inzwischen sah es ganz so aus. Wie hatte es dazu kommen können?
Sabine lauschte noch einmal in die Wohnung, aber außer dem leisen Knarzen alten Holzes und dem gleichmäßigen Ticken der Standuhr in der Diele war nichts zu hören; sie war immer noch allein.
Sie ließ die Tür offen, bevor sie in die Wanne glitt. Wärme und duftender Schaum umfingen sie. Wohlig streckte sie sich aus und versuchte sich zu entspannen. Nach einer Weile gelang es ihr. Sie drehte den Wasserhahn zu, lehnte sich wieder zurück und schloß die Augen.
Als die Wohnungstür aufgeschlossen wurde, schreckte sie hoch und lächelte dann unwillkürlich. »Stefanie!« rief sie. »Huhu! Hier bin ich!«
Das kleine Mädchen, sehr blond und sehr dünn, aber sprühend vor Leben, stürmte herein. »Du hast’s vielleicht gut!« rief sie neidvoll. Sie trug weiße Kniestrümpfe und über ihrem Sommerkleid einen blauen Blazer, der die Farbe ihrer Iris betonte: Stefanie hatte die tiefblauen Augen ihrer Mutter, aber mit den hellen Haaren, die sie von ihrem Vater geerbt hatte, waren sie nicht so auffallend wie bei Sabine.
»Komm doch zu mir!« lud Sabine sie lächelnd ein.
»In die Wanne?«
»Warum nicht?«
Stefanies Blazer flog zu Boden, das Kleid hinterher, Sandalen, Strümpfe und Höschen folgten, bevor sie in die Wanne kletterte.
»Zigeunerin! « schimpfte Sabine, der Stefanies Unordnung schon immer ein Dorn im Auge war, mochte jedoch die gelöste Stimmung nicht durch einen ernsthaften Tadel verderben.
Die Wanne bot reichlich Platz für zwei, und Stefanie streckte sich, der Mutter gegenüber, behaglich in dem weißen Schaum. »Das haben wir lange nicht mehr gemacht!« stellte sie fest und fragte danach: »Warum eigentlich nicht?«
»Dein Vater hat es nicht gern gesehen.«
»Und warum eigentlich nicht?«
Sabine dachte nach. »Das kann ich dir schwer erklären. Wahrscheinlich war er der Meinung, daß zwischen Eltern und Kindern ein gewisser Abstand sein müßte. Das hatte wohl etwas mit Respekt und Disziplin zu tun. Du weißt ja, wie er war.«
Stefanie sah sich bemüßigt, den Verstorbenen zu verteidigen. »Aber verwöhnt hat er uns doch trotzdem.«
»Das kann man wohl sagen. Wir beiden waren die am meisten verwöhnten Frauen in ganz Bogenhausen.«
»Und trotzdem bist du arbeiten gegangen.«
»Ja, aber das hat ihm auch nicht gepaßt.« Daß sie, nachdem Stefanie ins Kindergartenalter gekommen war, eine Stellung als Sachbearbeiterin bei der Nord-Süd angenommen hatte, war der einzige Punkt, bei dem sie sich in ihrer Ehe durchgesetzt hatte – das und die Ausstattung ihres Traumbadezimmers, die er bis zuletzt als übertrieben empfunden hatte. »Finanziell«, erklärte sie, »hatte ich es ja auch wirklich nicht nötig, darin hatte er recht. Aber ich brauchte es einfach. Stell dir vor, ich würde dir vorschlagen: Laß die Schule Schule sein, von jetzt an wollen wir uns einfach nur ein schönes Leben machen!«
»Das kannst du nicht«, erwiderte Stefanie ernsthaft, »in Deutschland muß man in die Schule gehen – oder etwa nicht?«
»Stimmt. Es gibt eine Schulpflicht. Aber in ein paar Jahren ist die für dich vorbei. Dann könntest du aufhören.«
»Willst du das?« fragte Stefanie ziemlich verständnislos.
»Natürlich nicht, du Dummchen. Das sollte nur ein Beispiel sein. Gib zu: dir würde die Schule fehlen, genau wie mir der Beruf.«
»Ah!« Stefanie fühlte sich ihrer Mutter so nahe wie schon lange nicht mehr. »Weißt du eigentlich«, fragte sie und pustete in den Schaum, so daß weiße Wölkchen flogen, »daß du gerade das erste Mal über Papi geredet hast, ohne gleich in Tränen auszubrechen?«
»Habe ich das wirklich sonst immer getan?«
»Na ja, nicht ganz so dramatisch. Ich habe ein bißchen übertrieben. Aber ohne feuchte Augen ging es nie.«
»Das ist mir nicht so bewußt geworden! «
»Doch. So war es. Deshalb habe ich das Thema auch vorsichtshalber gar nicht mehr angeschnitten. Aber heute hast du selber damit angefangen.«
Sabine zögerte. »Ich weiß nicht…«
»Doch!« beharrte Stefanie. »Soll ich dir mal was sagen?«
»Wenn du etwas auf dem Herzen hast.«
»Du bist heute überhaupt anders als sonst.« Stefanie sah ihre Mutter unter den dichten blonden Wimpern heraus prüfend an. »Ich meine… anders als in den letzten Monaten. Direkt vergnügt kommst du mir vor.«
Sabine zuckte leicht zusammen.
»Oder hätte ich das nicht sagen sollen?« fragte Stefanie reumütig.
»Vergnügt«, stellte Sabine richtig, »ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck.«
»Na ja. So genau kann ich das nicht beschreiben. Aber anders als sonst. Ist was passiert?«
Sabine überlegte: War das die richtige Gelegenheit, mit Stefanie zu sprechen? Aber auf keinen Fall wollte sie ihre Töchter überfahren. »Das Wetter kühlt ab«, erklärte sie ausweichend, »wir sollten aus der Wanne!«
»Nicht jetzt schon! « protestierte Stefanie. »Erst mußt du mir den Rücken schrubben.«
»Einverstanden « Sabine griff zu Seife und Bürste. »Und dann du mir!«
Mit viel Geplantsche beendeten sie die Badezeremonie. Danach hatten die beiden alle Hände voll zu tun, den Ort des Geschehens wieder trockenzulegen und in Ordnung zu bringen.
Später saßen Mutter und Tochter einander gegenüber im Alkoven des Wohnraums und nahmen eine kleine Mahlzeit zu sich, die sie ihre Tea time nannten. Tatsächlich tranken sie beide Tee, Stefanie mit viel Sahne und Zucker, Sabine schwarz und mit Zitrone. Dazu aßen sie, je nach Laune, Toast mit Butter und Marmelade, mit Wurst, mit Schinken und Käse oder auch mit Krabben oder Ölsardinen.
Stefanie besuchte als Externe das Max-Joseph-Stift gleich um die Ecke in der Mühlbaurstraße, ein Internat, das vom bayerischen Kurfürsten Max Joseph für die Töchter des Landadels ins Leben gerufen worden war. Auch jetzt noch besuchten es Schülerinnen vom Land oder aus dem Ausland, aber vor allem Mädchen aus München, deren Eltern berufstätig waren und nur am Wochenende Zeit hatten, sich um die Familie zu kümmern.
Stefanie bildete eine Ausnahme: Sie nahm zwar am Unterricht des Gymnasiums teil, am gemeinsamen Mittagessen und an den Arbeitsstunden, konnte aber am späten Nachmittag, wenn sie ihre Hausaufgaben erledigt hatte, nach Hause gehen. Meist etwa zur gleichen Zeit, wie Sabine von ihrer Versicherung heimkam. Da es dann noch zu früh zum Abendessen war, hatte sich die Teezeit eingeführt.
Ungefähr zwei Stunden später stand dann, jedenfalls zu Harrys Lebzeiten, eine warme Mahlzeit auf dem Tisch. Inzwischen kochte Sabine nicht mehr regelmäßig, sondern warf nur, wenn sie oder ihre Tochter Hunger hatten, ein Steak in die Pfanne, einen Fisch, Eier oder Kartoffeln, zauberte schnell einen Griesbrei oder einen Flammeri.
Anders als während ihrer Ehe hatte sie sich abends nicht mehr zurechtgemacht, hatte den Büstenhalter fortgelassen und war, wie ihre Tochter, in einen leichten Hausanzug geschlüpft. Trotz der anhaltenden Trauer um ihren verstorbenen Mann empfand sie es als angenehm, sich nicht noch einmal schön machen zu müssen, sondern sich nach der Arbeit entspannen zu dürfen.
Sie trank ihren Tee mit kleinen Schlucken, während Stefanie Toast mit dick Erdnußbutter in sich hineinstopfte und dabei, zuweilen mit vollem Mund, munter drauflosplapperte – über ihre Freundinnen, den Mathelehrer und die geliebte Erzieherin. Sabine hörte nur halbwegs zu. Sie hatte sich wie viele angewöhnt, ihre Tochter und deren Wünsche, Hoffnungen und Kümmernisse immer seltener ganz ernst zu nehmen.
Endlich hatte Stefanie den letzten Bissen unten und rief: »So! Jetzt bist aber du dran, Mami!«
Sabine, die gar nicht mehr damit gerechnet hatte, daß Stefanie auf ihre Andeutungen zurückkommen würde, reagierte leicht verwirrt. »Hol mir doch, bitte, meine Handtasche!«
»Komm schon! Raus mit der Sprache! Keine Ausflüchtemehr!«
»Ich werde mir doch wenigstens vorher noch eine Zigarette anzünden dürfen!«
Stefanie hopste vom Stuhl. »Gerade noch gestattet! « – Sie lief in die Diele, kam mit Sabines Handtasche zurück, machte sich an dem Verschluß zu schaffen, öffnete sie, fand das Päckchen mit den Zigaretten, kickste eine heraus und ließ das Feuerzeug aufspringen.
»Danke, Liebling!« – Sabine nahm einen tiefen Zug.
»Also, was war…«
Stefanie hatte sich wieder gesetzt, legte die Ellbogen auf den Tisch, stemmte das Kinn auf die Fäuste und sah sie erwartungsvoll an.
»Herr Baumgartner hat mich zu sich kommen lassen.«
»Dein Boß?« fiel Stefanie ihr ins Wort.
»Genau der.«
»Und was hat er gewollt?«
»Na, zuerst einmal hat er gesagt: Sie gefallen mir nicht, Frau Meyendorf!«
»Nein, das glaube ich nicht, Mami! Das soll wohl ein Witz sein?«
»Ich war ganz schön betroffen, wie du dir denken kannst.«
»Aber das war doch eine Unverschämtheit! Dir so etwas ins Gesicht zu sagen! «
»Reg dich nicht auf, mein Liebling, die Hauptsache kommt ja noch. Also, er versicherte mir, daß er mich als Mitarbeiterin und Mensch… hm, hm… immer sehr geschätzt habe, aber in der letzten Zeit habe er das Gefühl, daß mit mir irgend etwas nicht stimme.«
»Der Quatschkopf! Du bist traurig, daß Papi nicht mehr bei uns ist. Das liegt doch auf der Hand.«
»Für ihn anscheinend nicht. Er erkundigte sich ganz ernsthaft nach meinen Problemen und wollte wissen, ob vielleicht ein Mann dahinterstecke.«
»Der hat sie wohl nicht mehr alle!«
Sabine lachte und versuchte, mit tiefer Stimme ihren Chef zu imitieren. »Lassen Sie mich mal wie ein Vater zu Ihnen sprechen!«
Stefanie warf beide Arme in die Luft. »Ich könnt’ mich kugeln! Und du, was hast du ihm darauf geantwortet?«
»Nichts. Gar nichts. Ich hab’ ihn reden lassen. Was kann man dazu schon sagen? Es dauerte, bis er die Katze endlich aus dem Sack ließ. Ein Tapetenwechsel, behauptete er, wäre genau das, was ich bräuchte.«
Stefanie riß die Augen auf. »Ein was?«
»Das ist bildlich gesprochen«, erklärte Sabine, »eine Metapher.«
»Sprich, bitte, deutsch mit mir, Mami! Rück endlich raus mit der Sprache!«
»Geht es dir nicht schnell genug? Ich wiederhole ja bloß, was er mir gesagt hat.«
»Wenn er so umständlich herumgedruckst hat, brauchst du es doch nicht auch zu tun.«
»Der Boß wollte mir die Sache eben schmackhaft machen.«
»Und du mir, wie?«
Sabine fühlte sich durchschaut. Trotzdem erwiderte sie: »Nein, bestimmt nicht. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich auf seinen Vorschlag eingehe.«
Stefanie sprang auf, nahm die kleine Kupferschale vom Wohnzimmertisch und hielt sie der Mutter unter den überlang gewordenen Aschenkegel.
Sabine tippte ihre Zigarette ab und nahm der Tochter das Schälchen aus der Hand. »Danke, Liebes.«
Anstatt sich wieder hinzusetzen, blieb Stefanie stehen und legte ihr den Arm um die Schultern.
Wenn sie ihrer Tochter nicht mehr in die Augen sehen konnte, fiel es Sabine leichter zu sprechen. »Also, ich will nicht länger um die Sache herumreden«, erklärte sie, »es geht um Folgendes: ich soll für ein Jahr nach Genf gehen.«
Stefanie rückte von ihr ab. »Nach Genf?« schrie sie. »Ja, ist er denn verrückt geworden?«
»Nein, Liebling. Ich bin sicher, er meint es nur gut mit mir«
»Aber du kannst doch nicht einfach nach Genf ziehen!«
»Na, so umständlich wäre das ja nun auch wieder nicht.«
»Und was ist mit mir?«
»Du kommst natürlich mit. Herr Baumgartner hat sich auch deinetwegen schon erkundigt. Es gibt dort eine internationale Schule. Mit deinen zwei Jahren Englisch kannst du dem Unterricht schon folgen «
»Und was ist mit dem Max-Joseph-Stift? Mit meinen Freundinnen? Mit Fräulein Liebknecht?«
»Es wäre ja nur für ein Jahr, Liebes.« Sabine nahm noch einen nervösen Zug aus ihrer Zigarette und drückte sie dann aus.
Stefanie, noch immer in ihrem Rücken, blieb ganz stumm. Sabine drehte sich zu ihr um und sah, daß sie Tränen in den Augen hatte.
»Du lieber Himmel, Stefanie!« rief sie. »Nimm es doch nicht so tragisch! Es handelt sich doch nicht um ein Muß, sondern um eine Idee, die ich mit dir besprechen wollte!« Sie zog das Mädchen in ihre Arme.
»Es klang aber ganz so«, murmelte das Mädchen, den Kopf an ihrer Schulter, »als wäre es schon entschieden.«
»Nein. Ist es nicht. Ich weiß ja selbst noch nicht, was ich will. Einerseits ist es verlockend, andererseits doch auch ein bißchen beängstigend. Es ist gar nicht so leicht, sich in meinem Alter noch umzustellen.« Stefanie rieb die Nase an ihrer Schulter. »Also alt«, meinte sie großmütig, »bist du wirklich noch nicht. Im Vergleich zu anderen Müttern…« Sie ließ den Satz offen.
Sabine schob sie sanft von sich. »Ich denke, mit diesem Schlußwort sollten wir die Besprechung beenden. Gibt es was Schönes im Fernsehen? Wir könnten aber auch mal wieder in Ruhe lesen. Was meinst du?«
Doch Stefanie ging auf dieses gut gemeinte Ablenkungsmanöver nicht ein, sondern begann, mit nachdenklichem Gesicht, Teller und Tassen auf das Tablett zu stellen.
Sabine und Stefanie waren noch nicht mit der Küche fertig, als es an der Wohnungstür klingelte. Da sie niemanden erwarteten, sahen sie sich einen Augenblick fragend an, dann lief Sabine durch die Diele, um zu öffnen. Sie hatte es nicht gerne, daß ihre Tochter die Tür aufmachte und so Gefahr lief, einem Fremden gegenüberzustehen.
Doch vor der Tür stand Lisbeth Albers, Sabines beste Freundin. Die beiden hatten zusammen gewohnt, als sie noch Jura studierten. Sabine hatte als erste aufgegeben, um den Rechtsanwalt Dr. Harald Meyendorf zu heiraten, Lisbeth nicht lange danach, um sich zur Sekretärin ausbilden zu lassen.
Wenn ihre Wege auch recht verschieden verlaufen waren, hatten sich die beiden Frauen doch nie ganz aus den Augen verloren, was vor allem Lisbeths Anhänglichkeit zu verdanken war. Immer wieder hatte sie Sabine angerufen, sie besucht oder Ideen für eine gemeinsame Unternehmung gehabt.
Harry hatte Lisbeth abgelehnt, sich über ihren, wie er fand, zu sorglosen und lockeren Lebenswandel mokiert und versucht, sie in Sabines Augen schlecht zu machen. Tatsächlich war ihm die Freundschaft der beiden Frauen ein Dorn im Auge, und die Vorstellung, daß die beiden nicht nur harmlos miteinander plaudern, sondern Einzelheiten ihres Intimlebens austauschen könnten, irritierte ihn.
»Komm rein!« rief Sabine jetzt. »Was für eine Überraschung!«
Die Freundinnen umarmten sich kurz.
»Keine Sorge!« erwiderte Lisbeth. »Ich werde nicht lange bleiben.«
»Aber warum? Du hältst mich von nichts ab.«
In diesem Augenblick wurde ihnen beiden bewußt, wie sehr sich die Freundschaft seit Harrys Tod verändert hatte. Früher war Lisbeth auch manchmal um diese Stunde hereingeschneit, hatte, einen Wodka mit Zitrone schlürfend, Sabine in der Küche bei ihren Vorbereitungen zum Abendessen Gesellschaft geleistet, um sich dann, möglichst bevor der Ehemann nach Hause kam, schleunigst zu verkrümeln.
Betroffen, als hätten sie sich einer Taktlosigkeit zu schämen, blickten sie sich an.
Lisbeth war eine vollbusige Person, einen halben Kopf kleiner als Sabine, und hatte eine Vorliebe für geblümte Kleidung – auch etwas, über das sich Harry lustig zu machen gepflegt hatte. Heute trug sie zudem noch eine mit künstlichen rosa Rosen besteckte Toque auf dem blondierten Haar.
»Du siehst gut aus!« befand Sabine ehrlich; sie war der Ansicht, daß die reichlich verspielte Aufmachung zu Lisbeth paßte.
»Ein süßes Hütchen, wie? Du solltest es mal aufprobieren.«
»Du weißt, so etwas steht mir nicht.«
Lisbeth ließ sich nicht davon abhalten, an ihrem Hut herumzunesteln, als wollte sie ihn abnehmen. »Käme nur auf den Versuch an.«
»Laß nur, Lisbeth!« wehrte Sabine ab.
Sie führte die Freundin ins Wohnzimmer, einen sehr großen, etwas düsteren Raum mit Parkettboden, Stukkaturen an der Decke und einem offenen, gemauerten Kamin. Ohne eine Aufforderung abzuwarten, ließ Lisbeth sich auf das bequeme Ledersofa sinken. »Immerhin«, konstatierte sie, »läufst du nicht mehr in schwarzen Gewändern herum.«
»Das habe ich zu Hause nie getan.«
»Du wolltest also nur deiner Umgebung deine Trauer bekunden?«
»Halt dich zurück, Kleine! Davon verstehst du nichts.«
»Verzeih mir, wenn ich deine edlen Gefühle verletz habe.«
Darauf ging Sabine nicht ein. »Mach’s dir bequem«, sagte sie trocken, »ich hol’ dir deinen Wodka.«
»Du hältst nicht mit?« rief Lisbeth ihr nach.
»Ich habe gerade Tee getrunken«, entschuldigte sich Sabine freundlich über die Schulter zurück.
Ihr war bewußt geworden, daß die Freundschaft mit Lisbeth zwar ihre Ehe und diverse Liebschaften der Freundin überdauert hatte, möglicherweise jedoch an ihrer Witwenschaft scheitern könnte. Harrys Tod hatte sie tief getroffen, und er fehlte ihr immer noch sehr. Lisbeth hatte in Harry immer nur den Tyrannen und Störenfried gesehen, auch wenn sie die Freundin, wie Sabine vermutete, insgeheim um den Ehepartner beneidet hatte. Sabine wollte nicht ausschließen, daß Lisbeth ihr diesen Schicksalsschlag gönnte. Es bräuchte sicher eine ganze Menge Diplomatie und Toleranz, um das zerstörte Vertrauen in ihre Freundschaft wiederherzustellen.
Stefanie war inzwischen mit der Küche fertig. Sie hatte den Rest Tee in ein Glas geschüttet, weil sie wußte, daß die Mutter ihn manchmal später noch trank.
»Laß nur, Liebling«, bat Sabine, »ich trinke ihn gleich.« Sie nahm ihr das Glas aus der Hand, stellte es auf ein Cocktailtablett, tat ein zweites Glas dazu, füllte es mit Wodka und spritzte in beide Gläser Zitronensaft. Danach ließ Stefanie zwei Eiswürfel hineinplumpsen. »Danke, Liebes!« Sabine beugte sich hinunter und küßte die Kleine flüchtig auf die Schläfe. »Komm doch mit und sag Lisbeth ›Guten Tage!«
»Wollen wir ihr nicht auch ein paar Erdnüsse anbieten?«
»Gute Idee! Aber, nein, laß nur. Vergiß nicht, daß sie gewissenhaft auf ihre schlanke Linie achtet.« Weil sie wußte, daß Stefanie solche kleinen Aufgaben gern übernahm, hielt sie ihr das Tablett hin. »Trag du’s hinein, ja?«
Stefanie mochte Lisbeth, die sie nie wie ein Kind behandelte oder Bemerkungen losließ wie: »Ach, bist du groß geworden!« Nachdem sie die Getränke serviert hatte, gab sie ihr einen Kuß auf die Wange.
Lisbeth überspielte ihre Gerührtheit. »Gib acht auf mein kunstvolles Make-up!« scherzte sie.
»Bloß keine Panik! Ich schlecke dich schon nicht ab.«
Stefanie ließ sich in einen Sessel fallen, zog die Füße hoch und verschränkte die Beine zum Schneidersitz.
»Sag, Lisbeth, warst du schon einmal in Genf?«
»Ja. Aber nur ein paar Tage. Auf der Durchreise. Ich war unterwegs an die Cote d’Azur.«
»Und… wie hat es dir gefallen? In Genf, meine ich.«
»Gut, Stefanie. Die Stadt hat ein gewisses – wie soll ich sagen? – Flair.« Da sie fürchtete, daß Stefanie das nicht verstand, fügte sie erklärend hinzu: »Eine interessante Atmosphäre.«
»Möchtest du dort leben?«
»Leben? Darüber habe ich noch nie nachgedacht.« Lisbeth nippte an ihrem Glas und nahm gleich darauf einen kräftigen Schluck. »Wenn du mich so direkt fragst: nein. Aber wie kommst du überhaupt auf so etwas?«
Stefanie zögerte mit der Antwort, weil sie das Gefühl hatte, indiskret gewesen zu sein.
»Mein Chef«, erklärte Sabine an ihrer Stelle, »hat mir den Vorschlag gemacht, nach Genf zu gehen.«
Lisbeth pfiff erstaunt durch die Zähne. »Will er dich loswerden?«
»Aber nein. Es wäre nur für ein Jahr. Meine Stellung in München würde mir natürlich erhalten bleiben.«
»Und was soll dann das Ganze?«
»Eine Art Personalaustausch. Unsere Firma ist, wie du vielleicht weißt, ein internationales Unternehmen. Man hofft, die einzelnen Filialen enger miteinander zu verbinden, den Gemeinschaftsgeist zu fördern.«
»Ob das was bringst?« frage Lisbeth skeptisch.
»Aber darum geht’s doch gar nicht!« rief Stefanie.
»Sollen wir nach Genf ziehen? Ja oder nein?«
»Du willst mit?«
»Von wollen kann keine Rede sein.«
»Falls ich mich für Genf entscheiden sollte, nähme ich Stefanie natürlich mit. Ich könnte sie doch nicht mutterseelenallein hier lassen.«
»Das kann ich verstehen.« Lisbeth kramte ein Zigarettenpäckchen aus ihrer weißen Handtasche.
Stefanie sprang ungebeten auf, holte die Zigaretten ihrer Mutter aus dem Alkoven und ließ es sich nicht nehmen, ihr Feuerzeug zu betätigen.
»Danke, Liebes.«
Lisbeth inhalierte tief. »Aber was ich nicht verstehe – warum willst du überhaupt nach Genf? Verdienst du dort mehr? Nicht einmal das. Wo könnte es schöner sein als in München. Und niemand hat es besser als du. Du hast eine traumhafte Wohnung und keinen langen Büroweg wie ich etwa. Stefanie besucht eine angesehene Schule – was treibt dich also?«
»Es wäre mal etwas anderes«, sagte Sabine und spürte selber, daß diese Erklärung sehr wenig überzeugend klang.
»Das Schicksal hat dich verwöhnt, meine Liebe – so maßlos verwöhnt, daß du es nicht einmal mehr merkst.«
»Ohne Harry ist es nicht mehr so, wie es war.«
»Natürlich nicht. Das Leben geht weiter. Die Konstellationen verändern sich. Das geschieht ganz von selber. Es ist durchaus nicht nötig, daß man sich mit einem Gewaltakt befreit.«
»Daran hätte ich ja auch nie gedacht. Ich habe ja nicht darauf hingearbeitet wegzukommen. Aber dieses Angebot – vielleicht ist es ein Wink des Schicksals.«
»Und was ist mit…« Lisbeth stockte. »Würdest du uns einen Augenblick allein lassen, Stefanie?«
Das Mädchen, das hinten in den Sessel gekauert war, saß plötzlich kerzengerade und sah die Mutter fragend an.
»Bleib nur!« sagte Sabine und, zu Lisbeth gewandt: »Ich nehme doch nicht an, daß du was Unanständiges fragen willst. Wenn doch, kannst du es dir sparen. Ich verweigere von vornherein die Antwort.«
»Sex ist unanständig, ja?« fragte Stefanie.
Sie erhielt keine Antwort.
»Ich wollte nur wissen – was ist mit dem guten Bernhard Heuss? Wie äußert er sich zu der ganzen Angelegenheit?«
»Er weiß noch gar nichts davon.«
»Nicht? Na, wenn das so ist, können wir uns die Diskussion sparen. Er wird dich nie und nimmer ziehen lassen.«
»Und wie könnte er es verhindern?«
»Indem er es dir verbietet.«
»Dazu hätte er gar kein Recht.«
»Aber er liebt dich doch, nicht wahr? Er war all die Jahre verliebt in dich. Das war nicht zu übersehen. Und jetzt, da Harry tot ist…« Sie stockte.
»…. müßte ich ihm vor die Füße fallen wie ein reifer Apfel!« ergänzte Sabine. »Das meinst du wohl, ja?«
»Willst du etwa behaupten, daß du nichts für ihn empfindest? Daß du nur mit ihm gespielt hast?«
»Es ist ein Unterschied, ob man mit einem Mann flirtet oder ob man bereit ist, sich ihm auszuliefern.«
»Was soll denn das nun wieder heißen. Sich ihm ausliefern!«
»Ist eine Ehe denn etwas anderes?«
»Er will dich also heiraten? Ich an deiner Stelle würde einen Freudensprung machen. Eines muß der Neid dir lassen: du hast wahrhaftig das Talent, die Männer zu faszinieren. Wie machst du das nur?« Lisbeth drückte ihre Zigarette so heftig aus, daß es fast aggressiv wirkte. »Sei lieb, Stefanie, bring mir noch einen Wodka! Ich denke, du kannst das schon.«
»Aber sicher, Lisbeth!« Das Mädchen rutschte von seinem Platz, nahm das geleerte Glas, trödelte aber auf dem Weg zur Küche, denn es ärgerte sie, gerade jetzt, da es interessant zu werden schien, hinausgeschickt zu werden. Bernhard Heuss war ein guter Freund ihres Vaters gewesen, auch Rechtsanwalt, und er hatte die Eltern oft besucht. Er war ihrer Mutter gegenüber stets zuvorkommend gewesen, hatte ihr Aussehen, ihre Garderobe, ihren Geschmack und ihre Kochkünste bewundert. Stefanie hatte das immer für ganz selbstverständlich gehalten, für einen Ausdruck etwas übertriebener Höflichkeit. Nun erfuhr sie, daß es sich nicht um bloße Freundschaft gehandelt hatte, sondern daß Onkel Bernhard ein Flirt ihrer Mutter war.
»Er hat mir keinen Antrag gemacht«, stellte Sabine indessen richtig, »ich gehe davon aus, daß er eine engere Bindung will. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Möglicherweise liege ich total verkehrt.« Stefanie hatte die Tür erreicht. Plötzlich ging ihr auf, daß sie, wenn sie sich beeilte, recht schnell zurück sein konnte. Sie sauste hinaus.
»Ach was«, widersprach Lisbeth, »versuch bloß nicht, mir was vorzumachen. Du bist dir seiner völlig sicher.« Sie zündete sich eine neue Zigarette an.
Du rauchst zuviel, hätte Sabine beinahe gesagt, aber sie unterdrückte die Bemerkung, weil ihr noch rechtzeitig klar wurde, daß sie das nicht das mindeste anging. »Ohne ihn«, erklärte sie statt dessen, »wäre ich nach Harrys Tod mit der Beerdigung und all den Formalitäten nicht fertig geworden.«
»Wärst du schon. Vor mir brauchst du nicht die Hilflose zu spielen. Aber sicher war er dir eine große Stütze.«
Stefanie war mit dem vollen Wodkaglas zurückgekommen. »Wer?« fragte sie. »Onkel Bernhard?«
Lisbeth überhörte es. »Sei froh, daß du ihn hast!«
»Vielleicht sollte ich das«, gab Sabine zu.
Es war ihr unmöglich, der Freundin zu erklären, warum sie nicht so empfand. Sie mochte Bernhard Heuss, hatte ihn immer gemocht. Er war sympathisch, intelligent, gutaussehend; es war nichts an ihm auszusetzen, außer vielleicht, daß er wenig Humor hatte. Aber was machte das schon? Den hatte Harry auch nicht gehabt. Sabine gestand sich, daß sie trotz ihrer Liebe zu Harry doch auch immer ein wenig in Bernd verliebt gewesen war. Wenn sein Besuch erwartet wurde, hatte ihr Herz höher geschlagen. Sie hatte sich besondere Mühe gegeben, sich für ihn schön zu machen. Wenn er sie zur Begrüßung in den Arm nahm, hatte sie es genossen und, wenn sich die Gelegenheit ergab, hatten sie zum Abschied heimlich heiße Küsse getauscht. Erst als Harry krank geworden war, hatte sie Bernhard in seine Schranken gewiesen, und sie war ihm immer noch dankbar, daß er taktvoll genug gewesen war, ihr Verhalten zu akzeptieren.
Sabine konnte sich keinen besseren Mann als Bernhard Heuss denken. Er war Harry ähnlich: zuverlässig, beherrscht, selbstsicher und – falls es einmal doch nicht ganz so sein sollte – unfähig, das zuzugeben. Er konnte keine Schwäche zeigen, sowenig wie Harry das vermocht hatte.
Falls sie Bernhard heiratete, würde es mit dem bißchen Freiheit, das sie sich nach Harrys Tod erkämpft hatte, vorbei sein. Es würde wie früher werden, und es würde für immer oder zumindest für absehbare Zeit so bleiben: die gleiche Wohnung und die gleichen Gewohnheiten. Es würde kein Ziel, keine Hoffnung, keine Träume und keine Erwartungen mehr geben. Natürlich würde es ihr rundherum gutgehen. In diesem Punkt hatte Lisbeth recht. Aber das genügte ihr einfach nicht. Lisbeth nippte an ihrem frischen Drink.
Stefanie beobachtete sie erwartungsvoll. »Ist er richtig so?«
»Genau getroffen! Wenn dir nichts Besseres einfällt, könntest du zweifellos Cocktailmixerin werden.«
Stefanie lachte. »Aber ich mache mir nichts aus Alkohol.«
»Das wird schon noch kommen.« Sie wandte sich der Freundin zu. »Soll ich ganz aufrichtig sein, Sabine?«
»Ich bitte darum.«
»Das mit Genf ist eine ganz dumme Idee. Erstens wird dort Französisch gesprochen …«
»Aber ich kann Französisch!« fiel Sabine ihr ins Wort.
»Ich müßte es nur ein bißchen auffrischen.«
»….und zweitens herrscht in Genf ziemlicher Frauenüberschuß. Falls du also hoffst, dir ein hohes Tier zu angeln…«
»Ich denke nicht im Traum daran!«
»….bist du völlig schiefgewickelt. Bei all diesen internationalen Gremien, Ausschüssen und Instituten sind junge Frauen en masse beschäftigt.«
»Du verstehst nicht, worauf es mir ankommt.«
»Dann erklär’s mir, bitte!«
»Ich möchte einfach raus hier«, sagte Sabine mit einer weit ausholenden Geste, »Abstand gewinnen, zu mir selbst finden.«
»Ach so? Na ja. Da kann ich nur eins sagen: wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis tanzen.«