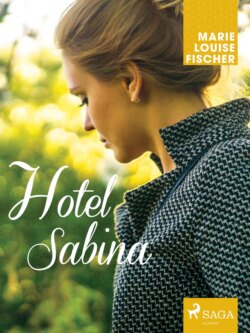Читать книгу Hotel Sabina - Marie Louise Fischer - Страница 7
3
ОглавлениеAm nächsten Morgen – es war ein Samstag – schliefen Sabine und Stefanie aus und gönnten sich dann einen Brunch in ihrem geliebten Alkoven. Sabine, die die Mahlzeiten hergerichtet hatte, war schon geduscht, frisiert und angezogen, ihre Tochter noch zerstrubbelt in Schlafanzug und Bademantel.
Stefanie gähnte herzhaft, während sie die Schale eines weichen Eis mit der Rückseite des Löffels zerklopfte.
»War es wenigstens schön gestern abend?«
Sabine hatte sie in der Nacht ganz rasch zu Bett gebracht und sich auf keine Unterhaltung mehr eiligelassen. Jetzt nahm sie einen Schluck Kaffee und sagte: »Wie man’s nimmt.«
Stefanie pellte die Schale ab und legte sie auf den Rand des Eierbechers. »Was soll das heißen?«
»Ich glaube, ich habe einen Riesenfehler gemacht.« Stefanie tat uninteressiert. »Ach ja?«
»Ich habe Bernhard erzählt, daß wir nach Genf gehen.«
»Und? Wie hat er reagiert?«
»Ziemlich gleichgültig.«
»Das sieht ihm ähnlich.«
»Du mußt das verstehen, Liebes. Ich wollte dich nicht überfahren, aber da ich es ihm nun einmal sagen mußte, wollte ich nicht mit ›vielleicht‹ oder ›faiis‹ kommen, sondern ihn vor vollendete Tatsachen stellen.«
»Hm, hm.« Stefanie trank einen Schluck Kakao und leckte sich anschließend die Lippen ab.
»Wenn dann doch nichts daraus wird, kann ich es ihm ganz leicht erklären. Besser als anders herum.«
»Du hast gedacht, er würde protestieren?«
»Ja.«
»Vielleicht hast du es dir sogar gewünscht.«
»Also wirklich, Stefanie! Spiel jetzt bloß nicht die Amateurpsychologin!«
»Ich versuche bloß dich zu verstehen, und ich sage dir, Mutti, das ist nicht so einfach.« Stefanie biß laut vernehmlich in ihr Toast mit Butter.
»Ganz verstehe ich mich ja selber nicht. Bernhard ist wirklich der ideale Mann zum Heiraten!«
Stefanie hatte ihren Toast hinuntergeschluckt. »Falls die Ehe überhaupt dein Ideal ist.«
Sabine mußte lachen. »Sehr, sehr weise, Liebes!«
»Ich bin ja schließlich nicht weltfremd. Ich höre und lese, wie es so zugeht. Die meisten Ehepaare streiten sich dauernd.«
»Das hast du bei Papi und mir nicht erlebt!«
»Stimmt. Mit euch beiden ging es prima. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, daß ihr euch scheiden lassen könntet – viele Kinder tun das nämlich, Mami, es ist nicht so, als wenn sie sich für die Geschichten der Erwachsenen nicht interessieren würden.« Sie redete munter weiter, während sie aß und trank. »Aber jetzt, nachträglich, denke ich, muß es doch manchmal ziemlich langweilig für dich gewesen sein. Wenn Bernhard zu Besuch kam, zum Beispiel. Dann gab es zuerst ein feines Essen, für das du dich abgerackert hast. Alles war immer so vorbereitet, daß du nicht bis zum letzten Moment in der Küche stehen mußtest, sondern auch noch Zeit hattest, dich schön zu machen. So war es doch, oder? Dann bekommst du einen Haufen Komplimente für dein gutes Essen und dein Aussehen, alles war Heiteretei. Aber kaum war das Essen vorüber, zogen sich die beiden Herren in Papis Arbeitszimmer zurück, und das Schachbrett wurde aufgestellt. Was für dich übrigblieb, war der Abwasch und Aufräumen. Ich durfte dir nicht mal helfen, denn für mich war’s Zeit zum Schlafengehen. Wenn du mit allem fertig warst, die Hände gewaschen und eingecremt, die Lippen nachgezogen, ein bißchen Puder auf die Nase getan hattest, durftest du ihnen Gesellschaft leisten, vorausgesetzt, daß du nicht störtest. Schachspielen erfordert nämlich, wie jedermann weiß, äußerste Konzentration.« – Stefanie legte eine Pause ein, um sich die Finger abzuschlecken.
»So«, sagte Sabine betroffen, »habe ich das nie so gesehen. Ich habe die Abende mit Bernhard immer genossen.«
»Ehrlich?«
»Es kam mir jedenfalls so vor.«
»Und zum Abschluß«, fuhr Stefanie fort, »durftest du dann noch ein paar Schleckereien anbieten, und man war wahrscheinlich des Lobes voll für eine so perfekte Frau, die ihre Rechte und Pflichten kennt und sich auch daran hält.« Stefanie wischte sich die Finger an der Serviette ab. »Mit wem spielt Bernhard eigentlich momentan Schach?«
»Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er es überhaupt noch tut.«
»Verlaß dich drauf.«
Sabine begriff, worauf Stefanie hinauswollte: Daß Bernhard, nach ihrer Heirat, die gleichen Abende mit einem anderen Partner veranstalten könnte, und das war keine sehr erhebende Vorstellung.
»Warum hast du es eigentlich nie gelernt?«
»Ich kann Schach spielen. Ich kann die Figuren auseinanderhalten, kenne die Grundzüge, weiß, was eine Rochade ist und so weiter. Darum habe ich auch gerne zugesehen. Aber mich so ernsthaft damit zu befassen wie die richtigen Spieler, habe ich nie Lust gehabt. Wir beide könnten es miteinander versuchen, und mit dir würde es mir sicher Spaß machen.«
Stefanie schabte die Eierschale von innen aus. »Eigentlich geht es nicht um Schach, sondern um etwas ganz anderes.« Sie schob den Eierbecher beiseite und fischte sich mit der Gabel ein Würstchen aus der heißen Brühe, tat sich einen Klecks Senf auf den Teller und biß herzhaft hinein. »Es geht um dich, Mami. Wir versuchen herauszubekommen, was für dich das Beste ist.«
»Ja, ich weiß. Aber irgendwie verwirrst du mich mit deinem Gerede.«
»Tut mir leid, Mami, das war nicht meine Absicht.«
»Außerdem weißt du doch schon längst, was ich wirklich will – fort von hier.«
»Auch noch nach gestern abend?«
»Was soll das nun wieder heißen?«
»Daß du Angst bekommen hast, deinen Verehrer zu verlieren, und dich fragst, ob du es riskieren kannst.«
»Pah!« erwiderte Sabine heftig. »Wenn seine Zuneigung nicht einmal ein Jahr Trennung überdauern kann, dann pfeif’ich drauf.«
»Gut gebrüllt, Löwe!«
»Sag mal, wie kommst du mir denn eigentlich vor? Ist das ein Verhör, dem du mich unterziehst?«
»Nein, überhaupt nicht.«
»Schließlich liegt es nicht an mir, sondern an dir, ob wir nach Genf gehen oder nicht.«
»Das ist es ja gerade. Vielleicht wirst du mir später Vorwürfe machen.«
Sabine, die ihre Tasse gerade hatte zum Mund führen wollen, setzte sie geräuschvoll ab. »Soll das heißen – du bist einverstanden?«
Stefanie strahlte sie an. »Endlich hast du es geschnallt.«
»Aber warum konntest du mir das nicht direkt sagen? Direkt und frei heraus? Statt so um den heißen Brei zu reden!«
»Wegen der Verantwortung. Weil ich mich verantwortlich für dich fühle.«
»Quatschkopf!« Sabine lachte erleichtert. »Ich bin deine Mutter, und ich bin zwanzig Jahre älter als du.«
»Aber man muß trotzdem auf dich aufpassen.«
Sabine glaubte, sie eigentlich zurechtweisen zu müssen, war aber viel zu erleichtert, um zu protestieren. »Wenn du das meinst, na, bitte! Aber erzählt mir jetzt, wie du dich zu dem Entschluß durchgerungen hast.«
»Hab’ einfach noch mal alles überdacht«, behauptete Stefanie. »Es wäre wirklich nicht gut, wenn du was mit Bernhard anfingst. Das käme mir vor wie so ’ne Art Bäumchen-wechsle-dich-Spiel.«
»Also nur mir zuliebe?«
»Nicht ganz.« Stefanie rührte, ohne Sabine anzusehen, gedankenverloren in ihrer Tasse. »Die anderen sagen, es wäre bestimmt toll, in der Schweiz zu leben. Und ich wäre schön dumm, wenn ich mir das entgehen ließe. Und überhaupt. Abwechslung ist das halbe Leben. Der Duft der großen, weiten Welt und so.«
»Es fällt dir also nicht schwer?«
»Doch. Natürlich tut es das. Aber die anderen würden mich auslachen, wenn ich jetzt hierbliebe. Nachdem ich so groß getönt habe.«
Sabine, die wohl wußte, daß Stefanie mit den »anderen« ihre Freundinnen meinte, versuchte, den Gedanken auf den Grund zu kommen. »Vergessen wir mal die anderen, ja? Sie sind nicht so wichtig, finde ich. Man sollte seine Entscheidung nicht von seiner Umgebung abhängig machen, sondern in sich gehen, um herauszufinden, was für einen selber gut und richtig ist.«
»Klar, Mami. Das habe ich auch getan. Und ich bin drauf gekommen, daß es nichts bringt, immer den leichten Weg zu wählen. Wenn man sich für den schwereren entscheidet, kommt wahrscheinlich mehr dabei heraus.«
»Ach, Stefanie«, sagte Sabine gerührt, »ich bin sehr froh, daß ich dich habe. Du bist ein richtiger Schatz. Soll ich dir mal was gestehen? Ohne dich hätte ich wahrscheinlich gar nicht den Mut, das hier aufzugeben. Glaubst du mir das?«
»Na klar. Zu zweit geht alles leichter. Besonders, wenn man sich so gut versteht wie wir.«
Sabine kämpfte mit den Tränen, aber unterdrückte sie tapfer. Es gab doch wirklich keinen Anlaß zu weinen. Im Gegenteil, sie hatte allen Grund glücklich zu sein.
Herr Baumgartner war hoch erfreut, als Sabine ihm mitteilte, daß sie sich entschlossen hätte, das Angebot anzunehmen. »Ich hatte es auch nicht anders erwartet.«
Sabine meldete sich bei einem Französischkurs an. Auch wenn ihr Unternehmen sie für die Fortbildungsstunden freistellte, empfand sie die Fahrten zu dem Sprachinstitut als wirkliche physische Belastung. Der Unterricht selbst machte ihr viel Spaß, doch mußte sie feststellen, daß ihr Schulfranzösisch bei weitem nicht den Ansprüchen ihres neuen Jobs genügen würde. Deshalb saß sie zu Hause oft bis spät in die Nacht über den Büchern. Bald zeigten sich die ersten Fortschritte. Die Schriftsprache bereitete ihr kaum noch Schwierigkeiten, aber gegen ihre Hemmungen, Französisch zu sprechen, kam sie nicht an.
Hoffentlich gibt sich das, wenn ich in Genf bin! dachte sie besorgt.
An Tea time mit Stefanie war, außer an den Wochenenden, nicht mehr zu denken. Vor dem Abendessen kam Sabine nie nach Hause.
Auch Stefanie lernte Französisch, wenn auch nicht im selben Tempo wie ihre Mutter. Einmal in der Woche brachte eine Studentin ihr die Grundbegriffe bei, die Aussprache und erste zusammenhängende Sätze. Herr Baumgartner hatte Sabine zwar versichert, daß man in Genf notfalls auch mit Deutsch und Englisch zurechtkam, aber sie hielt es für besser, wenn ihre Tochter wenigstens die Straßenschilder lesen und nach dem Weg fragen konnte. Stefanie teilte diese Meinung durchaus und war mit Feuereifer bei der Sache.
Doch mit dem Lernen allein war es nicht getan. Es hieß sich auf den Abschied vorbereiten. Sabine lud Lisbeth Albers und andere Freundinnen aus der Studienzeit ein, mit denen sie mehr oder weniger festen Kontakt gepflegt hatte. Stefanie gab eine Fete für ihre Mitschülerinnen. Bernhard Heuss lud die beiden häufiger als früher zum Essen ein, und Sabine mochte es ihm nicht abschlagen, um ihn nicht noch mehr vor den Kopf zu stoßen. Daß sie in der Arbeit fast erstickte – sie mußte neben allem anderen ja auch noch ihren Nachfolger in der Versicherung einarbeiten –, wollte er als Entschuldigung nicht gelten lassen.
»Das ist nur eine Frage der Organisation«, pflegte er zu erwidern.
»Wenn man sich seine Pflichten richtig einteilt, bleibt immer auch noch Zeit für das Vergnügen.«
Zu allem Überfluß kamen jetzt auch noch Einladungen aus dem Kreis befreundeter Ehepaare, mit denen Sabine und ihr Mann früher verkehrt hatten. Nach Harrys Tod hatte man sich kaum noch um Sabine gekümmert – oder war sie selber es gewesen, die signalisiert hatte, daß sie in Ruhe gelassen werden wollte? Jetzt, da sie neue Pläne hatte, schien sie wieder interessant geworden zu sein.
Am liebsten hätte sie sich gedrückt, aber Bernhard bestand mit Nachdruck darauf, daß sie die Einladungen annahm und bot sich ihr als Begleiter an. »Diese Leute sind wichtig«, behauptete er, »man muß solche Beziehungen pflegen. Du weißt nicht, ob du nicht eines Tages froh daran sein wirst.«
Mit Unbehagen mußte Sabine feststellen, daß man in Bernhard Heuss, obwohl er sich keineswegs aufspielte, so etwas wie ihren Verlobten, wenn nicht gar ihren Partner sah. Und so übernahm er es auch, die Abschiedsparty für diesen Kreis auszurichten, und zwar in einem Nebenraum bei »Käfer«.