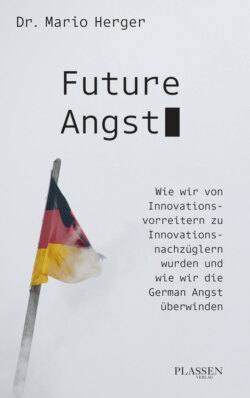Читать книгу Future Angst - Mario Herger - Страница 17
Dinglichkeit der Dinge
ОглавлениеAls 17-jähriger Schüler verbrachte ich meine Sommerferien mit zwei jeweils einmonatigen Praktika. Der erste Job war eine Straße weiter von meiner Wohnung bei einem Fotohändler für professionelle Fotografen. Ich hatte die verantwortungsvolle Aufgabe erhalten, das Lager mit Secondhand-Fotoartikeln auszumisten. Man muss sich das so vorstellen, als ob in einem größeren Raum mit Regalreihen ein Elefant durchmarschiert war, einmal trompetete und sich dabei geschüttelt hatte, um befriedigt weiterzuziehen. Was ursprünglich ein Schulungsraum für Fotografen mit Einrichtungen für Studioaufnahmen gewesen war, hatte mit der Zeit und dem Wechsel und Abgang der Verantwortlichen den Charakter einer mehr als chaotischen Anordnung von Regalen und Objekten eingenommen. In knapp zwei Wochen hatte ich das Lager ausgemistet, dabei von großen Ventilatoren, damit die Haare der Models im Wind schön wehten, über antike Kameras bis hin zu einem hochbrennbaren Zellulosenitratfilm mit Aufnahmen einer Wehrmachtparade vor dem Führer einiges an verstaubten Schätzen ausgegraben.
Das waren alles greifbare, dingliche Dinge, noch lange bevor es digitale Kameras gab. Film kam in Rollen, das technologische neueste Must-have bei Kameras für Amateure war der Autofokus gewesen und für mich am aufregendsten waren Infrarotfilme im Kühlschrank, die vor allem bei Profifotografen zum Einsatz kamen. Das verstand ich als 17-jähriger Schüler ohne viel Erfahrung.
Der Kontrast zum zweiten Ferienmonat konnte nicht größer sein, als ich ein paar Straßen weiter in die Bankfiliale trat und dort vier Wochen mit dem Ablegen von Zahlscheinen und der Tageskalkulation ebendieser eher wenig beschäftigt war. Für mich machte allerdings den größten Eindruck in dieser zweitkleinsten Filiale in Wien ein persönliches Gespräch mit der Chefin am zweiten Tag. Diese hatte mich in ihr Büro beordert und eine halbe Stunde von den „Produkten“ und dem Geschäftsmodell der Bank erzählt. Ein Sparbuch, ein Konto oder ein Bankenkredit waren Produkte. Natürlich waren mir diese Dinge ein Begriff. Aber jemandem wie mir, der aus einer Arbeiterfamilie stammt, in der das Leben des Vaters an einer Werkbank statt-fand, waren nicht greifbare und abstrakte Dinge wie eben ein Sparbuch, ein Konto oder ein Kredit nicht als Produkte in den Sinn gekommen.
Abgesehen davon, dass die Finanzwelt für mich persönlich nicht als zukünftiges Berufsfeld interessant genug erschien, hatte ich verstanden, dass Produkte dinglichen und nichtdinglichen Charakter haben konnten. Letztendlich verschlug mich meine berufliche Laufbahn von einem eher dinglichen Studium der Chemie in eine Welt der nichtdinglichen Softwarebranche. 30 Jahre später hat sich dank des Siegeszugs digitaler Technologien die Vielfalt von Nichtdinglichem explosionsartig vermehrt. Nicht nur das: Selbst die scheinbar so dinglichen Produkte kommen ohne Nichtdingliches gar nicht mehr aus. Jede moderne Kamera kann ohne Millionen Zeilen von Softwarecode gar nicht mehr verwendet werden. Jede Ampelanlage und angeschlossene Verkehrssteuerung ist nur durch Software funktionstüchtig. Autos bewegen sich ohne Millionen Zeilen an Software keinen Zentimeter mehr vom Platz. Volkswagen beziffert die Zahl der Programmierzeilen in seinen Autos mit über 100 Millionen.31 Fernseher, Mikrowelle, Telefon, medizinische Geräte, Flugticketbuchung, Flugzeuge, Baumaschinen, Bauzeichner, Zugfahrpläne, Gerichte, ja, selbst Kunst und Kultur sind von technologisch Nichtdinglichem so abhängig geworden, dass ohne dieses die Arbeit nicht oder nur mehr sehr beschränkt möglich wäre.
Gleichzeitig haben diese äußerlich scheinbar wenig veränderten Produkte – Auto, Flugzeug, Kamera – recht wenig mit ihren Vorgängern gemeinsam. Ein Smartphone hat mit einem Wählscheibentelefon so viel gemeinsam wie ein Homo sapiens mit unserem 540 Millionen Jahre alten Vorgänger Saccorhytus coronarius.32
Umso erstaunlicher scheint, wie wenig Wertschätzung Produkten entgegengebracht wird, die nicht greifbar sind. Spiegel-Podcaster Sascha Lobo beantwortet Leserkommentare auf eine seiner Kolumnen, in der er die Rückständigkeit deutscher Unternehmen in der Digitalisierung und bei der Internet- und Mobilfunkinfrastruktur behandelt. Sie führen unbeabsichtigt genau diese gedanklichen Fehler vor.33
„Na und, Facebook ist bald tot, aber die Telekom lebt weiter.“
„Naja, Facebook ist eine digitale Plattform. Die Telekom besitzt Infrastruktur.“
„Falsch gedacht, Herr Lobo. Softwareprodukte stellen letztlich keine echten Werte dar. Zieht man den Stecker, ist alles weg.“
Man bitte den letzten Kommentator, das doch einmal den Leuten bei SAP zu sagen. Deren einziges Produkt ist Software, beschäftigt damit fast 100.000 Mitarbeiter und ist das wertvollste Unternehmen Deutschlands mit einer beinahe doppelt so hohen Marktbewertung wie das zweitwertvollste deutsche Unternehmen Volkswagen. Letzteres kämpfte im Jahr 2020 mit der Auslieferung seines neuen Hoffnungsträgers, dem Elektroauto ID.3, weil die Software nicht funktionierte. Zehntausende Fahrzeuge waren bereits produziert, ohne dass sie ausgeliefert werden konnten.
Wie ist das aber mit der Infrastruktur der Telekom? Lobo weist darauf hin, dass die Digital-Giganten Facebook und Google selbst über riesige Kabelinfrastruktur verfügen. Google beispielsweise besaß bereits im Jahr 2018 über 100.000 Kilometer an Unterseekabeln, Facebook knapp 92.000 Kilometer.34 Damit bricht die Mär vom Unterschied und dem Wert von Unternehmen mit Infrastruktur und solchen mit digitalen Plattformen zusammen. Es wird augenscheinlich, dass Google, Facebook und Co dingliche Infrastruktur und digitale Produkte haben, während die Telekom Infrastruktur, aber kein wirkliches digitales Produkt hat.
Und zieht man wirklich den Stecker, dann ist die Telekom genauso betroffen. Denn was, wenn nicht digitale Produkte, fließt denn durch die Kabel? Ist kein Strom mehr da, helfen der Telekom die ganzen Kabel, durch die nun nichts mehr fließt, nichts.
Wir können solche Kommentare selbstverständlich gerne dem uninformierten Teil unserer Gesellschaft zuschreiben, doch dem ist leider nicht so. Diese Aussagen werden von vielen Vorständen und Vordenkern ebenso unreflektiert kolportiert. Und ich höre von ihnen dann auf Kongressen – und wenn sie ins Silicon Valley auf Besuch kommen.
Der aus Griechenland stammende Biomathematikprofessor am MIT Manolis Kellis meinte zu der Zurückhaltung der Menschen und Unternehmen in Bezug auf digitale Technologien, dass wir Menschen selbst digitale Wesen seien. Unsere Gene seien selbst aus vier Basen zusammengesetzt, die durch einen Kopiermechanismus repliziert werden.35 Statt Nullen und Einsen kommen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin zum Einsatz, aus denen so komplexe Wesen wie wir entstehen. So betrachtet ist digitale Technologie eigentlich sehr natürlich.