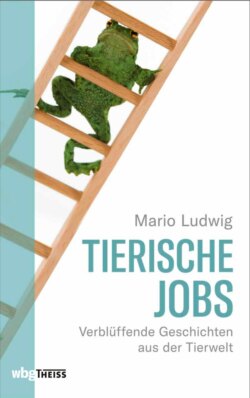Читать книгу Tierische Jobs - Mario Ludwig - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWunderheiler mit Flossen?
Es gibt kaum eine Therapieform für geistig und körperlich behinderte Kinder, die derart umstritten ist, wie die sogenannte „Delfintherapie“. Eltern betroffener Kinder berichten auf der einen Seite oft geradezu enthusiastisch von großen Fortschritten, die ihre Kinder in den unterschiedlichen Delfintherapiezentren dank dem Umgang mit den freundlichen Meeressäugern erzielen. Tierschutzorganisationen, aber auch viele Wissenschaftler kritisieren auf der anderen Seite, dass nicht nur jeglicher wissenschaftlicher Nachweis für einen messbaren Erfolg dieser Art der Therapie fehle, sondern auch, dass die Haltung der Delfine keineswegs artgerecht erfolge.
Begonnen hat alles Ende der 1950er-Jahre, als der amerikanische Psychiater Dr. Boris Levinson während therapeutischer Sitzungen mit verhaltensauffälligen Kindern herausfand, dass die pure Anwesenheit seines Golden Retrievers „Jingles“ einen positiven Einfluss auf seine Patienten hatte. Eine Erfahrung, die ihn veranlasste, Hunde in sein Behandlungskonzept einzubeziehen. Seine Erfahrungen veröffentlichte der Psychiater 1962 in einer Arbeit mit dem damals sicherlich durchaus provokanten Titel „Der Hund als Co-Therapeut“, in der er dezidiert über den erfolgreichen Einsatz von Hunden in der Kinderpsychotherapie berichtete. Die sogenannte „tiergestützte Therapie“ war geboren – ein laut Definition des allgegenwärtigen Internetlexikons Wikipedia „alternativmedizinisches Behandlungsverfahren zur Heilung oder zumindest Linderung der Symptome bei psychiatrischen, psychisch/neurotischen und neurologischen Erkrankungen und seelischen und/oder geistigen Behinderungen, bei denen Tiere eingesetzt werden“.
Als „Therapietiere“ bzw. Co-Therapeuten arbeiteten bald Hunde, Katzen, Pferde, Lamas (!) und eben auch Delfine. Ihre Wurzeln hat die Delfintherapie in Florida. Dort beobachtete 1971 Dr. Betsy Smith, eine Anthropologin der Florida International University, dass der gemeinsame Aufenthalt im Wasser mit zwei Delfinen offensichtlich einen positiven Einfluss auf ihren behinderten Bruder hatte.
Die Delfintherapie selbst geht auf den amerikanischen Neurologen und Verhaltensforscher David Nathanson zurück, der Ende der 1970er-Jahre erstmals die Wirkung von Delfinen auf geistig und körperlich behinderte Kinder untersuchte und aus den gewonnenen Erkenntnissen heraus die sogenannte „Dolphin Human Therapy“ (DHT) entwickelte. Bei dieser Art der Therapie werden die Meeressäuger, denen oft eine gewisse Hilfsbereitschaft Menschen gegenüber unterstellt wird, als eine Art positiver Verstärker genutzt. Die kleinen Patienten bekommen vom Therapeuten verschiedene Aufgaben gestellt. Erfüllt ein Kind die vom Therapeuten vorgegebenen Aufgaben, wird es postwendend durch eine Interaktion mit dem Delfin belohnt: Es darf ihn streicheln, füttern oder sich sogar an seiner Rückenflosse festhalten und durch das Becken ziehen lassen. Der Wunsch der kleinen Patienten, mit dem Delfin spielen zu dürfen, soll dabei bewirken, dass seine Aufmerksamkeit bei den zuvor gestellten Therapieaufgaben stark erhöht wird. Löst ein Kind dagegen die geforderten Vorgaben nicht zur Zufriedenheit des Therapeuten, wird ihm der Zugang zum Delfin verwehrt.
Folgt man Nathanson, dann lernen die Kinder mithilfe der Delfine 4-mal schneller als ohne Unterstützung durch die Meeressäuger. Diese Aussage wird von Kritikern stark bezweifelt, da sie nicht durch eine unabhängige Studie überprüft wurde.
Wie nicht anders zu erwarten, stürzten sich auch die Medien gierig auf die neue Therapie, berichteten über die sensationellen und wundersamen Heilerfolge der „delfingestützten Therapie“ und weckten dadurch bei den Eltern schwer- und schwerstbehinderter Kinder große Hoffnungen. Und so schossen geradezu zwangsläufig überall auf der Welt innerhalb kürzester Zeit Delfintherapiezentren aus dem Boden, die ihrer Klientel die „Dolphin Human Therapy“ oder eine ähnliche Delfintherapie zu teilweise opulenten Preisen anboten.
In den allermeisten Fällen ist die delfingestützte Therapie eine ziemlich teure Angelegenheit. Auf die Eltern von behinderten Kindern kommen, bei Therapiekosten von manchmal mehreren tausend Euro pro Woche, beträchtliche finanzielle Belastungen zu. Zumal, zumindest in Deutschland, die Krankenkassen die Kosten für eine Delfintherapie nicht übernehmen.
Lange Zeit gab es keine einzige seriöse wissenschaftliche Untersuchung, durch die eine nachhaltige Wirksamkeit der Delfintherapie bestätigt werden konnte.
Eine im Jahr 2006 veröffentlichte Studie, die Wissenschaftler der Universität Würzburg in Kooperation mit dem Delfinarium des Nürnberger Tiergartens durchgeführt hatten, brachte ebenfalls keine eindeutigen Ergebnisse.
Die Studie, an der über 100 Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen teilgenommen hatten, kam zwar zu dem Ergebnis, dass bei schwerbehinderten Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren mithilfe der Delfintherapie „nachgewiesene Therapieeffekte“ erzielt worden seien. Allerdings zeigte sich bei genauerem Hinschauen, dass die in der Studie aufgeführten positiven Effekte vor allem von den Eltern der betroffenen Kinder subjektiv wahrgenommen wurden. Die an der Studie beteiligten Therapeuten jedoch konnten keine messbaren oder nachhaltigen Verbesserungen des Gesundheitszustandes feststellen.
Rund ein Jahr später kam auch eine amerikanische Studie der Emory Universität in Atlanta zu dem Ergebnis, dass ein positiver Effekt von Delfintherapien keineswegs wissenschaftlich belegt sei. Die Leiterin der Studie, die Delfinexpertin und Neurowissenschaftlerin Dr. Lori Marino, kam nach Sichtung der „Fachliteratur“ zu dem Schluss, dass die bisherigen Untersuchungen zur Delfintherapie so eklatante methodische Mängel enthielten, dass eine nachhaltige positive Wirksamkeit nicht nachweisbar sei. Marino wies auch darauf hin, dass die Therapie mit den Meeressäugern für Patienten im Kindesalter nicht ganz ungefährlich ist. Schließlich wurden in den USA über einen Zeitraum von 5 Jahren hinweg immerhin 18 Fälle dokumentiert, bei denen Menschen bei Begegnungen mit in Gefangenschaft lebenden Delfinen schwere Verletzungen, wie etwa Knochenbrüche, davongetragen haben.
Auch die „Urmutter“ der Delfintherapie, die eingangs erwähnte Betsy Smith, wandte sich in einem 2003 veröffentlichten Essay vom Konzept der „Co-Therapeuten mit Flossen“ ab: „Manche Therapeuten, die keinerlei Kenntnisse über Delfine haben, berechnen exorbitante Honorare für Behandlungen, die auch ohne Delfine durchgeführt werden könnten. Im Kern all dieser Therapieprogramme steht die Ausbeutung von verletzlichen Menschen und verletzlichen Delfinen.“
Aber auch vonseiten der Tierschutzverbände hagelt es heftige Kritik an der Delfintherapie: PETA und Co. bemängeln vor allem die wenig artgerechte Haltung der Tiere in den Delfinarien. Die sensiblen Meeressäuger, die in Freiheit am Tag über 100 Kilometer weit schwimmen und über 200 Meter tief tauchen, leiden ganz massiv in den, im Vergleich zu ihrem natürlichen Lebensraum, winzigen Becken, die den Tieren nur wenig Bewegungsfreiraum und schon gar keine Rückzugsmöglichkeiten bieten. Nach Aussagen von Tierschützern sterben viele Delfine vorzeitig an den Folgen dieses Freiheitsentzugs.
Auch die Herkunft der für Therapiezwecke benötigten Delfine ist stark umstritten. Nach Aussagen von Delfintherapiegegnern und Tierschutzorganisationen greifen die Betreiber von „Therapie-Delfinarien“ zwecks mangelnder Nachzucht oft auf Wildfänge zurück, um der starken Nachfrage nach Delfinen für Therapiezwecke gerecht zu werden. Wildfänge, bei denen die Verlustraten bei den Fangaktionen und in den ersten Monaten in Gefangenschaft wegen des gewaltigen Stresses für die Tiere bei rund 50 Prozent liegen. Im Gegenzug weisen Therapiebefürworter darauf hin, dass die Lebenserwartung in Gefangenschaft lebender Delfine deutlich höher sei als bei wildlebenden Tieren und dass zumindest nordamerikanische Delfinarien dank nachhaltiger Nachzucht nicht mehr auf den Fang wildlebender Delfine angewiesen seien.
Übrigens: 2007 veröffentlichte David Nathanson, der eingangs erwähnte „Erfinder“ der „Dolphin Human Therapy“ eine Studie über Therapieversuche an 35 behinderten Kindern mit einem einem Delfin nachempfundenen Roboter. Das Ergebnis der Untersuchung war dann doch verblüffend: Bei 33 der 35 Kinder zeigte sich TAD (Therapeutic Animatronic Dolphin), wie der Roboterdelfin genannt wird, hinsichtlich der Motivation der Kinder seinen lebendigen Artgenossen ebenbürtig oder sogar überlegen!