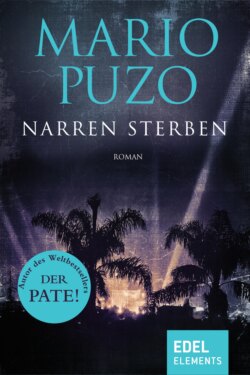Читать книгу Narren sterben - Mario Puzo - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DRITTES BUCH 11
ОглавлениеValeries Vater arrangierte es, daß ich meinen Job nicht verlor. Die Zeit meiner Abwesenheit wurde als Urlaub und Krankenurlaub anerkannt, also bekam ich sogar noch Gehalt für den Monat, den ich in Vegas vergammelt hatte. Aber als ich wieder zum Dienst kam, war der Boss, der Major der regulären Armee war, ein bißchen sauer. Das machte mir aber wenig aus. Wenn man in den Diensten der Bürokratie der Vereinigten Staaten steht, nicht ehrgeizig ist und ein bißchen Demütigung verkraftet, dann hat der Boss keine Macht über einen.
Ich arbeitete als Verwaltungsbeamter, Rang GS-6, bei der Armeereserve. Da sich die Einheiten nur einmal wöchentlich zu Übungen einfanden, war ich für die ganze Verwaltungsarbeit der drei mir zugeteilten Einheiten verantwortlich. Es war ein prima Druckposten. Ich mußte mich um insgesamt sechshundert Männer kümmern, ihre Soldlisten aufstellen, ihre Instruktionen vervielfältigen und all den Mist. Ich mußte die Verwaltungsarbeit der Einheiten, die von Reservisten erledigt wurde, überprüfen. Sie stellten Vorberichte für ihre Treffen zusammen, fertigten Matrizen über Beförderungsfolgen an, bereiteten Texte über Aufgabenverteilung vor. Das Ganze war wirklich keine schwere Arbeit, nicht so schwer jedenfalls, wie es klingen mag, außer wenn die Einheiten für zwei Wochen ins Sommer-Übungslager fuhren. Dann hatte ich zu tun.
Unser Büro war nett. Es gab da noch einen anderen Zivilisten namens Frank Alcore, der älter war als ich und zu einer Reservisteneinheit gehörte, für die er ebenfalls als Verwaltungsangestellter arbeitete. Mit unwiderlegbaren logischen Argumenten überredete mich Frank, ein Schuft zu werden. Ich arbeitete seit zwei Jahren neben ihm und merkte nicht, daß er sich bestechen ließ. Ich fand das erst heraus, als ich von Vegas zurück war.
Das Reservistenkorps der USA war ein großer Schweinetrog. Wenn man nur für zwei Stunden zu einem wöchentlichen Vortrag kam, erhielt man für die ganze Woche den vollen Tagessold bezahlt. Ein Offizier konnte dabei über zwanzig Dollar pro Tag machen. Ein Gemeiner mit langer Dienstzeit und Seniorität zehn. Zuzüglich Pensionsberechtigung. Und in den zwei Stunden saß man sich einfach durch Instruktionen hindurch oder schlief während einer Filmvorführung ein.
Die meisten Zivilbeamten ließen sich in die Armeereserve aufnehmen. Außer mir. Mein Zauberer hatte erspäht, daß es da eine Chance von eins zu tausend gab, draufzuzahlen: daß vielleicht ein neuer Krieg kommen und man die Reservisten als erste in die reguläre Armee berufen würde.
Alle dachten, ich sei verrückt. Frank Alcore flehte mich an mitzumachen. Ich war drei Jahre lang im Weltkrieg Gemeiner gewesen, aber er sagte, er könnte mich zum Feldwebel machen lassen, weil ich als Zivilist soviel Erfahrung in der Heeresverwaltung hätte. Es müsse doch ein Vergnügen sein, die Pflicht seinem Land gegenüber zu erfüllen und dafür den doppelten Sold zu bekommen. Ich hingegen verabscheute die Vorstellung, wieder Befehle erteilt zu bekommen, und sei es nur für zwei Stunden in der Woche und zwei Wochen im Sommer. Als gewöhnlicher Angestellter hatte ich die Anweisungen meines Vorgesetzten zu befolgen. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Befehlen und Anweisungen.
Jedesmal wenn ich in Zeitungen Berichte über die gutausgebildeten Reservisten in unserem Land las, mußte ich den Kopf schütteln. Über eine Million Männer, die da ihre Zeit vergammelten. Ich fragte mich, warum man den ganzen Laden nicht einfach auflöste. Aber eine ganze Anzahl kleinerer Orte war abhängig vom Sold der Reservisten, damit ihre Wirtschaft florierte. Und eine ganze Menge Politiker in den Bundesstaaten und im Kongreß waren Reservisten in hohen Rängen und steckten dafür ein hübsches Bündel Scheine ein.
Und dann geschah etwas, das mein ganzes Leben veränderte, wohl nur für eine kurze Zeit veränderte, aber dafür zum Besseren, wirtschaftlich und psychologisch gesehen. Ich wurde ein kleiner Gauner. Dank der Militärstruktur in den Vereinigten Staaten.
Bald nachdem ich aus Vegas zurückgekehrt war, wurde den jungen Männern in Amerika klar, daß sie, wenn sie sich nach dem gerade verabschiedeten neuen Gesetz für sechs Monate zum aktiven Dienst in der Reserve verpflichteten, dabei achtzehn Monate Freiheit gewinnen konnten. Junge Männer, denen die Einberufung bevorstand, meldeten sich einfach für das Reservistenprogramm der Armee und taten dann bloß sechs Monate Dienst in der regulären Armee der USA. Danach gehörte man fünfeinhalb Jahre zu den Reservisten. Und das bedeutete, daß man einmal wöchentlich zu einem zweistündigen Vortrag gehen und einmal im Sommer in einem Camp aktiv Dienst schieben mußte. Wenn man dagegen auf die Einberufung wartete, diente man zwei volle Jahre und landete vielleicht in Korea.
Aber bei den Reservisten gab es eben nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen. Hunderte junger Männer meldeten sich für jeden freien Platz, und Washington mußte ein System der Kontingentierung einführen. Die Einheiten, mit denen ich zu tun hatte, erhielten eine Quote von dreißig pro Monat, und wer zuerst kam, wurde genommen.
Schließlich hatte ich eine Liste von fast tausend Namen. Ich betreute die Liste verwaltungsmäßig, und ich tat dies korrekt. Meine Chefs, der Ausbilder von der regulären Armee und ein Reserveoberstleutnant, der die Einheiten kommandierte, hatten die offizielle Verantwortung. Manchmal schoben sie einen ihrer Favoriten an die Spitze der Liste. Wenn sie mir das auftrugen, protestierte ich nie dagegen. Im Grunde war es mir scheißegal. Ich arbeitete an meinem Buch. Die Zeit, die ich für diesen Job verschwendete, war bloß dazu gut, daß ich mein Geld bekam.
Dann zogen sie die Schraube an. Mehr und mehr junge Männer wurden eingezogen. Kuba und Vietnam lagen noch in ferner Zukunft. Ungefähr um diese Zeit merkte ich, daß da irgend etwas stank. Und es mußte etwas schon sehr stinken, damit ich es merkte, denn ich interessierte mich absolut nicht für meinen Job und das Drumherum.
Frank Alcore war älter, verheiratet und hatte zwei Kinder. Im Dienstrang waren wir gleich, aber wir arbeiteten selbständig, er hatte seine Einheiten, ich die meinen. Wir verdienten beide gleich viel, so um die hundert Böcke monatlich, aber er war Hauptfeldwebel bei den Reservisten und machte pro Jahr zusätzlich einen Riesen. Und er konnte trotzdem in einem neuen Buick zum Dienst anfahren und ihn in einer Garage nebenan parken, was drei Dollar am Tag kostete. Er wettete bei allen Ballspielen, Football, Basketball und Baseball, und ich wußte, was das kostete. Ich fragte mich, woher zum Teufel er das Geld nahm. Ich bohrte ihn darauf an, und er kniff ein Auge zu und sagte, er könne eben die Sieger erraten. Er treibe seinen Buchmacher in den Ruin. Nun, darin kannte ich mich aus, das war mein Gebiet – und ich wußte, daß er einfach Scheiße erzählte. Und dann lud er mich eines Tages in ein gutes italienisches Restaurant auf der Ninth Avenue ein und deckte sein Blatt auf.
Nach dem Lunch, beim Kaffee, fragte er: „Merlin, wie viele Burschen ziehen Sie monatlich ein? Welche Quote hat Ihnen Washington gegeben?“
„Im letzten Monat dreißig“, sagte ich. „Es schwankt zwischen fünfundzwanzig und vierzig, je nachdem wie viele abgehen.“
„Die Platznummern sind bares Geld wert“, sagte Frank. „Damit kann man ’ne ganze Stange verdienen.“
Ich gab keine Antwort. Er redete weiter. „Geben Sie mir nur fünf von Ihren freien Plätzen im Monat ab“, sagte er. „Und ich gebe Ihnen einhundert Böcke für jeden.“
Ich war nicht in Versuchung. Fünfhundert Böcke im Monat, das wäre für mich hundert Prozent mehr Einkommen gewesen. Aber ich schüttelte den Kopf und sagte ihm, er solle es vergessen. Selbstbewußtsein hatte ich genug. Seit ich erwachsen war, hatte ich niemals etwas Unehrenhaftes getan. Es war unter meiner Würde, ein kleiner Korruptionist zu werden. Schließlich war ich Künstler, ein großer Romanschriftsteller, der darauf wartete, berühmt zu werden. Und unehrlich zu sein, das würde bedeuten, daß man ein mieser kleiner Schuft war. Damit hätte ich das narzißstische Bild, das ich von mir selbst hegte, beschmutzt. Es spielte für mich keine Rolle, daß meine Frau und meine Kinder fast am Hungertuch nagten. Es spielte keine Rolle, daß ich nachts einen zweiten Job hatte annehmen müssen, damit wir über die Runden kamen. Ich war der geborene Held. Anderseits reizte mich die Vorstellung zum Lachen, daß diese Jungen Geld bezahlten, um in die Armee zu kommen.
Frank gab nicht auf. „Sie laufen kein Risiko dabei“, sagte er. „Diese Listen kann man türken. Es gibt kein Original. Und Sie brauchen von den Burschen kein Geld entgegenzunehmen oder mit ihnen zu verhandeln. Das mache alles ich. Sie schreiben Sie nur einfach auf die Liste, wenn ich okay sage. Dann händige ich Ihnen direkt das Geld aus.“
Nun, wenn er mir einhundert geben wollte, dann mußte er wohl zweihundert bekommen. Und ich hatte so etwa fünfzehn Plätze selbst zur Verfügung, und bei zweihundert Böcken für jeden machte das drei Riesen im Monat. Was ich mir nicht klarmachte, war, daß er die fünfzehn Plätze nicht allein für sich benutzen konnte. Die Kommandeure seiner Einheiten hatten auch ihre Leute, um die sie sich kümmern mußten. Führende Politiker, Kongreßabgeordnete, Senatoren der Bundesregierung schickten junge Leute, die der Einberufung entgehen sollten. Sie stahlen Frank das Futter vor der Nase weg, und er war echt sauer darüber. Er konnte einfach nur fünf Plätze pro Monat absetzen. Aber immerhin, ein Riese monatlich und steuerfrei? Und immer noch sagte ich nein.
Es gibt unendlich viele Entschuldigungen dafür, daß man schließlich doch zum Schwein wird. Ich besaß eine hohe Meinung von mir selbst. Daß ich ehrenhaft sei und niemals meine Mitmenschen belüge oder betrüge. Daß ich niemals etwas Schäbiges tun würde nur des Geldes wegen. Ich glaubte, ich sei wie mein Bruder Artie. Aber Artie war ehrenhaft bis auf die Knochen. Er hätte niemals auf die schiefe Bahn geraten können. Er erzählte mir oft Geschichten, was für Druck man in seinem Tätigkeitsbereich auf ihn auszuüben versucht habe. Als Chemiker der Bundesbehörde zur Überwachung der Pharmaindustrie und der Nahrungsmittelindustrie hatte er eine relative Machtposition inne. Er verdiente ziemlich gut, doch wenn er seine Untersuchungen durchführte, lehnte er eine Menge Medikamente ab, die die anderen Chemiker der Bundesbehörde hatten durchgehen lassen. Dann machten sich die Pharmagiganten an ihn heran und gaben ihm zu verstehen, daß sie Stellungen anzubieten hätten, in denen er eine ganze Menge mehr Geld verdienen könnte, als er sich je träumen ließe. Wenn er ein bißchen nachgiebiger wäre, könnte er seinen Weg in der Welt machen. Artie ließ sie einfach abfahren. Dann wurde eines der Medikamente, das er abgelehnt hatte, über seinen Kopf hinweg doch erlaubt. Ein Jahr später mußte die Entscheidung widerrufen und das Mittel aus dem Handel gezogen werden, weil es bei den Patienten schwere toxische Schäden hervorrief und einige daran sogar gestorben waren. Die ganze Sache landete in den Zeitungen, und Artie war für kurze Zeit ein Held. Er wurde sogar in den höchsten Beamtenrang befördert. Aber man machte ihm auch klar, daß er niemals würde höher aufsteigen können. Daß er nie Leiter der Behörde werden könne, weil es ihm an Verständnis für die politischen Notwendigkeiten fehle. Es war ihm egal, und ich war stolz auf ihn.
Daß ich ein ehrenwertes Leben führen wollte, war der große Hemmschuh in mir. Ich schmeichelte mir, ein realistischer Mensch zu sein, darum erwartete ich auch nicht von mir, daß ich vollkommen sei. Aber wenn ich etwas Mieses tat, dann konnte ich das nicht akzeptieren oder mich darüber hinwegtäuschen, und meistens wiederholte ich ein derart mieses Verhalten hinterher auch nicht wieder. Doch es fehlte nicht an Enttäuschungen, die ich mir selbst, was meine Ehrenhaftigkeit betraf, zufügte, weil es so viele beschissene Sachen gibt, die man als Mensch anstellen kann. Immer wieder überraschte ich mich in negativer Hinsicht.
Jetzt mußte ich mir die Vorstellung aufschwatzen, ein Miesling zu werden. Ich wollte gern ehrlich sein, weil ich mich wohler fühlte, wenn ich die Wahrheit sagte, als wenn ich log. Es war mir angenehmer, unschuldig zu sein als schuldig. Das kam aus langer Überlegung. Es war ein praktischer, kein romantischer Wunsch. Wenn ich mich als Dieb wohler gefühlt hätte, dann wäre ich einer geworden. Aus diesem Grund war ich jenen gegenüber, die es waren, tolerant. Schließlich, sagte ich mir, war das ihr Metier und nicht notwendigerweise ein moralischer Entschluß. Ich behauptete, Moral habe dabei nichts zu suchen. Aber eigentlich glaubte ich meiner Behauptung nicht. Im Innersten glaubte ich an Gut und Böse als Wertmaßstäbe.
Und dann, um die Wahrheit zu sagen, stand ich immer im Wettbewerb mit anderen Männern. Und deshalb wollte ich der bessere Mann, der bessere Mensch sein. Es befriedigte mich, daß ich nicht geldgierig war, während andere sich für Geld erniedrigten. Daß ich Ruhm verachtete, Frauen gegenüber anständig war, bewußt meine Unschuld bewahrte. Es bereitete mir Freude, die Motive anderer nicht zu beargwöhnen und ihnen in fast jeder Beziehung zu vertrauen. Aber die Wahrheit ist, daß ich mir selber nie so recht traute. Es war eine Sache, ehrlich zu sein, und eine andere, sich tollkühn in ein Risiko zu stürzen.
Kurz, ich wollte lieber betrogen sein, als jemanden zu betrügen; ich wollte lieber übers Ohr gehauen sein, als selbst übers Ohr zu hauen; ich akzeptierte bereitwillig, daß man mich ausnahm, solange ich nicht selbst andere ausnahm. Ich zog es vor, beschwindelt zu werden, als bei meiner Arbeit ein Schwindler zu sein. Und ich begriff natürlich, daß dies eine Art Schild war, hinter dem ich mich versteckte, und keineswegs eine bewundernswerte Haltung. Die Welt konnte mir nicht weh tun, solange sie mir keine Schuldgefühle aufhalste. Wenn ich eine gute Meinung von mir hatte, was spielte es dann für eine Rolle, wenn andere schlecht von mir dachten? Natürlich funktionierte das nicht immer. Meine Rüstung ließ Blößen offen. Und im Lauf der Jahre unterliefen mir ein paar Fehltritte.
Und doch – und doch, ich hatte das leise Gefühl, diese Einstellung selbstgefälliger Selbstgerechtigkeit sei irgendwie ein zutiefst raffiniertes mieses Verhalten. Daß mein Moralgefühl auf einem Fundament von eiskaltem Stein ruhe. Daß es für mich im Leben eben nichts gebe, was ich mir so sehr ersehnte, daß ich mich dafür korrumpieren hätte lassen. Das einzige, was ich mir ersehnte, war, ein großes Kunstwerk zu schaffen. Dies aber nicht des Ruhmes oder des Geldes oder der Position wegen – jedenfalls dachte ich so —, sondern nur, um der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Ach ja. Einmal, als ich ein Halbwüchsiger war, von Schuldgefühlen und der Überzeugung meiner Wertlosigkeit bedrängt und hoffnungslos mit der ganzen Welt verfeindet, kam mir Dostojewskis „Brüder Karamasow“ unter die Augen. Dieses Buch veränderte mein Leben. Es gab mir Kraft. Es ließ mich die verletzliche Schönheit aller Menschen erkennen, wie verachtenswert sie auch äußerlich sein mochten. Und ich habe den Tag niemals vergessen, an dem ich das Buch schließlich in die Bibliothek des Waisenhauses zurückbrachte und dann hinauswanderte in das zitronengelbe Sonnenlicht eines Herbsttages. Damals war es gewesen, daß ich zum erstenmal ein Gefühl der Gnade in mir spürte.
Also wollte ich nur eines wirklich, ein Buch schreiben, bei dem sich die Menschen so fühlen sollten wie ich an jenem Tag. Für mich bedeutete dies äußerste Machtausübung. Die reinste Form derselben. Als dann mein erster Roman gedruckt wurde, eine Arbeit, an der ich fünf Jahre lang geschuftet hatte, für die ich große Opfer auf mich genommen hatte, um sie ohne jeden künstlerischen Kompromiß publizieren zu können, las ich in der ersten Kritik, der Roman sei schmutzig, degeneriert, ein Buch, das nie hätte geschrieben werden dürfen, und wenn es schon geschrieben worden sei, so hätte es doch niemals veröffentlicht werden dürfen.
Das Buch brachte nur ganz wenig Geld. Aber es wurde in manchen Kritiken in den Himmel gelobt. Man war einhellig der Meinung, ich hätte ein echtes Kunstwerk verfaßt, und wirklich, bis zu einem gewissen Grad hatte ich meinen Ehrgeiz befriedigt. Einige Menschen schrieben mir Briefe, wie ich sie vielleicht Dostojewski geschrieben haben würde. Aber ich merkte, daß der Trost, den diese Briefe brachten, das Gefühl der Zurückweisung nicht aufwiegen konnte, das der finanzielle Mißerfolg mir verursachte.
Ich hatte eine andere Idee für einen wirklich großen Roman, sozusagen mein persönliches „Schuld und Sühne“. Mein Verleger weigerte sich, mir dafür einen Vorschuß zu geben. Keiner wollte mir einen geben. Ich brach die Arbeit daran ab. Die Schulden häuften sich. Meine Familie lebte in armseligen Umständen. Meine Kinder bekamen nie, was andere Kinder hatten. Meine Frau, für die ich verantwortlich war, mußte sämtliche materiellen Freuden unserer Gesellschaft entbehren, usw., usw. Darum war ich nach Vegas gefahren. Und darum konnte ich nicht schreiben. Jetzt wurde mir alles klar: Um der Künstler und der gute Mensch zu werden, der zu sein mein ganzes Streben war, mußte ich mich eine Weile lang bestechen lassen. Man kann sich selber alles einreden.
Dennoch brauchte Frank Alcore ein halbes Jahr, bis er mich rumkriegen konnte, und da hatte er außerdem noch Glück. Frank ging mir unter die Haut, weil er der vollkommene Spielertyp war. Wenn er seiner Frau irgend etwas schenkte, dann war das immer etwas, das er beim Pfandleiher unterbringen“ konnte, falls er mal kein Geld flüssig hatte. Und was ich besonders an ihm bewunderte, das war die Art und Weise, wie er sein Scheckbuch benützte.
An den Samstagen ging Frank regelmäßig und kaufte die Sachen für die Familie ein. Alle Geschäftsinhaber in der Nachbarschaft kannten ihn und nahmen seine Schecks entgegen. Beim Fleischer kaufte er nur das feinste Kalbfleisch und Rindfleisch und gab saftige vierzig Dollar dafür aus. Er gab dem Metzger einen Scheck über hundert Dollar und bekam sechzig zurück. Und beim Feinkostladen und dem Gemüsehändler war es genau die gleiche Geschichte. Sogar im Getränkeshop. Bis Samstagmittag hatte er so etwa zweihundert Dollar Wechselgeld aus seinen Einkäufen beisammen, und die setzte er auf die Baseball-Spiele. Auf seinem Konto lag kein Penny als Deckung. Wenn er am Samstag verlor, bekam er bei seinem Buchmacher Kredit, damit er auf die Spiele am Sonntag setzen könne, und verdoppelte die Einsätze. Wenn er gewann, raste er am Montagmorgen zur Bank und deckte die Schecks. Wenn er verlor, ließ er sie einfach platzen. Und während der folgenden Woche wieselte er Bestechungsgelder für junge Wehrdienstverweigerer heraus, die er für die halbjährige Dienstzeit einreihte, und deckte damit die Schecks, wenn sie zum zweitenmal präsentiert wurden.
Frank nahm mich oft zu den Abendspielen mit, und er bezahlte für alles, sogar für die Hot-dogs. Er war von Natur aus großzügig, und wenn ich zu bezahlen versuchte, schubste er mich einfach weg und sagte irgendwas in der Richtung: „Ehrliche Leute können es sich nicht leisten, gute Kerle zu sein.“ Mit ihm zusammen zu sein war immer angenehm, sogar bei der Arbeit. Während der Mittagspause spielten wir oft Gin-Rubber, und ich knöpfte ihm gewöhnlich ein paar Dollar ab, nicht weil ich mit den Karten besser war, sondern weil er seine Gedanken bei den Sportwetten hatte.
Es gibt für jeden Entschuldigungen dafür, daß er seinen moralischen Standard aufgibt. Alle Wahrheit aber ist, daß man sich aufgibt, wenn man dazu bereit ist. Eines Morgens kam ich zur Arbeit im Arsenal, und im Flur vor meinem Büro saßen Massen von jungen Männern, die sich für die halbjährige Dienstzeit einschreiben lassen wollten. Es war ein fürchterliches Gedränge, und in allen acht Etagen wurden eifrigst Aufnahmeformulare ausgefüllt und bearbeitet. Das Arsenal war eines jener alten Gebäude, die man errichtet hatte, damit ganze Batallione darin herummarschieren könnten. Jetzt war jeweils die Hälfte jedes Stockwerks für Lagerräume, Unterrichtszimmer und unsere Verwaltungsbüros vom übrigen abgetrennt worden.
Mein erster „Kunde“ war ein kleiner alter Mann, der einen Burschen von etwa einundzwanzig Jahren mitgebracht hatte, der sich bewarb. Er stand auf meiner Liste ganz unten.
„Es tut mir leid, aber wir können Sie bestenfalls in sechs Monaten annehmen“, sagte ich.
Der alte Knabe hatte auffallend blaue Augen, aus denen Kraft und Selbstvertrauen leuchteten. „Sie fragen mal besser bei ihrem Vorgesetzten nach“, sagte er.
In diesem Moment sah ich, daß mein Vorgesetzter, der Major der regulären Armee, wie wild durch die Glastrennwand Zeichen zu mir herüber machte. Ich stand auf und ging in sein Büro. Der Major hatte in Korea und im Zweiten Weltkrieg gedient, und seine Brust war voller Bändchen und Auszeichnungen. Er schwitzte Blut und Wasser vor Nervosität.
„Hören Sie“, sagte ich, „der Alte hat gesagt, ich soll mit Ihnen reden. Er will, daß sein Knabe vor allen anderen auf der Liste rangieren soll. Ich hab’ ihm gesagt, daß ich das nicht tun kann.“
Der Major sagte wütend: „Tun Sie alles, was er von Ihnen verlangt. Der alte Mann ist im Kongreß.“
„Und was mache ich mit der Liste?“ fragte ich.
„Scheiß auf die Liste“, sagte der Major.
Ich ging zu meinem Schreibtisch und dem Kongreßabgeordneten und seinem jungen Protegé zurück. Ich begann die Einberufungsformulare auszufüllen. Jetzt erkannte ich den Namen des jungen Mannes. Eines Tages würde er mehr als hundert Millionen Böcke wert sein. Seine Familie blickte auf eine der größten Erfolgsstories in der amerikanischen Geschichte zurück. Und hier hockte er in meinem Büro und wollte in das Sechsmonateprogramm, um sich den zweijährigen Dienst als aktiver Eingezogener zu ersparen.
Der Kongreßmann verhielt sich tadellos. Er war nicht großspurig und rieb mir auch nicht Salz in die Wunden, weil seine Macht und sein Einfluß es fertiggebracht hatten, daß ich gegen die Verordnungen handelte. Er sprach ruhig und freundlich, genau im rechten Ton. Es war bewundernswürdig, wie er mich manipulierte. Er versuchte mir das Gefühl zu geben, daß ich ihm einen Gefallen erwies, und fügte hinzu, wann immer er irgendwas für mich tun könne, solle ich einfach sein Büro anrufen. Der Junge machte den Mund nicht auf, außer um meine Fragen zu beantworten, während ich das Dienstverpflichtungsformular ausfüllte.
Ich allerdings war ein bißchen sauer. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte keine moralischen Einwände gegen den Einsatz von Macht und die damit verbundenen Ungerechtigkeiten. Es war bloß so, daß sie mich einfach überfahren hatten und ich nichts dagegen tun konnte. Vielleicht auch, weil der Knabe so enorm reich war. Warum konnte der nicht in der Armee zwei Jahre seinem Lande dienen, das seiner Familie so viel Gutes beschert hatte?
Darum schmuggelte ich eine kleine Stolperwelle in sein Formular ein, von der sie keine Ahnung haben konnten. Ich gab dem Knaben eine MOS-Empfehlung. MOS bedeutet Military Occupational Speciality, der besondere Dienst in der Armee, für den er ausgebildet werden würde. Ich empfahl ihn für eine der wenigen elektronischen Spezialeinheiten bei uns. Damit stellte ich eigentlich sicher, daß dieser Kerl einer der ersten sein würde, die zum aktiven Dienst aufgerufen werden würden, falls es irgendeinen nationalen Notstand geben sollte. Es war ein Schuß ins Blaue, aber immerhin.
Der Major kam heraus und nahm dem Knaben den Eid ab, in dem dieser unter anderem zu beschwören hatte, daß er nicht zur Kommunistischen Partei oder einer ihrer Deckorganisationen gehöre. Dann schüttelte man sich ringsum die Hände. Der Knabe hatte sich unter Kontrolle, bis er und der Kongreßabgeordnete mein Büro verließen. Dann lächelte er den Kongreßmann sanft an.
Dieses Lächeln war wie das eines Kindes, wenn es seinen Eltern oder anderen Erwachsenen einen Trick gespielt hat und damit durchgekommen ist. Ein solches Lächeln ist widerlich auf den Gesichtern von Kindern. Und hier war es das noch mehr. Ich wußte, daß dieses Lächeln nicht automatisch ein mieses Kind aus dem Jungen machte, aber es bedeutete für mich die Absolution dafür, daß ich ihm den Streich mit dem MOS gespielt hatte.
Frank Alcore hatte die ganze Szene von seinem Schreibtisch gegenüber mitverfolgt. Er verschwendete keine Zeit. „Wie lang wollen Sie eigentlich noch ein Trottel bleiben?“ fragte er. „Der Kongreßmensch hat Ihnen hundert Böcke aus der Brieftasche geklaut. Und der Himmel weiß, wieviel er dabei verdient hat. Tausende. Wenn der Junge zu unserer Einheit gekommen wäre, hätte ich ihm mindestens fünfhundert abzapfen können.“ Er war regelrecht empört. Und das machte mich lachen.
„Ach, Sie nehmen die Dinge nicht ernst genug“, sagte Frank. „Sie könnten ’ne Menge mehr Geld verdienen und die meisten Ihrer Probleme regeln, wenn Sie bloß zuhören würden.“
„Das ist nichts für mich“, sagte ich.
„Okay, okay“, sagte Frank. „Aber Sie müssen mir ’nen Gefallen tun. Ich brauch’ dringend einen freien Platz. Sehen Sie den Rotkopf an meinem Schreibtisch? Der geht bis fünfhundert, weil er jeden Tag damit rechnet, eingezogen zu werden. Und ist das einmal passiert, dann kommt er nicht mehr für das Sechsmonateprogramm in Frage. Widerspricht den Vorschriften. Darum muß ich ihn heute noch verpflichten. Und ich habe nicht einen Platz in meiner Einheit frei. Ich möchte, daß Sie ihn bei Ihnen unterbringen, und wir teilen uns den Zaster. Nur dieses eine Mal.“
Es klang richtig verzweifelt, darum sagte ich: „Okay, schicken Sie mir den Jungen rüber. Aber Sie behalten das Geld. Ich will’s nicht haben.“
Frank nickte. „Danke. Ich hebe Ihren Anteil auf. Bloß für den Fall, daß Sie Ihre Meinung ändern.“
Am gleichen Abend stellte mir Valerie mein Abendessen hin, und ich spielte mit den Kindern, bevor sie ins Bett mußten. Später sagte Vallie, daß sie hundert Dollar für die Kleidung und die Schuhe der Kleinen für Ostern brauchen würde. Sie sagte kein Wort über ein Kleid für sich selbst, obwohl für sie, wie für alle Katholiken, neue Kleidung zu Ostern fast ein religiöses Muß war.
Am nächsten Morgen kam ich in unser Büro und erklärte Frank: „Hören Sie, ich nehme meinen Anteil. Ich habe meine Meinung geändert.“
Frank tippte mir auf die Schulter. „Braver Junge“, sagte er. Er schob mich in die Männertoilette, wo wir allein waren, und zählte mir fünf Fünfzigdollarscheine hin. „Ich hab’ noch einen anderen Kunden vor dem Wochenende.“ Ich gab ihm keine Antwort.
Dies war nun das einzige Mal in meinem Leben, daß ich etwas wirklich Unanständiges getan hatte. Und ich fühlte mich gar nicht so schlecht. Zu meiner Überraschung fühlte ich mich sogar großartig. Ich war voller Lebensfreude, und auf dem Heimweg kaufte ich für Vallie und die Kleinen Geschenke. Als ich daheim ankam und Vallie die hundert Dollar für die Kleider für die Kinder gab, merkte ich, wie erleichtert sie war, daß sie nicht ihren Vater um das Geld würde bitten müssen. In dieser Nacht schlief ich besser als seit vielen Jahren.
Ich stieg selber ins Geschäft ein, ohne Frank. Meine Persönlichkeit begann sich radikal zu verändern. Es war faszinierend, ein Ganove zu sein. Das holte meine besten Züge aus mir heraus. Ich spielte nicht mehr, und ich gab sogar das Schreiben auf; ja, ich verlor wirklich das Interesse an dem neuen Roman, an dem ich geschrieben hatte. Zum erstenmal in meinem Leben konzentrierte ich mich völlig auf meine Arbeit für die Bundesbehörde.
Ich begann die dicken Ordner mit den Armeevorschriften zu studieren, suchte nach allen Gesetzeslücken, durch die Einberufene dem Militärdienst entgehen konnten. Als erstes lernte ich, daß die medizinischen Maßstäbe willkürlich verändert wurden. Ein Junge, der die ärztliche Untersuchung nicht bestand und dienstuntauglich gestellt wurde, passierte sechs Monate später ganz leicht den Check-up. Es hing nur davon ab, welche Einziehungsquoten Washington aufstellte, möglicherweise auch von den zugewiesenen Mitteln aus dem Budget. Es gab da Klauseln, daß jeder, der wegen geistiger Störungen einer Schockbehandlung unterzogen worden war, aus körperlichen Gründen nicht eingezogen werden konnte. Desgleichen Homosexuelle. Ebenso wenn einer irgendeinen technischen Job in der Privatindustrie innehatte, der ihn als zu wertvoll für einen Soldaten qualifizierte.
Dann studierte ich meine „Kunden“. Sie waren meist zwischen achtzehn und fünfundzwanzig Jahren alt, und die heißen Jahrgänge waren die der Zweiundzwanzig- und Dreiundzwanzigjährigen. Letztere kamen gerade aus dem College und brachen fast zusammen, weil sie zwei Jahre in der Armee verschwenden sollten. Sie drängten sich wie wild zu den Reservisten, damit sie nur sechs Monate Dienst abzureißen brauchten.
Diese Knaben hatten alle Geld, oder sie kamen aus Familien mit Geld. Sie hatten sich alle auf gehobene Berufe vorbereitet. Einmal würden sie die obere Mittelklasse darstellen, die Reichen, die führenden Persönlichkeiten auf vielen Gebieten des American way of life. In Kriegszeiten würden sie sich darum gerissen haben, in die Schule der Offizierskadetten aufgenommen zu werden. Jetzt waren sie es zufrieden, Bäcker zu werden, Spezialisten für Uniformreparaturen oder Hilfskräfte für Lastwagenreparaturen. Einer von meinen Knaben, fünfundzwanzig Jahre alt, hatte einen Sitz an der New-Yorker Börse. Wiederum ein anderer war Spezialist für Wertpapiere. In jenen Tagen wimmelte es in der Wall Street von neuen Aktien, die sofort um zehn Punkte stiegen, sobald sie ausgegeben waren, und diese beiden Kinder wurden reich dabei. Das Geld rollte ihnen nur so vor die Füße. Sie bezahlten mich, und ich zahlte meinem Bruder Artie die paar tausend Riesen zurück, die ich ihm schuldete. Er war überrascht und ein kleines bißchen neugierig. Ich sagte ihm, ich hätte plötzlich Glück im Spiel gehabt. Und das war eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich ihn belog.
Frank wurde mein Berater. „Seien Sie vorsichtig mit diesen Knülchen“, sagte er. „Das sind richtige Halsabschneider. Hauen Sie ihnen in die Fresse, und sie werden Sie mehr respektieren.“
Ich zuckte die Schulter. Ich begriff seine feinen moralischen Unterscheidungen nicht.
„Die sind doch nur ein beschissener Haufen heulender Mammababys“, sagte Frank. „Wieso können die denn nicht auch ihre zwei Jahre für ihr Land opfern, statt sich mit diesem Scheiß von sechs Monaten zu drücken? Sie und ich, wir haben im Krieg gekämpft, für unser Land, und wir haben einen Scheißdreck dafür bekommen und schulden keinem was. Für diese Typen hat unser Land ’ne Menge getan. Ihre Familien sind alle begütert. Sie haben gute Jobs und herrliche Zukunftsaussichten. Wir sind arm. Und diese Ratten wollen nicht einmal ihren Militärdienst ableisten.“
Sein Ärger erstaunte mich, weil er sonst immer so freundlich und sanft war und niemals jemandem eine scharfe Bemerkung entgegenschleuderte. Und ich wußte, daß sein Patriotismus echt war. Als Hauptfeldwebel der Reservisten war sein moralisches Gewissen ausgesprochen wach, nur als Beamter war er ein Gauner.
Es fiel mir in den folgenden Monaten nicht schwer, mir einen Kundenstamm aufzubauen. Ich fertigte zwei Listen an: die eine war die offizielle Warteliste, die andere meine private Liste von Leuten, die mich bestechen würden. Ich hütete mich, allzu gierig zu werden. Ich verwendete zehn Plätze für meine bezahlte Liste und zehn aus der offiziellen Liste. Und ich machte meinen Tausender im Monat präzise wie ein Uhrwerk. Tatsächlich fingen meine Kunden an zu bieten, und meine Preise stiegen rasch auf dreihundert Dollar. Ich fühlte mich beschissen, wenn ein armer Junge zu mir kam, weil ich wußte, er würde auf der offiziellen Liste niemals so weit nach oben kommen, bevor sie ihn einziehen würden. Das ging mir dermaßen auf die Nerven, daß ich schließlich die offizielle Liste überhaupt nicht mehr beachtete. Ich ließ pro Monat zehn Burschen heftig zahlen, und zehn andere durften dafür umsonst rein. Kurz, ich übte Macht aus, und das hatte ich früher als für nicht akzeptabel gehalten. Und ich fühlte mich gar nicht schlecht dabei.
Ich wußte es damals noch nicht, aber ich schuf mir ein richtiges Korps von Freunden in meinen Einheiten, die mir später dabei halfen, meine Haut zu retten. Außerdem stellte ich eine weitere Regel auf. Jeder, der Künstler, Schriftsteller, Schauspieler oder künftiger Theaterregisseur war, kam umsonst rein. Das war mein Zehent, weil ich selbst nicht mehr schrieb, kein Verlangen verspürte zu schreiben und mich deswegen auch noch schuldig fühlte. Tatsächlich häufte ich Schuldgefühle fast so schnell auf wie Geld. Und ich büßte für meine Schuld auf die klassische amerikanische Weise, indem ich Gutes tat.
Frank kanzelte mich wegen meines mangelnden Geschäftsgeistes ab. Ich sei ein zu netter Kerl, ich müsse härter werden, oder alle würden sie mich ausnutzen. Aber er irrte sich. Ich war kein so netter Kerl, wie er sich das vorstellte oder wie die übrigen dachten.
Ich war vorausblickend. Selbst mit einem Minimum an Intelligenz war mir klar, daß diese Gaunereien eines Tages auffliegen mußten. Es waren zu viele Leute darin verwickelt. Hunderte Zivilisten in ähnlichen Stellungen wie ich ließen sich bestechen. Tausende Reservisten wurden in das Sechsmonateprogramm aufgenommen, nachdem sie ein beträchtliches Eintrittsgeld bezahlt hatten. Für mich hatte nach wie vor die Tatsache einen gewissen Reiz, daß jeder bezahlte, um in die Armee zu gelangen. Eines Tages kam ein etwa fünfzigjähriger Mann mit seinem Sohn zu mir. Ein wohlhabender Geschäftsmann, der Sohn Rechtsanwalt, der sich gerade eine Kanzlei aufbaute. Der Vater hatte einen Stoß Briefe von Politikern mit. Er sprach mit dem Major vom regulären Dienst, dann kam er am Abend, an dem unsere Vorträge stattfanden, wieder und sprach mit dem Oberst der Reserve. Sie waren ihm gegenüber sehr höflich, aber sie schickten ihn zu mir, indem sie sich auf den üblichen Quotenquatsch beriefen. Also kam der Vater zu mir an den Schreibtisch, damit ich seinen Sohn in die offizielle Warteliste eintragen könnte. Er hieß Hiller, der Sohn mit Vornamen Jeremy.
Mr. Hiller steckte im Automobilgeschäft, er war ein Großhändler für Cadillac. Ich ließ seinen Sohn den üblichen Fragebogen ausfüllen, und wir plauderten.
Der junge Mann sagte gar nichts, er wirkte verlegen. Mr. Hiller fragte: „Wie lange wird er nach dieser Liste warten müssen?“
Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und gab die übliche Antwort: „Sechs Monate.“
„Dann ziehen sie ihn vorher ein“, sagte Mr. Hiller. „Ich würde Ihnen außerordentlich verbunden sein, wenn Sie was für ihn tun könnten.“
Wieder gab ich ihm meine übliche Antwort: „Ich bin hier nur ein kleiner Angestellter“, sagte ich. „Die einzigen Leute, die Ihnen helfen können, sind die Offiziere, mit denen Sie bereits gesprochen haben. Oder Sie könnten es bei Ihrem Kongreßabgeordneten versuchen.“
Er warf mir einen langen, schlauen Blick zu, dann holte er seine Geschäftskarte hervor. „Wenn Sie jemals einen Wagen kaufen wollen, kommen Sie zu mir, ich besorg’ ihn Ihnen zum Einkaufspreis.“
Ich sah mir die Karte an und lachte. „An dem Tag, an dem ich mir einen Cadillac kaufen kann, brauche ich hier nicht mehr zu arbeiten“, sagte ich.
Mr. Hiller schenkte mir ein nettes, freundliches Lächeln.
„Ich glaube, da haben Sie recht“, sagte er. „Aber wenn Sie mir helfen können, wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar.“
Am nächsten Tag erhielt ich einen Anruf von Mr. Hiller. Er war ganz von jener falschen Freundlichkeit der Vertreter. Er fragte nach meiner Gesundheit, wie es mir gehe, und bemerkte, was für einen schönen Tag wir hätten. Und dann sagte er, wie sehr ihn meine Höflichkeit beeindruckt habe, wie ungewöhnlich sie sei bei einem Regierungsbeamten den Bürgern gegenüber. Er sei so überwältigt und beeindruckt und dankbar, daß er, als er von einem ein Jahr alten Dodge hörte, ihn gekauft habe und ihn mir gern zum Kostenpreis überlassen wolle. Würde ich mit ihm lunchen und die Sache besprechen wollen?
Ich sagte Mr. Hiller, ich könne ihn leider nicht zum Lunch treffen, aber ich würde ihn auf dem Weg nach Hause nach meiner Arbeitszeit in seinem Autopark aufsuchen. Der lag draußen in Roslyn, Long Island, und war nur eine halbe Stunde von meinem Betonklotzheim in der Bronx entfernt. Es war noch hell, als ich dort ankam. Ich parkte meinen Wagen und wanderte über das Gelände, schaute mir die Cadillacs an und verzehrte mich in kleinbürgerlicher Gier. Die Cadillacs waren schön, lang, schlank und massiv; einige wie geflammtes Gold, andere cremeweiß, dunkelblau, feuerwehrautorot. Ich warf Blicke ins Wageninnere und sah die großzügigen Fußmatten, die teuer aussehenden Sitze. Ich hatte mir nie viel aus Autos gemacht, aber in diesem Moment gierte ich nach einem Cadillac.
Ich ging auf das lange Backsteingebäude zu und kam an einem Dodge vorbei, blau wie ein Wanderdrosselei. Es war ein sehr hübscher Wagen, den ich gemocht hätte, wäre ich nicht durch diese kilometerlangen Reihen beschissener Cadillacs gelaufen. Ich blickte hinein. Die Sitze sahen bequem, aber nicht reich aus. Scheiße.
Um es kurz zu machen, ich reagierte genau wie der klassische neureiche Dieb. Etwas sehr Merkwürdiges war mir in den vergangenen paar Monaten geschehen. Als ich mich zum erstenmal bestechen ließ, war ich dabei sehr unglücklich. Ich hatte geglaubt, ich würde mich danach geringer schätzen, weil ich immer so stolz darauf gewesen war, nie zu lügen. Warum genoß ich dann meine Rolle als schmieriger kleiner bestechlicher Geldschinder so sehr?
Die Wahrheit ist, daß ich ein glücklicher Mensch geworden war, weil ich mich zu einem Betrüger an der Gesellschaft entwickelt hatte. Ich genoß es, Geld anzunehmen dafür, daß ich meinen Treueid der Regierung gegenüber brach. Ich genoß es, den Kindern Geld abzunehmen, die mich aufsuchten. Ich täuschte und heuchelte mit dem schmatzenden Vergnügen eines Bauern, der um Pfennige Poker spielt. Manchmal, wenn ich nachts wach lag und mir neue Tricks ausdachte, fragte ich mich verwundert, wie diese Veränderung in mir stattgefunden haben konnte. Und ich kam zu dem Schluß, daß ich die Tatsache kompensieren mußte, daß man mich als Künstler abgelehnt hatte, daß ich mich dafür zu rächen versuchte, daß ich ein wertloses Waisenkind war. Ja, ich rächte mich für mein völliges Versagen in der Welt, für meine allgemeine Unbrauchbarkeit in dem ganzen System. Und nun hatte ich endlich etwas entdeckt, worin ich tüchtig war, endlich gelang es mir, meine Frau und meine Kinder mit Erfolg zu ernähren. Und komischerweise wurde ich ein besserer Vater und ein besserer Ehemann. Ich half den Kleinen bei den Schulaufgaben. Und da ich jetzt das Schreiben aufgegeben hatte, hatte ich mehr Zeit für Vallie. Wir gingen zusammen ins Kino, ich konnte uns jetzt einen Babysitter und die Kinokarten leisten. Ich kaufte ihr Geschenke. Ich bekam sogar ein paar Aufträge von Zeitschriften und schrieb die Sachen mit der linken Hand runter. Vallie erklärte ich, daß das ganze neue Geld von meiner Arbeit für die Zeitschriften komme.
Ich war ein sehr glücklicher Gauner, aber im Unterbewußtsein war mir klar, daß der Tag der Abrechnung nicht ausbleiben werde. Darum gab ich alle Wunschträume nach einem Cadillac auf und begnügte mich mit dem drosseleiblauen Dodge.
Mr. Hillers Büro war geräumig, auf dem Schreibtisch standen Fotos von seiner Frau und seinen Kindern. Es war keine Sekretärin in Sicht, und ich hoffte, das sei deshalb so, weil er klug genug war, sie wegzuschicken, so daß sie mich nicht sehen konnte. Ich verhandelte gern mit klugen Leuten. Und ich hatte Angst vor Dummköpfen.
Mr. Hiller bot mir einen Stuhl und eine Zigarre an. Wieder fragte er, wie es mir gesundheitlich gehe. Dann machte er Nägel mit Köpfen. „Haben Sie den blauen Dodge gesehen? Ein hübscher Wagen. Vollkommen in Schuß. Ich kann Ihnen ein günstiges Geschäft anbieten. Was fahren Sie denn jetzt?“
„Einen 1950er Ford“, sagte ich.
„Ich nehme ihn als Tauschwagen“, sagte Mr. Hiller. „Sie können den Dodge für fünfhundert Dollar und Ihren Wagen haben.“
Ich verzog keine Miene. Ich holte die fünfhundert Böcke aus meiner Brieftasche und sagte: „Gut, das Geschäft ist gemacht.“
Mr. Hiller wirkte nur leicht überrascht. „Sie werden doch meinem Sohn helfen, das verstehen Sie doch?“ Er war wirklich ein wenig besorgt, daß ich nicht begriffen haben könnte.
Wieder überraschte es mich, wie sehr ich dergleichen kleine Transaktionen genoß. Ich wußte, ich könnte ihn hochtreiben, den Dodge kriegen, indem ich einfach bloß meinen Ford dagegen tauschte. Tatsächlich verdiente ich einen Tausender oder so bei dem Geschäft, selbst wenn ich ihm die Fünfhundert zahlte. Aber ich war nicht recht überzeugt davon, daß ein Gauner hart verhandeln sollte. Da war noch so ein bißchen was von Robin Hood in mir. Ich hielt mich immer noch für einen Typ, der den Reichen Geld abnahm, aber ihnen dafür den Gegenwert an Leistung bot. Was mir aber am meisten Spaß machte, war der Ausdruck der Besorgnis in seinem Gesicht, ich könnte nicht begriffen haben, daß das ein Bestechungsversuch sei. Darum sagte ich ganz ruhig und ohne zu lächeln, ganz beiläufig: „Ihr Sohn wird innerhalb einer Woche in das Sechsmonateprogramm aufgenommen werden.“
Erleichterung und eine Art von neuem Respekt zeigten sich in Mr. Hillers Gesicht. Er sagte: „Wir erledigen die ganzen Schreibereien heute abend, und ich kümmere mich um die Kennzeichen. Alles ist schon in die Wege geleitet.“ Er beugte sich vor und schüttelte mir die Hand. „Ich habe viel über Sie gehört“, sagte er. „Alle sprechen in den höchsten Tönen von Ihnen.“
Das gefiel mir. Selbstverständlich wußte ich, was er damit meinte. Daß ich einen guten Ruf als anständiger Gauner genoß. Immerhin, das war schon etwas. Es war ein Erfolg.
Während sein Sekretariat die Papiere fertig machte, plapperte Mr. Hiller in bestimmter Absicht weiter. Er versuchte herauszufinden, ob ich allein handelte oder ob der Major und der Oberst mit in die Sache verwickelt seien. Er machte das ganz geschickt, sein Training als Geschäftsmann, nehme ich an. Zunächst machte er mir Komplimente, wie geschickt ich mich doch verhielte, wie quick ich alles begriffe. Dann begann er mir Fragen zu stellen. Er sei besorgt, daß die zwei Offiziere sich an seinen Sohn erinnern könnten. Würden sie nicht seinem Sohn den Diensteid abnehmen müssen, wenn er in das Sechsmonateprogramm komme? Ja, das stimme, sagte ich.
„Und werden sie sich nicht an ihn erinnern?“ fragte Mr. Hiller. „Werden sie nicht fragen, wie es kommt, daß er so rasch auf der Liste raufgerutscht ist?“
Das war zwar ein Argument, aber kein sehr stichhaltiges. „Habe ich Ihnen irgendwelche Fragen über den Dodge gestellt?“ fragte ich zurück.
Mr. Hiller lächelte mich herzlich an. „Ach, natürlich“, sagte er. „Sie verstehen ja Ihr Geschäft. Aber es handelt sich um meinen Sohn. Ich will nicht, daß er für etwas, was ich getan habe, in Schwierigkeiten gerät.“
Meine Gedanken begannen abzuschweifen. Ich dachte daran, wie sich Vallie freuen würde, wenn sie den blauen Dodge sah. Blau war ihre Lieblingsfarbe, und sie verabscheute den abgetakelten alten Ford.
Ich zwang mich, über Mr. Hillers Frage nachzudenken. Ich erinnerte mich, daß sein Jeremy langes Haar und einen gutgeschneiderten Anzug mit Weste und Hemd und Krawatte getragen hatte.
„Sagen Sie Jeremy, er soll sich die Haare kurz schneiden lassen und Freizeitkleidung tragen, wenn ich ihn ins Büro rufe. Man wird sich nicht an ihn erinnern.“
Mr. Hiller blickte zweifelnd drein. „Das wird Jeremy aber gar nicht mögen“, sagte er.
„Na, dann braucht er’s ja nicht zu machen“, sagte ich. „Es liegt mir gar nicht, Leuten zu sagen, daß sie was tun sollen, was sie nicht gern tun. Ich kümmere mich um die Sache.“ Ich wurde einfach ein bißchen ungeduldig.
„Also gut“, sagte Mr. Hiller. „Ich überlasse das alles Ihnen.“
Als ich in dem neuen Wagen ankam, war Vallie begeistert, und ich machte mit ihr und den Kindern sogleich eine Spritztour. Der Dodge fuhr traumhaft gut, wir ließen das Radio laufen. In meinem alten Ford war kein Radio gewesen. Wir hielten und aßen Pizza und tranken Sodasprudel, etwas, was heute gang und gäbe ist, aber was wir früher in unserer Ehe selten getan hatten, weil wir auf jeden Penny achten mußten. Dann hielten wir vor einem Süßigkeitsladen und tranken Eiskremsodas, und ich kaufte eine Puppe für mein Mädchen und Kriegsspiele für die zwei Jungens. Und Valerie kaufte ich eine Schachtel „Schrafft-Schokolade“. Ich war richtig in Form und gab das Geld aus wie ein Prinz. Auf der Heimfahrt sang ich im Auto, und nachdem wir die Kinder ins Bett geschickt hatten liebten wir einander, und Vallie war zu mir, als ob ich der Aga Khan wäre und ihr gerade einen Diamanten, groß wie ein Ritz-Hotel, geschenkt hätte.
Ich dachte an die Tage, in denen ich meine Schreibmaschine verpfänden mußte, damit wir die Woche überleben konnten. Aber das war gewesen, bevor ich nach Vegas ausgerissen war. Seither hatte sich mein Glück gewendet. Kein Zweitjob mehr; zwanzig Riesen in meinen alten Manuskriptordnern auf dem Boden des Kleiderschranks versteckt. Ein blühendes Geschäft, bei dem ich ein Vermögen verdienen konnte, es sei denn, die ganze Sache flog auf oder es kam zu einem weltweiten Übereinkommen zwischen den Großmächten, das ihnen erlaubte, nicht mehr so viel Geld für ihre Verteidigung auszugeben. Zum erstenmal in meinem Leben begriff ich, wie den Großkopfeten der Rüstungsindustrie – und der Industrie überhaupt – und den Armeegenerälen zumute sein mußte. Eine stabilisierte Welt, eine Welt im Gleichgewicht würde mich wieder in Armut stürzen. Nicht daß ich mich nach noch einem Krieg gesehnt hätte. Aber es war einfach zum Lachen, daß sämtliche liberalen Überzeugungen, die ich bisher gehegt hatte, sich in der Hoffnung auflösten, die Sowetunion und die USA mögen sich nicht zu sehr anfreunden, jedenfalls jetzt nicht so rasch.
Vallie schnarchte ein bißchen, aber es störte mich wenig. Sie hatte so viel Arbeit mit den Kindern und dem Haushalt und mit mir. Seltsam war nur, daß ich nachts immer noch lange wach lag, egal, wie erschöpft ich war. Sie schlief stets vor mir ein. Manchmal ging ich dann und arbeitete an meinem Roman in der Küche und kochte mir was zu essen und ging erst wieder um drei, vier Uhr morgens ins Bett zurück. Aber jetzt schrieb ich ja keinen Roman und hatte also keine Arbeit zu erledigen. Verschwommen überlegte ich mir, daß ich wieder zu schreiben beginnen sollte. Schließlich hatte ich jetzt die Zeit dazu und das Geld. Die Wahrheit war, daß ich mein Leben zu aufregend fand, dieses Feilschen und Geschäftemachen, Bestechungsgelder vereinnahmen und zum erstenmal in meinem Leben für dumme Kleinigkeiten verschwenden.
Das große Problem allerdings war, wo ich mein Bargeld auf die Dauer verstauen sollte. Ich konnte es nicht im Haus behalten. Ich dachte an meinen Bruder Artie. Er hätte es für mich aufbewahren können. Und das hätte er mir zuliebe auch getan, wenn ich ihn gebeten hätte. Aber ich brachte es nicht fertig. Er war geradezu herzzerreißend anständig und würde mich fragen, woher ich das Geld hätte, und ich würde es ihm sagen müssen. Er hatte nie in seinem Leben etwas Unehrenhaftes für sich oder für sein Frau und die Kinder getan. Er war wirklich integer. Aber für mich hätte er es getan, danach aber wäre unser Verhältnis nicht mehr das gleiche gewesen. Und das konnte ich nicht ertragen. Es gibt Dinge, die man nicht tut oder nicht tun sollte. Und Artie zu bitten, mein Geld für mich aufzuheben, war genau das. Als Bruder oder als Freund tut man sowas nicht.
Sicher, manche Leute würden ihren Bruder nicht darum bitten, weil er ihnen das Geld klauen würde. Und dabei fiel mir Cully ein. Ihn würde ich fragen, wo ich das Geld am besten unterbringen könnte, wenn er das nächstemal in der Stadt war. Das war die Lösung! Cully würde etwas wissen. Schließlich war das ja sein Beruf. Und ich mußte etwas tun, um das Problem zu lösen. Ich hatte das Gefühl, die Penunzen würden immer dicker ins Haus schneien.
In der nächsten Woche steckte ich Jeremy Hiller ohne die geringste Schwierigkeit zu den Reservisten, und Mr. Hiller senior war so dankbar, daß er mich bat, in seinen Laden zu kommen und mir einen kostenlosen frischen Satz Reifen für meinen Dodge abzuholen. Natürlich dachte ich, das geschehe aus Dankbarkeit, und ich freute mich, daß er ein so netter Kerl war. Doch hatte ich vergessen, daß er ein Geschäftsmann war. Während der Automechaniker die neuen Reifen auf meinen Wagen montierte, setzte mir Mr. Hiller in seinem Büro einen neuen Vorschlag auseinander.
Er fing damit an, ein paar Streichelrationen auszugeben. Mit einem Lächeln der Bewunderung erklärte er mir, wie patent ich sei, wie ehrenhaft, wie absolut zuverlässig. Es sei ein Vergnügen, mit mir zu tun zu haben, und wenn ich jemals die Beamtenlaufbahn bei der Regierung aufgeben sollte, würde er dafür sorgen, daß ich einen guten Job bekäme. Ich schluckte das alles runter, weil ich in meinem Leben so wenig Lob erfahren hatte, und wenn, dann nur von meinem Bruder Artie und einigen unbekannten Buchkritikern. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was kommen würde.
„Ich habe da einen Freund, der Ihre Hilfe benötigt“, sagte Mr. Hiller. „Er hat einen Sohn, der ganz dringend in das sechsmonatige Reservistenprogramm aufgenommen werden muß.“
„Klar“, sagte ich. „Schicken Sie den Knaben direkt zu mir, und er soll sich auf Sie berufen.“
„Da gibt’s aber ein großes Problem“, sagte Mr. Hiller. „Der Junge hat bereits seine Einberufung erhalten.“
Ich zuckte mit den Schultern. „Dann ist er verdammt nochmal eben beschissen im Schneider. Sagen Sie seiner Familie, sie sollen ihm einen Abschiedskuß geben und in zwei Jahren auf seine Rückkehr hoffen.“
Mr. Hiller lächelte. „Sind Sie sicher, daß ein tüchtiger junger Mann wie Sie da nichts machen könnte? Es würde eine Menge Geld wert sein. Sein Vater ist ein sehr bedeutender Mann.“
„Nichts zu machen“, sagte ich. „Die Einberufungsvorschriften sind eindeutig. Sobald einer seinen Einberufungsbefehl hat, kann er sich nicht mehr für das Sechsmonateprogramm in der Reserve bewerben. Die Typen in Washington sind ja auch nicht blöd. Sonst würden ja alle darauf warten, bis sie eingezogen werden, ehe sie sich melden.“
Mr. Hiller sagte: „Der Mann möchte Sie gern persönlich sprechen. Er ist bereit, alles zu unternehmen. Verstehen Sie, was ich meine?“
„Das ist sinnlos“, sagte ich. „Ich kann ihm nicht helfen.“
Und dann setzte mich Mr. Hiller ein ganz kleines bißchen unter Druck. „Sprechen Sie doch mit ihm, mir zuliebe.“ Ich verstand. Wenn ich mich bloß mit dem Kerl auf ein Gespräch zusammensetzte, auch wenn ich sein Anerbieten ablehnte, würde Mr. Hiller ein Held sein. Nun, für vier fabrikneue Reifen konnte ich ja eine halbe Stunde mit einem reichen Mann verschwenden.
Also sagte ich: „Okay!“
Mr. Hiller schrieb etwas auf einen Streifen Papier und reichte ihn mir. Ich las. Der Name war Eli Hemsi, und darunter stand eine Telefonnummer. Eli Hemsi war der Größte in der Bekleidungsindustrie, hatte Ärger mit den Gewerkschaften und Beziehungen zur Unterwelt. Außerdem war er eine der führenden Figuren in der Gesellschaft der Stadt. Jemand, der sich Politiker kaufen konnte, eine Säule, wo es darum ging, für wohltätige Zwecke zu spenden, usw. Aber wenn er so ein dicker Hund war, wieso mußte er dann gerade zu mir kommen? Ich stellte Mr. Hiller die Frage.
„Weil er klug ist“, sagte Mr. Hiller. „Er ist ein sephardischer Jude. Und das sind die raffiniertesten überhaupt. Sie haben italienisches, spanisches und arabisches Blut in sich, und diese Mischung macht sie zu echt guten Killern, abgesehen von der Tatsache, daß sie so gerissen sind. Der Mann will nicht, daß sein Sohn Geisel bei einem wichtigen Politiker wird, der dann von ihm einen Riesengefallen erwartet. Es ist für ihn sehr viel billiger und eigentlich sehr viel weniger gefährlich, wenn er sich an Sie wendet. Und außerdem habe ich ihm gesagt, wie gut Sie sind. Um ganz offen und ehrlich zu sein, im Augenblick sind Sie der einzige Mensch, der ihm helfen könnte. Diese großen Tiere trauen sich nicht, ihre Pfoten in sowas wie die Einberufung zum Militär zu stecken. Zu kitzlig, die Sache. Die Politiker haben eine Scheißangst davor.“
Ich dachte an den Kongreßabgeordneten, der in mein Büro gekommen war. Der hatte Mumm gehabt. Oder vielleicht stand er am Ende seiner politischen Karriere und kümmerte sich einen Dreck um alles. Mr. Hiller beobachtete mich genau.
„Mißverstehen Sie mich bitte nicht“, sagte er. „Ich bin selber Jude. Aber mit den Sephardim müssen Sie vorsichtig sein, sonst tricksen die Sie einfach aus. Also, wenn Sie zu ihm gehen, seien Sie vernünftig.“ Er zögerte und fragte ängstlich: „Sie sind doch nicht Jude, oder?“
„Ich weiß nicht“, sagte ich und mußte in diesem Augenblick an die Waisenkinder denken und wie uns zumute gewesen war. Wir waren alle abnorm. Da wir unsere eigenen Eltern nicht kannten, war uns schnuppe, ob jemand Jude war oder Neger oder sonstwas.
Am Tag darauf rief ich Mr. Eli Hemsi in seinem Büro an. Wie verheiratete Männer gaben mir die Väter meiner „Klienten“ stets nur die Büronummer, als hätten sie eine Liebesaffäre. Sie aber wollten immer meine Privatnummer haben, für den Fall, daß sie sich rasch mit mir in Verbindung setzten mußten. Ich bekam neuerdings eine ganze Reihe von Anrufen, und Vallie fing an, sich Gedanken zu machen. Ich schwindelte ihr vor, es seien Anrufe von Buchmachern und Zeitschriftenredaktionen.
Mr. Hemsi bat mich, in meiner Mittagspause in sein Büro zu kommen, und ich ging hin. Es war in einem Gebäude mitten im Zentrum der Bekleidungsindustrie auf der Seventh Avenue, nur zehn Minuten vom Arsenal entfernt. Ein netter kleiner Spaziergang durch den Frühlingstag. Drinnen begegnete ich Arbeitern, die Handkarren voller Kleider an der Stange schoben, und ich überlegte mir ein bißchen boshaft, wie schwer sie arbeiten mußten für ihren miserablen Lohn, während ein paar Häuser weiter ich Hunderte für ein bißchen Papierkram machte. Die meisten waren Neger oder Farbige. Wieso waren die nicht auf den Straßen und schlugen die Leute bewußtlos, wie man das von ihnen erwartete? Hätten die nur die gleiche Erziehung gehabt wie ich, dann würden sie genauso gut stehlen können wie ich und keinem dabei weh tun.
Der Empfangsmensch lotste mich durch Ausstellungsräume, in denen die Kollektionen für die nächste Saison präsentiert wurden. Dann wies man mich durch eine kleine, schmuddelige Tür in Mr. Hemsis Büro. Es überraschte mich wirklich, wie schick es hier aussah, weil das Gebäude ansonsten so schmierig wirkte. Der Empfangsmensch reichte mich an Mr. Hemsis Sekretärin weiter, eine unscheinbare Person, aber makellos angezogen, und diese geleitete mich ins innerste Heiligtum.
Mr. Hemsi war ein Riesenkerl, der geborene Kosak in Figur und Aussehen, doch er trug einen tadellos geschneiderten Anzug, ein teuer wirkendes Hemd und hatte eine dunkelrote Krawatte umgebunden. Sein Gesicht wirkte beeindruckend durch die zerklüftete Haut und den melancholischen Blick. Er sah beinahe edel aus und ganz gewiß ehrlich. Er stand hinter seinem Schreibtisch auf, ergriff meine Hand mit seinen beiden, um mich zu begrüßen. Er blickte mir tief in die Augen. Er stand so dicht bei mir, daß ich durch sein dickes, schnurartiges graues Haar sehen konnte. Mit ernster Stimme sagte er: „Mein Freund hat recht, Sie haben ein gutes Herz. Ich weiß, Sie werden mir helfen.“
„Ich kann wirklich nicht helfen, ich würde es ja gern, aber ich kann es nicht“, sagte ich. Und ich erklärte ihm die ganze Geschichte mit dem Einberufungsbüro, genau wie ich es Mr. Hiller erklärt hatte. Ich gab mich kälter, als mir wirklich zumute war. Denn ich mag es nicht, wenn mir Menschen tief in die Augen schauen.
Aber er saß nur da und nickte mit seinem grauen Kopf ernsthaft vor sich hin. Dann, als habe er kein Wort von dem begriffen, was ich gesagt hatte, machte er einfach weiter, und seine Stimme war jetzt wirklich von tiefer Melancholie getragen.
„Meine Frau, die ärmste, ist schwerkrank. Es wird sie umbringen, wenn sie jetzt ihren Sohn verliert. Sie lebt nur für ihn. Es bringt sie um, wenn er zwei Jahre fort ist. Mr. Merlin, Sie müssen mir helfen. Wenn Sie das für mich tun, werde ich Sie glücklich machen für den Rest Ihres Lebens!“
Aber es war nicht das, was mich überzeugte. Ich glaubte ihm eigentlich kein einziges Wort. Doch der letzte Satz, der packte mich. Nur Könige und Kaiser können jemandem sagen: „Ich werde Sie glücklich machen für den Rest Ihres Lebens.“ Was für ein Zutrauen in seine Macht dieser Mann hatte. Aber dann wurde mir – natürlich – klar, daß er von Geld sprach.
„Lassen Sie mich darüber nachdenken“, sagte ich. „Vielleicht fällt mir etwas ein.“
Mr. Hemsi bewegte seinen Kopf sehr ernst auf und ab. „Ich weiß, Sie werden es machen“, sagte er, „ich weiß, Sie haben einen gescheiten Kopf und ein gutes Herz. Haben Sie Kinder?“
„Ja“, sagte ich.
Er fragte mich, wie viele und wie alt und ob es Jungs oder Mädchen seien. Er fragte mich nach meiner Frau und wie alt sie sei. Er betrug sich, als wäre er mein Onkel. Dann bat er mich um meine Privatadresse und die dortige Telefonnummer, damit er mich nötigenfalls erreichen könne.
Als ich ging, begleitete er mich selbst zum. Lift. Ich hatte das Gefühl, meine Sache gut gemacht zu haben. Ich hatte nicht die geringste Vorstellung, wie ich seinen Sohn vom Angelhaken des Musterungsbüros herunterkriegen könnte. Mr. Hemsi hatte recht. Ich hatte ein gutes Herz. Ich hatte so viel Herz, daß ich nicht versuchte, ihn auszunehmen, mit den Ängsten seiner Frau zu spielen und dann nichts zu leisten dafür. Anderseits hatte ich Hirn genug, mich nicht in die Geschichte eines Opfers der Musterungsbehörde verwickeln zu lassen. Der Bursche hatte seinen Einberufungsbefehl erhalten und würde in der Armee dienen. So etwa in einem Monat. Und seine Mutter würde eben ohne ihn leben müssen.
Am nächsten Tag rief mich Vallie im Büro an. Sie war erregt. Sie sagte, sie hätte gerade durch Eilboten etliche Pakete mit Kleidern erhalten. Kleider für alle unsere Kinder, Winter- und Herbstkleidung, und alles sei wunderschön. Ein Paket enthielte auch Kleider für sie selbst. Und alles wäre so teuer, wie wir es uns niemals würden leisten können.
„Da steckt mich eine Karte dabei“, sagte sie. „Von einem Mr. Hemsi. Wer ist das? Merlin, die Sachen sind einfach wundervoll. Wieso schickt er die dir?“
„Ich habe ein paar Werbebroschüren für seine Firma gemacht“, sagte ich. „Es steckte nicht viel Geld drin, aber er hat versprochen, den Kindern ein paar Sachen zu schicken. Ich dachte natürlich, nur so ein paar Kleinigkeiten.“
Ich hörte aus Vallies Stimme, wie sehr sie sich freute. „Das muß ein netter Mensch sein, dieser Mr. Hemsi. In den Schachteln sind Kleider für mindestens tausend Dollar.“
„Na, ist doch wunderbar“, sagte ich. „Wir reden heute abend darüber.“
Als ich aufgehängt hatte, erzählte ich Frank, was geschehen war, auch über Mr. Hiller, den Cadillac-Händler.
Frank kniff das eine Auge zu. „Jetzt hängen Sie an der Angel“, sagte er. „Der Typ erwartet, daß Sie was für ihn tun. Wie wollen Sie das hinbringen?“
„Scheiße“, sagte ich. „Ich bin mir ja nicht mal klar darüber, warum ich ihn überhaupt aufgesucht habe.“
„Das waren die Cadillacs, die Sie auf dem Gelände von Hiller gesehen haben“, sagte Frank. „Sie sind genau wie diese Neger. Die würden auch nach Afrika in ihre Hütten zurückgehen, wenn sie in ’nem Cadillac rumfahren könnten.“
Ich merkte ein kleines Zögern, während er sprach. Beinahe hätte er „Nigger“ gesagt, sagte aber statt dessen doch „Neger“. Ich hätte gern gewußt, ob er sich wegen des häßlichen Worts schämte oder ob er glaubte, ich könnte verletzt sein. Und was die Harlemneger betraf, verstand ich sowieso nicht, warum sich die Leute darüber aufregten, daß sie Cadillacs liebten. Weil sie es sich nicht leisten konnten? Weil sie keine Schulden machen sollten für etwas, das nicht nutzbringend war? Frank hatte recht, die Cadillacs hatten mich angespitzt. Deswegen war ich bereit gewesen, Hemsi zu treffen und Hiller einen Gefallen zu tun. Ganz insgeheim hoffte ich, daß ich mir einen von diesen schicken Luxusschlitten unter den Nagel reißen könnte.
Als ich am Abend heimkam, veranstaltete Valerie mit den Kindern für mich eine Modenschau. Sie hatte von fünf Paketen gesprochen, aber nicht erwähnt, wie groß sie waren. Das Ganze war enorm, Valerie und jedes der Kinder hatten zirka zehn komplette neue Ausstattungen. Valerie war so aufgeregt wie seit langem nicht. Die Kinder freuten sich, aber in ihrem Alter machten ihnen Kleider recht wenig aus. Mir schoß der Gedanke durch den Kopf, daß ein Spielzeugfabrikant, dessen Kleiner sich dem Wehrdienst entziehen wollte, in meiner Klientel noch fehlte.
Dann erklärte mir Vallie, daß sie neue Schuhe würde kaufen müssen, die zu den neuen Kleidern paßten. Ich sagte, sie solle noch eine Weile damit warten. Ich wollte darauf achten, ob mir der Sohn eines Schuhfabrikanten unter die Finger käme.
Das komische war, daß ich mich von Mr. Hemsi unter Druck gesetzt gefühlt haben würde, wenn die Kleidungsstücke billig gewesen wären. Das hätte so den Anstrich gehabt: die Armen kriegen die abgelegten Sachen von den Reichen. Aber was Hemsi geschickt hatte, war von erstklassiger Qualität, wie ich sie mir niemals leisten konnte, ganz gleich, wie viele Bestechungsgelder ich eintrieb. Fünftausend Böcke, nicht bloß tausend. Ich schaute mir die beigefügte Karte an. Eine Geschäftskarte mit Hemsis Namen und Titel, dem Firmennamen, der Adresse und der Telefonnummer. Nichts Handschriftliches. Keine Nachricht. Mr. Hemsi war also wirklich mit allen Wassern gewaschen. Es gab keinerlei direkten Beweis, daß er die Sachen geschickt hatte, und ich hatte nichts gegen ihn in der Hand.
In meinem Büro hatte ich erwogen, das Zeug an Mr. Hemsi zurückzuschicken. Aber nachdem ich gesehen hatte, wie glücklich Vallie darüber war, wußte ich, daß das nicht möglich sein würde. Ich lag bis nachts um drei Uhr wach und dachte darüber nach, wie man Mr. Hemsis Sohn von der Einberufung loseisen könnte.
Am nächsten Morgen, während ich ins Büro fuhr, kam ich zu einem Entschluß. Ich würde nichts Schriftliches festlegen, das man in ein, zwei Jahren bis zu mir zurückverfolgen könnte. Die Sache war äußerst riskant. Sich Geld geben zu lassen und einen Knaben auf der Liste nach vorn zu schieben, damit er in das Sechsmonateprogramm kam, war etwas anderes, als ihn rauszuholen, nachdem er bereits seine Einberufung erhalten hatte.
Darum rief ich als erstes die Musterungsstelle von Hemsi an. Ich erwischte einen von den Bürohengsten, ein Typ genau wie ich. Ich gab ihm meine Dienstnummer und servierte ihm die Story, die ich mir ausgedacht hatte. Ich sagte ihm, Paul Hemsi habe auf meiner Liste für das Sechsmonateprogramm gestanden, daß ich ihn vor zwei Wochen hätte aufnehmen wollen, den Brief aber an die falsche Anschrift geschickt habe. Es sei alles mein Fehler, und ich fühlte mich außerordentlich schuldbewußt deswegen. Außerdem könnte ich möglicherweise Schwierigkeiten mit meinem Job kriegen, falls die Familie des Knaben Stunk machen sollte. Ich fragte ihn, ob die Rekrutierungsstelle seine Einberufung nicht streichen könne, so daß ich ihn bei uns unterbringen könne. Ich würde dann die normalen Formulare an das Rekrutierungsamt senden, die nachwiesen, daß Paul Hemsi für das Sechsmonateprogramm der Reservisten der Armee verpflichtet sei, und dann könnten sie ihn aus den Listen der Wehrpflichtigen streichen. Ich glaube, ich sprach genau mit der richtigen Stimme, und ich klang auch nicht zu eifrig. Bloß so ein netter Kerl, der was Schiefgelaufenes wiedergutzumachen versuchte. Aber während ich das tat, ließ ich so nebenbei fallen, daß ich, falls der Mann in der Einberufungskommission mir den Gefallen tun könnte, gern helfen würde, falls einer seiner Freunde sich für das Sechsmonateprogramm bewerben wolle.
Diesen letzten Trick hatte ich mir ausgedacht, während ich in der vergangenen Nacht schlaflos gelegen hatte. Ich stellte mir vor, daß die Bürohengste im Einberufungsbüro wahrscheinlich öfter von Knaben angesprochen wurden, die auf dem Hintern liefen, weil sie einberufen worden waren, und daß wahrscheinlich die Bürokraten dort eine Menge guter Angebote bekamen. Wenn ein Beamter bei der Musterungsstelle einen seiner Kunden in das Sechsmonateprogramm überstellte, überlegte ich, dann müßte das doch wohl tausend Dollar wert sein.
Aber der Knabe im Musterungsbüro blieb völlig locker und hilfsbereit. Ich glaube, er merkte nicht einmal, daß ich ihm eine Bestechung anbot. Aber sicher, er werde den Einberufungsbescheid zurückziehen, das sei überhaupt kein Problem, und ich gewann den Eindruck, daß gerissenere Typen, als ich einer war, bereits den gleichen Trick angewendet hatten. Jedenfalls, am nächsten Tag hatte ich den nötigen Schrieb von der Musterungsstelle, und ich rief Mr. Hemsi an und bat ihn, er solle seinen Sohn zu mir ins Büro schicken, damit er registriert werden könne.
Alles klappte wie am Schnürchen. Paul Hemsi war ein netter. Junge mit sanfter Stimme, sehr scheu und schüchtern, jedenfalls kam es mir so vor. Ich ließ ihn den Eid sprechen und legte seine Papiere beiseite, bis er seine Order für den Aktivdienst erhielt. Ich besorgte ihm selbst die Ausrüstung, und als er seinen sechsmonatigen Dienst als Aktiver antrat, hatte ihn noch keiner in seiner Gruppe gesehen. Ich hatte ihn in einen Geist verwandelt.
Inzwischen war mir klargeworden, daß all diese Geschichten allmählich ziemlich heiß wurden und daß Leute mit großem Einfluß in sie verwickelt waren. Aber nicht umsonst war ich Merlin der Zauberer. Also setzte ich mir mein sternenbesetztes Zauberkäppi auf und begann die ganze Sache durchzudenken. Irgendwann würde alles auffliegen. Ich hatte mich ziemlich gut abgesichert, bloß das Geld bei mir zu Hause war noch im Wege. Das Geld mußte ich verstecken. Das war das Wichtigste. Und dann mußte ich eine andere Einkommensquelle nachweisen können, so daß ich mein Geld frei ausgeben konnte.
Natürlich konnte ich mein Geld bei Cully in Las Vegas unterbringen. Aber was, wenn Cully mich austrickste oder starb? Was den sauberen Gelderwerb betraf, so hatte ich immer Angebote, Buchkritiken zu schreiben oder für Zeitschriften zu arbeiten, lehnte sie aber stets ab. Ich war ein reiner Geschichtenerzähler, einer, der Romane schrieb. Es erschien mir entwürdigend, mir selbst und meiner Kunst gegenüber, etwas anderes zu schreiben. Aber, verdammt nochmal, jetzt war ich ein Ganove, und nichts hatte unter meiner Würde zu sein.
Frank bat mich, mit ihm zu lunchen, und ich sagte zu. Frank war in Hochform. Völlig aufgekratzt und auf dem Gipfel der Welt. Er hatte die ganze Woche lang gewonnen, und das Geld floß bei ihm nur so rein. Ohne daran zu denken, was die Zukunft für ihn bringen könnte, glaubte er einfach, daß er weiter gewinnen würde, daß diese ganze faule Bestechungsgeschichte ewig so weitergehen werde. Ohne sich selbst für einen Zauberer zu halten, glaubte er an eine Welt, in der Zauberei tagtäglich passierte.