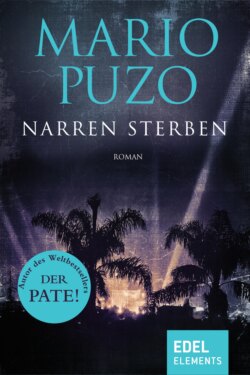Читать книгу Narren sterben - Mario Puzo - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеIch habe keine Geschichte. Keine Eltern, an die ich mich erinnern konnte. Ich habe keine Onkel, keine Cousins, keine Stadt, keinen Geburtsort. Ich habe nur einen Bruder, zwei Jahre älter als ich. Als ich drei und mein Bruder Artie fünf war, wurden wir in ein Waisenhaus außerhalb New Yorks gebracht. Unsere Mutter setzte uns dort ab. Ich kann mich nicht an sie erinnern.
Cully und Jordan und Diane erzählte ich das nicht. Ich redete niemals über diese Dinge. Nicht einmal mit Artie, der mir näher steht als irgendwer sonst in der Welt.
Ich rede nie darüber, weil es so pathetisch klingt, und das war es in Wirklichkeit gar nicht. Das Waisenhaus war gut geführt, angenehm, ordentlich, mit einer guten Schule und einem intelligenten Leiter. Man tat dort an mir nur Gutes, bis Artie und ich zusammen weggingen. Er war achtzehn, fand sich einen Job und eine Wohnung. Ich riß aus, um mit ihm zu gehen. Nach ein paar Monaten verließ ich auch ihn, gab bei der Musterungskommission ein höheres Alter an und ging zur Armee, um im Weltkrieg zu kämpfen. Und jetzt, sechzehn Jahre später, in Vegas, erzählte ich Jordan, Diane und Cully vom Krieg und vom Leben, das ich danach geführt hatte.
Das erste, was ich nach dem Krieg tat, war, daß ich mich für Kurse in Schriftstellerei in der New School for Social Research einschrieb. Damals wollten alle Schriftsteller werden, ebenso wie zwanzig Jahre später jeder ein Filmemacher werden wollte.
Es war mir schwergefallen, in der Armee Freunde zu finden. Im Kurs war es leichter. Dort traf ich auch meine spätere Frau. Da ich außer meinem Bruder keine Familie hatte, verbrachte ich viel Zeit da, hockte in der Cafeteria herum, weil ich nicht in meine einsame Bude in der Grove Street zurückgehen mochte. Es war eine schöne Zeit. Ab und an gelang es mir mit etwas Glück, ein Mädchen dazu zu überreden, ein paar Wochen lang mit mir zu leben. Die Jungs, mit denen ich mich anfreundete, waren alle auch gerade von der Armee entlassen worden und gingen mit ihrem GI-Stipendium zur Schule. Sie sprachen die gleiche Sprache wie ich. Das Problem war bloß, daß sie sich für den Literaturbetrieb interessierten und ich nicht. Ich wollte nichts als ein Schriftsteller sein, weil ich immer Geschichten träumte. Fantastische Abenteuer, die mich der Welt entrückten.
Ich stellte fest, daß ich mehr las als irgendeiner sonst, sogar mehr als die Jungs, die ihren Doktor in Englisch machen wollten. Ich hatte allerdings sonst wirklich nicht viel anderes zu tun, wenngleich ich immer spielte. Ich entdeckte einen Buchmacher auf der East Side, in der Nähe der Tenth Street, und setzte jeden Tag im Football, Basketball und Baseball. Ich schrieb ein paar Kurzgeschichten und begann mit einem Roman über den Krieg. Meine Frau lernte ich in einem der Kurse über Kurzgeschichten kennen.
Sie war irisch-schottischer Abstammung, kleingewachsen, mit einem vollen Busen und großen blauen Augen, und nahm alles immer sehr ernst. Sie kritisierte die Geschichten anderer mit Sorgfalt, höflich, aber mit äußerster Härte. Sie hatte noch nicht die Möglichkeit gehabt, mich zu kritisieren, weil ich der Klasse noch keine Arbeit vorgelegt hatte. Sie las eine ihrer Geschichten vor. Und ich war überrascht, denn die Geschichte war sehr gut und sehr komisch. Sie handelte von ihren irischen Onkeln, die alle Trunkenbolde waren.
Und als sie zu Ende gelesen hatte, attackierte die ganze Klasse sie, weil sie, wie sie meinten, das Klischee fördere, daß alle Iren tränken. Ihr hübsches Gesichtchen verkrampfte sich in verletztem Erstaunen. Schließlich gab man ihr die Chance zu antworten.
Ihre Stimme war schön und sanft, und im Klageton sagte sie: „Aber ich bin unter Iren aufgewachsen. Sie trinken alle. Stimmt das nicht?“ Sie fragte das den Lehrer, der zufällig auch Ire war. Er hieß Maloney und war ein guter Freund von mir. Und obwohl man es ihm nicht anmerkte, war er damals gerade betränken.
Maloney lehnte sich in seinem Stuhl zurück und sagte ernst: „Dazu wüßte ich nichts zu sagen, ich bin Skandinavier.“
Wir alle lachten, und die arme Valerie ließ den Kopf hängen. Sie war noch immer verwirrt. Ich verteidigte sie, denn obgleich es eine gute Geschichte war, wußte ich, daß sie nie eine richtige Schriftstellerin sein würde. Alle in der Klasse besaßen Talent, aber nur einige wenige hatten die Energie und das Verlangen, einen weiten Weg zu gehen und ihr Leben dem Schreiben zu opfern. Ich war einer von diesen. Und ich spürte, daß sie nicht zu denen gehörte. Hinter meinem Fall stand kein besoneres Geheimnis. Schreiben war das einzige, was ich wirklich tun wollte.
Gegen Semesterende legte ich schließlich eine Story vor.
Alle fanden sie sehr gut. Hinterher kam Valerie zu mir und fragte: „Wie kommt’s, daß ich so ernst bin und alles, was ich schreibe, komisch klingt? Und du machst immer Witze und tust, als wärst du überhaupt nicht ernst, und deine Geschichten bringen mich zum Weinen?“
Es war ihr ernst, wie gewöhnlich. Sie versuchte nicht, mich anzureißen. Also lud ich sie zu einem Kaffee ein. Sie hieß Valerie O’Grady, ein Name, den sie wegen seines irischen Klanges haßte. Manchmal überlege ich mir, ob sie mich nicht nur geheiratet hat, um das O’Grady loszuwerden. Außerdem mußte ich sie Vallie nennen.
Es setzte mich in Erstaunen, daß ich über zwei Wochen brauchte, um sie ins Bett zu kriegen. Sie war keins von den leicht abzuschießenden Mädchen aus dem Village, und sie wollte sichergehen, daß auch ich dies wußte. Wir mußten die ganze Scharade durchspielen, daß ich sie betrunken machte, so daß sie mich danach beschuldigen konnte, ich hätte eine nationale oder rassische Schwäche ausgenutzt. Aber im Bett überraschte sie mich,
Ich war vorher nicht gerade verrückt nach ihr gewesen. Doch im Bett war sie großartig. Ich glaube, es gibt Menschen, die sexuell zusammenpassen, die aufeinander in einer ursprünglichen sexuellen Weise reagieren. Was uns betraf, so denke ich, wir waren beide so scheu, so in uns selbst verkrochen, daß wir uns sexuell mit anderen Partnern nicht entspannen konnten. Und daß wir auf einander voll ansprachen, aus einem geheimnisvollen Grund, der eben dieser Scheu entsprang. Jedenfalls, nach der ersten Nacht im Bett waren wir unzertrennlich. Wir besuchten alle die kleinen Kinos im Village und schauten uns alle ausländischen Filme an. Wir aßen in italienischen oder chinesischen Restaurants und kehrten in mein Zimmer zurück und liebten uns. Und um Mitternacht brachte ich sie zum Subway, damit sie zu ihrer Familie in Queens zurückkommen konnte. Sie hatte noch immer nicht den Mumm, über Nacht zu bleiben. Aber an einem Wochenende konnte sie nicht mehr widerstehen. Sie wollte da sein, mir das Frühstück bereiten und mit mir zusammen die Sonntagszeitungen lesen. Darum brachte sie bei ihren Eltern die üblichen Tochterlügen an und blieb über Nacht. Es war ein herrliches Wochenende. Doch als sie nach Hause kam, geriet sie in einen heißen Streit mit ihrem Clan. Ihre Familie attackierte sie nach Strich und Faden, und als ich sie am Montagabend traf, war sie in Tränen aufgelöst.
„Verdammt“, sagte ich. „Wir heiraten!“
Ganz überrascht sagte sie: „Aber ich bin doch nicht schwanger.“ Und noch mehr staunte sie, als ich in lautes Gelächter ausbrach. Sie besaß in der Tat nicht den geringsten Humor, außer wenn sie schrieb.
Schließlich überzeugte ich sie davon, daß es mir ernst war, daß ich sie wirklich heiraten wollte, und sie wurde rot und begann wieder zu heulen.
Und am nächsten Wochenende fuhr ich raus zu dem Haus ihrer Familie in Queens zum sonntäglichen Dinner. Es war eine große Familie, Vater, Mutter, drei Brüder und drei Schwestern, alle jünger als Vallie. Ihr Vater war ein alter Mitarbeiter in der Tammany Hall, dem Parteihaus der New-Yorker Demokraten, und verdiente sein Geld mit irgendeinem Job in der Politik. Es waren auch ein paar Onkel da, und alle betranken sie sich. Aber auf eine fröhliche, unbekümmerte Weise. Sie betranken sich, wie andere Leute sich mit einem Festessen vollstopften. Und es war nicht peinlicher als das. Obwohl ich normalerweise nicht trank, kippte ich ein paar Gläser, und wir alle genossen den Abend sehr.
Die Mutter hatte lebhafte braune Augen. Vallie hatte offensichtlich ihre Sexualität von der Mutter und den Mangel an Humor vom Vater. Ich sah, wie der Vater und die Onkel mich mit scharfen alkoholisierten Augen beobachteten und herauszufinden versuchten, ob ich vielleicht bloß ein gerissener Stint war, der ihre geliebte Vallie bumste und ihr was vom Heiraten vorschwatzte.
Mr. O’Grady kam schließlich zur Sache. „Wann habt ihr zwei denn geplant, ins Joch zu gehen?“ fragte er. Ich wußte, wenn ich jetzt die falsche Antwort gäbe, würden mir ein Vater und drei Onkel auf der Stelle die Zähne einschlagen. Ich merkte, daß der Vater mich dafür haßte, daß ich sein kleines Mädchen gebumst hatte, ehe ich sie heiratete. Aber ich konnte ihn verstehen. Eine einfache, klare Sache. Und ich versuchte ja nicht, einen Vorteil rauszuschinden. Ich tat das nie mit Menschen, oder ich glaubte es jedenfalls. Also lachte ich und sagte: „Morgen früh.“
Ich lachte, weil ich wußte, die Antwort würde sie beruhigen, aber sie würden sie nicht akzeptieren können. Und zwar deshalb, weil alle ihre Freunde denken würden, Vallie sei schwanger. Wir einigten uns schließlich auf ein Datum in zwei Monaten, so daß formelle Ankündigungen und eine richtige Familienhochzeit möglich wurden. Und das war auch für mich okay. Ich weiß nicht, ob ich verliebt war. Ich war glücklich, und das genügte. Ich war nicht länger allein, ich konnte mit meinem wahren Leben beginnen. Ich würde eine Familie haben, eine Frau, Kinder, die Familie meiner Frau würde meine Familie sein, mein Leben würde sich ausweiten. Ich würde mich in einem Teil der Stadt niederlassen, der mir gehörte. Ich würde nicht länger eine einzelne, einsame Insel sein. Feste und Geburtstage konnten gefeiert werden. Kurz, ich würde zum erstenmal in meinem Leben „normal“ sein. Die Armee zählte wirklich nicht. Und während der nächsten zehn Jahre arbeitete ich daran, mich in die Welt einzubauen.
Die einzigen Leute, die ich kannte und zur Hochzeit einladen konnte, waren mein Bruder Artie und ein paar Jungs von der New School. Aber da gab es ein Problem. Ich mußte Vallie erklären, daß mein richtiger Name nicht „Merlin“ lautete. Oder genauer, daß mein ursprünglicher Name nicht „Merlin“ gewesen war. Nach dem Krieg änderte ich meinen Namen legal. Ich mußte dem Richter erklären, daß ich Schriftsteller sei und unter diesem Namen schreiben wolle. Und ich nannte ihm Mark Twain als Beispiel. Der Richter nickte, als kenne er Hunderte von Schriftstellern, die genau das gleiche getan hatten.
Die Wahrheit ist, daß ich damals mystische Gefühle dem Schreiben gegenüber hegte. Ich wollte, daß es rein sei, unbefleckt. Ich fürchtete, behindert zu sein, wenn irgend jemand irgend etwas über mich und meine wirkliche Identität wüßte. Ich wollte allgemeingültige Charaktere schildern. (Mein erstes Buch war mit Symbolik beladen.) Ich wünschte, zwei vollkommen getrennte Identitäten zu haben.
Durch Mr. O’Gradys politische Verbindungen bekam ich meinen Job als Angestellter in der Bundes-Zivilverwaltung. Ich wurde ein GS-6 Verwaltungsbeamter für die Reserveeinheiten der Armee.
Nachdem die Kinder da waren, wurde das Leben eintönig, war aber immer noch schön. Vallie und ich gingen nie aus. An Feiertagen waren wir zum Essen bei ihrer Familie oder bei meinem Bruder Artie. Wenn ich Nachtdienst hatte, besuchten sie ihre Freundinnen oder sie diese. Sie hatte eine Menge Bekannte. An Wochenenden ging sie abends zu ihnen in die Wohnung, wenn dort eine kleine Party gefeiert wurde, während ich zu Hause blieb, die Kinder beaufsichtigte und an meinem Buch arbeitete. Ich wollte nie mitgehen. Wenn sie an der Reihe war, Gäste einzuladen, ging mir das scheußlich auf die Nerven, und ich vermute, ich verbarg das auch nicht besonders. Vallie wurmte das. Ich erinnere mich, daß ich an einem dieser Abende ins Schlafzimmer ging, um nach den Kindern zu sehen, und dort blieb und ein paar Manuskriptseiten durchlas. Vallie überließ unsere Gäste sich selbst und kam mich suchen. Ich werde nie ihren verletzten Blick vergessen, als sie mich lesend vorfand und mein offensichtliches Widerstreben merkte, zu ihr und ihren Freunden zurückzukehren.
Es geschah nach einem dieser kleinen Vorfälle, daß ich zum erstenmal krank wurde. Ich wachte um zwei Uhr nacht auf und spürte einen quälenden Schmerz im Magen und im ganzen Rücken.
Einen Arzt konnte ich mir nicht leisten, darum ging ich am Morgen ins Krankenhaus der Veterans Administration, und dort machten sie alle möglichen Röntgenaufnahmen und eine ganze Woche lang noch andere Tests. Sie konnten nichts entdecken. Doch ich bekam einen neuerlichen Anfall, und aus den Symptomen diagnostizierten sie eine Gallenblasenentzündung.
Eine Woche später landete ich nach einem neuerlichen Anfall wieder im Krankenhaus, und sie pumpten mich voller Morphium. Ich konnte zwei Tage nicht arbeiten. Und dann, so eine Woche vor Weihnachten, gerade als ich dabei war, mit meiner Nachtarbeit Schluß zu machen, bekam ich einen ganz scheußlichen Anfall. (Ich habe nicht erwähnt, daß ich nachts in einer Bank arbeitete, um zusätzlich Geld für Weihnachten zu verdienen.) Der Schmerz war entsetzlich. Aber ich dachte, ich würde es bis zum VA-Krankenhaus auf der Twenty-Third Street schaffen. Ich nahm ein Taxi, das mich etwa einen halben Häuserblock vom Eingang entfernt absetzte. Es war jetzt nach Mitternacht. Als das Taxi weiterfuhr, landete der Schmerz einen grauenhaften Hieb in mein Zwerchfell. Ich sackte in der dunklen Straße in die Knie. Der Schmerz strahlte über den ganzen Rücken aus. Ich streckte mich auf dem kalten Gehsteig flach aus. Es war keine Menschenseele in der Nähe, niemand, der mir hätte helfen können. Der Eingang zum Krankenhaus war dreißig Meter entfernt, aber ich war so gelähmt durch den Schmerz, daß ich mich nicht bewegen konnte. Ich hatte nicht einmal Angst, hoffte eigentlich nur, daß ich sterben würde, damit dieser Schmerz aufhöre. Ich machte mir einen Dreck aus meiner Frau oder den Kindern oder meinem Bruder. Ich wollte bloß abzischen. Einen Blitzmoment dachte ich an den Merlin aus der Sage. Na, ich war eben kein beschissener Magier. Ich erinnere mich, daß ich mich herumwälzte, um den Schmerz zu beenden, und dabei vom Gehsteig in den Rinnstein rollte. Mein Kopf blieb auf dem Gehsteig liegen.
Und in dieser Lage konnte ich die leuchtende Weihnachtsdekoration in einem Laden in der Nähe sehen. Der Schmerz ließ ein wenig nach. Ich lag da und dachte, was für ein beschissenes Tier ich doch sei. Ich, ein Künstler, ein Buch veröffentlicht, ein Kritiker hatte mich ein Genie genannt, eine der Hoffnungen der amerikanischen Literatur, und verreckte hier wie ein Hund in der Gosse. Und ohne eigene Schuld dabei. Nur weil ich kein Geld auf der Bank hatte. Bloß weil ich niemanden hatte und man sich einen Scheißdreck darum kümmerte, ob ich am Leben war oder nicht. Das war die Wahrheit. Mein Selbstmitleid wirkte fast ebenso wie Morphium.
Ich weiß nicht, wie lang ich brauchte, um aus der Gosse zu kriechen. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, bis zum Eingang des Hospitals zu gelangen, aber schließlich lag ich unter einem Lichtkegel. Ich erinnere mich, daß Leute mich in einen Rollstuhl hoben und mich zur Notstation brachten, ich beantwortete Fragen, und dann lag ich plötzlich wunderbarerweise in einem warmen weißen Bett und fühlte mich wohlig schläfrig, ohne Schmerz, und wußte, sie hatten mir Morphium gespritzt.
Als ich aufwachte, fühlte mir ein junger Arzt gerade den Puls. Er hatte mich schon das erstemal behandelt, und ich kannte seinen Namen: Cohn. Er grinste mich an und sagte: „Wir haben Ihre Frau angerufen, und sie kommt, wenn sie die Kinder zur Schule gebracht hat.“
Ich nickte und sagte: „Vermutlich kann man diese Operation nicht bis nach Weihnachten hinausschieben?“
Dr. Cohn blickte ein wenig nachdenklich drein, dann sagte er fröhlich: „Na, Sie haben’s bis heute ausgehalten, warum verschieben wir es nicht wirklich bis nach Weihnachten? Ich setze Sie für den Siebenundzwanzigsten an. Sie können am Fünfundzwanzigsten kommen, und wir bereiten dann den Eingriff vor.“
„Okay“, sagte ich. Ich hatte Vertrauen zu ihm. Er hatte die im Hospital dazu gebracht, mich ambulant zu behandeln. Er war der einzige, der begriff, warum ich die Operation erst nach Weihnachtenn durchführen lassen wollte. Ich erinnere mich, daß er sagte: „Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber ich mache mit.“ Ich konnte ihm nicht gut erklären, daß ich in beiden Jobs bis Weihnachten weiterarbeiten müsse, damit meine Kinder Spielzeug bekämen und weiter an den Weihnachtsmann glauben könnten. Daß ich völlig für meine Familie und deren Glück verantwortlich und dies das einzige sei, was ich im Leben je gehabt hatte.
Ich werde immer an diesen jungen Doktor denken. Er sah aus wie diese Filmärzte, nur war er ganz bescheiden und natürlich. Er schickte mich, vollgepumpt mit Morphium, nach Hause. Aber er hatte seine Gründe dafür. Ein paar Tage nach der Operation erklärte er es mir, und ich merkte, wie froh er war, daß er es mir sagen konnte: „Hören Sie, Sie sind ein junger Kerl, zu jung, um gallenkrank zu sein, und die Untersuchungen waren alle negativ. Wir haben uns auf die Symptome gestützt. Und weiter war da nichts, Gallenblase, große Steine. Aber ich möchte Ihnen versichern, daß ich sonst nichts festgestellt habe. Ich habe wirklich sehr genau nachgesehen. Und wenn Sie nach Hause gehen, machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind jetzt wieder fast so gut wie neu.“
Damals wußte ich nicht, was zum Teufel er meinte. Wie bei mir üblich, kam ich erst ein Jahr später darauf, daß er befürchtet hatte, Krebs zu finden. Deshalb wollte er nicht operieren, wo es doch nur eine Woche bis Weihnachten war.