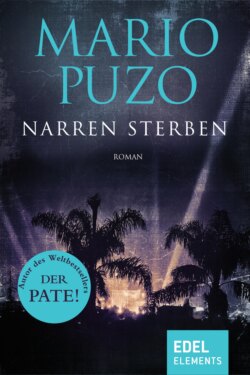Читать книгу Narren sterben - Mario Puzo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеAls ich Jordans Witwe erklärte, ich sei Merlin, blickte sie mich starr, kühl und freundlich an, ohne Schuld oder Trauer. Ich erkannte in ihr eine Frau, die sich und ihr Leben fest in der Hand hat, nicht weil sie selbstsüchtig und egozentrisch gewesen wäre, sondern aus Intelligenz. Ich begriff, warum Jordan über sie niemals ein hartes Wort gesagt hatte. Sie war eine ganz besondere Frau, von jener Art, wie viele Männer sie mögen. Aber ich wollte sie nicht näher kennenlernen. Ich stand zu stark auf Jordans Seite. Und das, obwohl ich seine Kühle und Ablehnung uns gegenüber stets hinter seiner Höflichkeit und scheinbaren Freundlichkeit gespürt hatte
Als ich Jordan zum erstenmal sah, wußte ich, da lief etwas nicht richtig synchron in diesem Menschen. Es war an meinem zweiten Tag in Vegas, und ich hatte beim Blackjack eine Glückssträhne gehabt, darum probierte ich es am Bakkarat-Tisch. Bakkarat ist wirklich ein reines Glücksspiel, und der Minimaleinsatz sind zwanzig Dollar. Man weiß sich völlig in der Hand des Schicksals, und dies Gefühl habe ich immer gehaßt. Ich wollte stets glauben, ich könnte mein Geschick lenken, wenn ich mich nur richtig anstrengte.
Ich nahm Platz an dem langen, ovalen Bakkarat-Tisch und bemerkte Jordan am anderen Ende. Er war ein blendend aussehender Mann von ungefähr vierzig, vielleicht schon fünfundvierzig. Er hatte eine dichte weiße Haarmähne, aber es war nicht das Weiß des Alters, sondern eines, das er von Geburt an besaß, durch irgendein Albino-Gen. Es saßen bloß er und ich und noch ein dritter Spieler am Tisch, und die drei Casino-Anreißer, damit es nicht so leer wirkte. Eine der drei war Diane, zwei Plätze neben Jordan sitzend, im „Arbeits-Dress“, aber ich merkte, daß ich eigentlich nur Jordan beobachtete.
An diesem Tag erschien er mir als ein bewundernswerter Spieler. Er zeigte nicht ein einzigesmal Freude, wenn er gewann. Er ließ kein einzigesmal Enttäuschung erkennen, wenn er verlor. Wenn er austeilte, dann gekonnt, mit eleganten weißen Händen. Und als ich ihm zusah, wie er die Hundertdollarnoten stapelte, wurde mir plötzlich klar, daß es ihm egal war, ob er gewann oder verlor.
Der dritte Spieler am Tisch war ein „steamer“, einer, der es haßte, zu verlieren. Er war klein und mager, und eigentlich kahlköpfig, nur hatte er die wenigen pechschwarzen Haare sorgfältig über die Glatze gekämmt. Sein Körper vibrierte vor nervöser Energie. Jede seiner Bewegungen war von Heftigkeit erfüllt. Wie er sein Geld beim Setzen hinwarf, wie er eine gute Hand aufnahm, wie er die Banknoten zählte und wütend vor sich aufhängte, um zu zeigen, daß er am Verlieren sei. Wenn er austeilte, tat er es unkontrolliert, so daß oft ein Blatt aufgedeckt landete oder über die ausgestreckte Hand des Croupiers hinwegflog. Aber der Croupier am Tisch blieb stets unbeeindruckt, und seine Höflichkeit ließ nie zu wünschen übrig. Eine Karte aus dem „Spiel“ segelte durch die Luft und fiel seitwärts. Der verkniffen aussehende Mann versuchte noch einen schwarzen Hundertdollar-Chip auf seine Karte zu setzen, doch der Croupier sagte: „Sorry, Mr. A., das geht nicht.“
Mr. A.s verkniffener Mund wurde noch böser. „Ach Scheiße, ich hab’ nur eine Karte gegeben. Wer sagt, daß ich nicht kann?“
Der Croupier blickte zu dem Ladderman an seiner Rechten empor. Der Ladderman nickte knapp, und der Croupier sagte höflich: „Mr. A., Sie haben einen Einsatz.“
Und richtig, die erste Karte für den Spieler war eine Vier, eine schlechte Karte. Aber Mr. A. verlor sowieso, als der Spieler ausstieg. Der „Schuh“ ging weiter zu Diane.
Mr. A. setzte auf „Spieler“ gegen Dianes Bank. Ich schaute über den Tisch zu Jordan hinüber. Sein weißer Kopf war gesenkt, er kümmerte sich nicht im geringsten um Mr. A. Ich schon. Mr. A. setzte fünf Einhundert-Dollar-Scheine auf „Spieler“. Diane teilte die Blätter mechanisch aus. Mr. A. erhielt die „Spieler“-Karten. Er fächerte sie auf und warf sie heftig auf den Tisch. Zwei Bilder. Null. Diane hatte zwei Karten, die zusammen fünf ergaben. Der Croupier rief: „Eine Karte für den Spieler.“ Diane gab Mr. A. eine weitere Karte. Wieder eine Figurenkarte. Null. Der Croupier sang laut: „Die Bank gewinnt.“
Jordan hatte auf „Bank“ gesetzt. Ich wollte eigentlich auf „Spieler“ setzen, aber Mr. A. stank mir, also setzte ich „Bank“. Dann sah ich, wie Mr. A. eintausend Dollar auf „Spieler“ setzte. Jordan und ich ließen unser Geld auf „Bank“ stehen.
Diane gewann mit einer natürlichen Neun über Mr. A.s Sieben. Mr. A. starrte Diane bösartig an, als wolle er sie davon abschrecken zu gewinnen. Das Verhalten des Mädchens war tadellos. Sie betrug sich bemüht neutral, bewußt unbeteiligt, spielte sehr deutlich ihre rein mechanische Funktion aus. Doch trotz alledem, als Mr. A. seine tausend Dollar auf „Spieler“ gesetzt hatte und Diane ihre natürliche Neun brachte, die siegte, hämmerte Mr. A. mit der Faust auf den Tisch und sagte: „Verdammte Fotze.“ Er starrte sie haßerfüllt an. Der Croupier, der das Spiel leitete, stand sofort auf. Kein Muskel in seinem Gesicht zuckte. Der Ladderman neigte sich vor wie ein Jehova, der sein Haupt aus dem Himmel niederbeugt. Am Tisch herrschte nun eine gewisse Spannung.
Ich beobachtete Diane. Sie verzog ein bißchen das Gesicht, schien zu schrumpfen. Jordan packte seinen Gewinn zusammen, als bemerke er nicht, was vor sich ging. Mr. A. stand auf und ging zum Pit-Boss hinüber, der am Markeurtisch stand. Er flüsterte etwas. Der Mann nickte. Alle am Spieltisch standen auf, während ein neuer Schuh arrangiert wurde. Ich sah Mr. A. durch das königliche graue Tor in Richtung der Korridore gehen, die zu den Hotelzimmern führten. Ich sah, wie der Pit-Boss zu Diane kam und mit ihr redete, und dann verschwand auch sie aus dem Bakkarat-pit. Man brauchte nicht viel Fantasie zu haben: Diane würde mit Mr. A. einen Fick machen, damit sich sein Glück wendete.
Die Croupiers brauchten zirka fünf Minuten, um den neuen Schuh zu arrangieren. Ich stieg aus und setzte ein bißchen im Roulette. Als ich zurückkam, lief das Spiel. Jordan saß noch immer auf demselben Platz, am Tisch waren zwei Anreißer, Männer diesmal.
Der Schuh ging dreimal um den Tisch, die Gewinne waren gleich verteilt, als Diane zurückkam. Sie sah scheußlich aus, der Mund stand offen, ihr Gesicht wirkte, als würde es gleich zerfließen, obwohl sie doch gerade frisches Make-up aufgelegt hatte. Sie setzte sich auf den Stuhl zwischen mir und einem der Croupiers. Auch er merkte, daß etwas nicht stimmte. Sekundenlang neigte er den Kopf, und ich hörte ihn flüstern: „Bist du okay, Diane?“ Das war das erstemal, daß ich ihren Namen hörte.
Sie nickte. Ich gab ihr den Schuh. Aber die Hände, mit denen sie die Blätter ausgab, zitterten. Sie saß vornübergebeugt, um die Tränen zu verbergen, die in ihren Augen glitzerten. Das ganze Gesicht zeigte nur eines: Scham. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Was immer Mr. A. mit ihr in seinem Zimmer getan hatte, es war sicherlich genug Strafe, weil sie Glück gehabt und er verloren hatte. Der Croupier machte eine leichte Handbewegung zum Pit-Boss, und der kam rüber und tippte Diane auf den Arm. Sie stand auf, und ein männlicher Anreißer nahm ihren Platz ein. Diane setzte sich neben ein Anreißer-Mädchen auf einen der Sessel an der Balustrade.
Der Schuh wanderte, das Glück sprang von „Bank“ zu „Spieler“, von „Spieler“ zu „Bank“ und zurück. Ich bemühte mich, meine Einsätze rechtzeitig zu plazieren, um mich dem Rhythmus anzupassen. Dann kam Mr. A. wieder an den Tisch zurück, auf denselben Platz, wo er sein Geld, seine Zigaretten und sein Feuerzeug liegengelassen hatte.
Er wirkte wie ein vollkommen neuer Mensch. Er hatte geduscht und seine paar Haare neu gekämmt. Jetzt sah er nicht mehr so abstoßend aus. Er trug ein frisches Hemd und andere Hosen, seine wütende Energie schien abgenommen zu haben. Aber er war keineswegs entspannt, doch immerhin füllte er die Atmosphäre nicht wie einer von den Tornados, die man in den Comics sieht.
Als er sich setzte, entdeckte er Diane an der Balustrade, und seine Augen glitzerten. Er warf ihr einen schiefen mahnenden Blick zu. Diane wendete den Kopf ab.
Was immer er angestellt haben mochte und wie mickrig es auch gewesen sein mochte, jedenfalls hatte es nicht nur seine Laune, sondern auch sein Glück umgestülpt. Er setzte auf „Spieler“ und gewann beständig. Und die ganze Zeit wurden nette Typen wie Jordan und ich abgemurkst. Das, oder das Mitleid, das ich für die Dame empfand, machte mich irgendwie sauer. Jedenfalls verdarb ich Mr. A. absichtlich seinen Glückstag.
Also, es gibt Typen, mit denen ist es eine Wonne zu spielen, und andere, die sind an einem Tisch im Casino einfach beschissen und gehen dir auf die Nerven. Am Bakkarat-Tisch ist der Typ am beschissensten, gleich ob’s der Banker oder der Spieler ist, der, sobald er seine zwei Blätter hat, sich eine endlose Minute Zeit läßt, bevor er sie auflegt, während die anderen ungeduldig darauf warten, daß sich die Sache entscheidet.
Und genau das fing ich mit Mr. A. an. Er saß auf Platz zwei, ich auf Platz fünf. Also saßen wir einander an der gleichen Tischhälfte gegenüber und konnten dem anderen sozusagen ins Weiße der Augen blicken. Ich war einen Kopf größer als Mr. A. und sah weiß Gott kräftiger aus wie einer von knapp über zwanzig. Keiner wäre auf die Idee gekommen, daß ich über dreißig war und zu Hause in New York ein Weib und drei Kinder sitzen hatte, vor denen ich abgehauen war. Also mußte ich äußerlich auf einen Typ wie Mr. A. wie eine ziemlich feuchte Type wirken. Gut, körperlich wirkte ich vielleicht kräftiger, aber er war so der echte Miesling und besaß in Vegas offenbar ein gewisses Ansehen. Und ich war doch bloß der blöde kleine Junge, den die Spielleidenschaft gepackt hat.
Beim Bakkarat setzte ich wie Jordan fast immer auf „Bank“. Aber als Mr. A. den Schuh bekam, streckte ich meine Hörner vor und setzte direkt gegen ihn auf „Spieler“. Als ich die zwei Karten bekam, drückte ich sie mit äußerster Sorgfalt zwischen den Fingern, bevor ich sie wendete. Mr. A. rutschte auf seinem Stuhl umher. Er gewann zwar, aber er konnte sich nicht beherrschen, und beim nächsten Spiel sagte er: „Also komm schon, Scheißerchen, beeil dich ein bißchen!“
Ich ließ meine Karten unaufgedeckt liegen und schaute ihn ruhig an. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie lugte ich zu Jordan am anderen Ende des Spieltisches. Er setzte auf „Bank“ mit Mr. A., aber er lächelte. Ich schob meine Karten ganz langsam auseinander.
Der Croupier sagte: „Mr. M., Sie halten das Spiel auf. Der Tisch macht es nicht.“ Er lächelte mich freundlich an. „Die Karten bleiben die gleichen, wie hart Sie auch gegen die Platte drücken.“
„Aber klar“, sagte ich und warf die Karten auf den Tisch und machte ein Verlierer-Gesicht. Mr. A. griente wieder in der Erwartung auf Sieg. Aber dann, als er mein Blatt sah, war er wie betäubt. Ich hatte eine unschlagbare Neun ...
Mr. A. sagte: „Verdammte Scheiße!“
„Habe ich diesmal meine Karten schnell genug gelegt?“ fragte ich ihn höflich.
Er blickte mich mörderisch an und schaufelte sein Geld zusammen. Er hatte noch immer nicht begriffen. Ich schaute zum anderen Ende des Spieltischs hinunter, und Jordan lächelte, ein richtig entzücktes Lächeln, obgleich ja auch er verloren hatte, weil er mit Mr. A. gespielt hatte. Noch eine Stunde lang ritt ich auf Mr. A. rum.
Ich begriff, daß Mr. A. einen Hebel im Casino haben mußte. Der Ladderman haue ihn bei ein paar Tricks davonkommen lassen, wo er behauptete, gesetzt zu haben, die Croupiers behandelten ihn mit vorsichtiger Höflichkeit. Der Kerl setzte jeweils fünfhundert oder tausend. Ich setzte meistens Zwanziger. Also würde wohl ich der sein, den das Casino hinauswarf, wenn es zu irgendwelchem Arger kommen sollte.
Aber ich machte es ganz richtig. Der Typ hatte mich als „Scheißerchen“ bezeichnet, und ich war weder wütend noch aggressiv geworden. Als der Croupier mich bat, schneller zu zeigen, hatte ich dies ganz bereitwillig getan. Und daß Mr. A. jetzt „kochte“, das war einfach sein Spielerpech. Das Casino würde ungeheuer an Renommee verlieren, wenn es sich auf seine Seite stellte. Sie würden Mr. A. einfach nicht mit irgendeinem Mist davonkommen lassen, weil das sie ebenso sehr wie mich gedemütigt hätte. Als friedfertiger Spieler war ich sozusagen ihr Gast und hatte ein Recht auf den Schutz des Hauses.
Ich sah nun, wie der Ladderman mir gegenüber an seinem Stuhl runtergriff und das Telefon abhob, das da hing. Er machte zwei Anrufe. Während ich ihm zusah, verpaßte ich den Einsatz, als Mr. A. den Schuh bekam. Ich setzte eine Weile mit den Einsätzen aus und entspannte mich so einfach in meinem Sessel. Die Stühle hatten Plüschpolster und waren sehr bequem. Man konnte zwölf Stunden lang drin sitzenbleiben, und viele taten das auch.
Die Spannung am Tisch wich, als ich es ablehnte, Mr. A.s Schuh zu wetten. Die stellten sich vor, daß ich vorsichtig war oder die Hosen vollhatte. Der Schuh wechselte weiter. Ich sah zwei sehr wuchtige Typen in korrektem Anzug mit Krawatte durch den Bakkarat-Eingang kommen. Sie gingen zum Pit-Boss rüber, und der sagte ihnen anscheinend, daß der Sturm vorüber sei und daß sie es sich gemütlich machen konnten, denn ich hörte sie lachen und Witze erzählen.
Als Mr. A. das nächstemal den Schuh bekam, schob ich einen Zwanzig-Dollar-Einsatz auf „Spieler“. Aber dann, zu meiner Überraschung, warf mir der Croupier, der die zwei „Spieler“-Karten erhielt, diese nicht zu, sondern ans andere Ende des Tisches, neben Jordan. Dabei sah ich Cully zum erstenmal.
Cully hatte so ein schmales dunkles Indianergesicht, aber dabei freundlich wirkend durch seine ungewöhnlich dicke Nase. Er griente quer über den Tisch zu mir und Mr. A. herüber. Ich sah, daß er vierzig Dollar auf „Spieler“ gesetzt hatte. Sein Einsatz war höher als der meine, darum erhielt er die „Spieler“-Karten, um sie zu wenden. Cully tat das sofort. Schlechte Karten, und Mr. A. gewann. Mr. A. bemerkte jetzt Cully überhaupt erst und grinste breit.
„He, Cully, was machst du denn beim Bakkarat, du verdammter Countdown-Spezialist?“
Cully lächelte. „Muß mir bloß ein bißchen die Füße ausruhen.“
Mr. A. sagte: „Setz mit mir, du Wichser. Gleich landet der Schuh wieder bei der Bank.“
Cully lachte bloß. Aber ich merkte, daß er mich beobachtete. Ich setzte meine Zwanzig auf „Spieler“. Cully setzte sofort vierzig auf Spieler, damit er die Blätter erhalten sollte. Und wieder legte er seine Karten sofort offen, und wieder schlug ihn. Mr. A.
Mr. A. rief laut: „Prima, Cully, du bringst mir wirklich Glück. Setz doch weiter gegen mich!“
Der Kassencroupier zahlte den Gewinn der Bank und sagte dann respektvoll: „Mr. A., Sie sind am Limit.“ Mr. A. überlegte einen Moment. Dann sagte er: „Lassen Sie’s weiterlaufen.“
Ich wußte, ich mußte nun sehr vorsichtig sein. Ich verzog keine Miene. Der Spielcroupier hielt die Handfläche nach oben, um das Austeilen des Schuhs so lange aufzuhalten, bis sämtliche Einsätze gemacht waren. Er blickte mich flüchtig und fragend an. Ich rührte mich nicht. Der Croupier blickte zum anderen Ende des Spieltisches. Jordan setzte auf „Bank“, zusammen mit Mr. A. Cully setzte einen Hundertdollar-Einsatz auf „Spieler“, und dabei schaute er mich die ganze Zeit an.
Der Spielcroupier ließ die Hand fallen, aber ehe Mr. A. ein Blatt aus dem Schuh nehmen konnte, warf ich den Stoß Geldscheine vor mir auf „Spieler“. Das Gewispere des Pit-Bosses und seiner zwei Kollegen hinter mir brach ab. Mir gegenüber beugte der Ladderman sein Haupt aus dem Himmel nieder.
„Geld spielt“, sagte ich. Was bedeutet, daß der Croupier erst nachzählen konnte, nachdem die Wette entschieden war. Die „Spieler“-Karten mußten an mich gehen.
Mr. A. teilte dem Spielcroupier aus. Der warf zwei Blätter mit der Rückseite nach oben auf das grüne Filztuch. Ich hob sie kurz an und wendete sie um. Nur Mr. A. konnte sehen, wie ich das Gesicht leicht sacken ließ, als hätte ich lausige Karten. Dabei hatte ich eine natürliche Neun in der Hand. Der Croupier zählte mein Geld aus. Ich hatte zwölfhundert Dollar gesetzt, und ich hatte gewonnen.
Mr. A. lehnte sich zurück und zündete sich eine Zigarette an. Er kochte wirklich. Ich konnte seinen Haß direkt spüren. Ich lächelte ihn an. „Sorry“, sagte ich. Genau wie ein netter kleiner Junge. Er stierte mich böse an.
Cully, am anderen Tischende, stand wie zufällig auf und schlenderte zu meiner Tischseite herüber. Er setzte sich auf einen der Stühle zwischen mir und Mr. A., damit er den Schuh bekommen würde. Cully patschte auf die Box und sagte: „Hören Sie, Cheech, steigen Sie bei mir ein. Ich hab’ so’n Glücksgefühl. Ich hab’ sieben Pässe in meinem rechten Arm.“
Also hieß Mr. A. Cheech. Ein unangenehm klingender Name. Aber anscheinend mochte Cheech Cully, und ebenso offenkundig war Cully ein Mann, der es zu einer Wissenschaft gemacht hatte, daß man ihn mochte. Denn jetzt drehte er sich zur mir herüber, während Cheech auf „Bank“ setzte. „Na komm schon, Kid“, sagte er. „Brechen wir doch alle zusammen dem verdammten Casino das Genick. Spielen Sie mit mir.“
„Haben Sie wirklich ’ne Glücksphase?“ fragte ich, mit einer kleinen Andeutung von ehrfurchtsvollen Augen.
„Vielleicht mach’ ich den ganzen Schuh leer“, sagte Cully. „Garantieren kann ich’s ja nicht, aber vielleicht mach’ ich den Schuh leer.“
„Na denn mal los“, sagte ich. Ich setzte zwanzig auf „Bank“. Wir gingen alle zusammen. Ich, Cheech, Cully und Jordan drüben auf der anderen Seite des Tischs. Einer von den Anreißern mußte die „Spieler“-Hand übernehmen und brachte prompt eine kalte Sechs vor. Cully legte zwei Bilder auf, und als er zog, bekam er noch ein Bild, ein totales Zip, Zero, die mieseste Hand beim Bakkarat. Cheech hatte tausend verloren. Cully hundert. Jordan hatte fünfhundert verloren. Ich schäbige kleine zwanzig. Ich allein machte als einziger Cully Vorwürfe. Ich schüttelte kläglich den Kopf. „Mann, da gehen meine Zwanzig“, sagte ich. Cully grinste mich an und reichte mir den Schuh. Ich schaute an ihm vorbei und sah, wie Cheechs Gesicht sich rötete vor Wut. Ein kleiner Scheißer von einem kleinen Jungen verliert zwanzig und erlaubt es sich, sich darüber aufzuregen. Ich konnte in seinen Gedanken lesen, als wären sie ein aufgedecktes Kartenspiel vor mir auf dem grünen Filz.
Ich setzte wieder zwanzig auf meine Bank, wartete darauf, die Karten auszugeben. Der Croupier war der junge, gutaussehende Mann, der Diane gefragt hatte, ob sie okay sei. An seiner erhobenen Hand, die mein Austeilen stoppte, bis alle Einsätze getätigt sein würden, glänzte ein Diamantring. Ich sah Jordan seinen Einsatz machen. Auf „Bank“, wie gewöhnlich. Er ging mit mir.
Cully setzte zwanzig auf „Bank“. Er drehte sich zu Cheech hinüber und sagte: „Kommen Sie, gehen Sie mit uns. Der Kleine sieht aus, als ob er Glück hat.“
„Mensch, der onaniert doch noch“, sagte Cheech. Ich merkte, daß sämtliche Croupiers mich ansahen. Der Ladderman auf seinem hohen Stuhl saß gerade und unbeweglich. Ich wirkte groß und stark, und sie empfanden mir gegenüber so ein bißchen Verachtung.
Cheech setzte dreihundert auf „Spieler“. Ich gab und gewann. Ich machte weiter Coups, und Cheech erhöhte seinen Einsatz gegen mich weiter. Er verlangte einen Markeur. Also, es war nicht mehr viel von dem Schuh über, aber ich teilte mit perfekten Spielermanieren aus, hielt die Karten nicht zurück, keine freudigen Ausrufe. Ich war stolz auf mich. Die Croupiers leerten den Behälter und mischten die Karten zu einem neuen Spiel. Jeder zahlte seine Kommissionen. Jordan stand auf, um die Beine zu strecken. Cheech auch, und auch Cully. Ich stopfte meinen Gewinn in die Taschen. Der Pit-Boss holte den Markeur herüber, damit Cheech signieren konnte. Alles war prima. Es war der absolut beste Augenblick.
„Hören Sie mal, Cheech“, sagte ich. „Ich bin also ein doofer Onanist?“ Und ich lachte. Dann ging ich um den Tisch herum zum Ausgang aus dem Bakkarat-pit, aber ich ging absichtlich dicht an ihm vorbei. Er konnte nicht widerstehen, mir eine zu verpassen, ebensowenig wie ein wurmiger Croupier einem Hundert-Dollar-Chip widerstehen kann, den er findet.
Und ich hatte ihn so richtig vor den Fäusten. Oder jedenfalls dachte ich das. Aber Cully und die zwei Riesen hatten sich auf wunderbare Weise zwischen uns gedrängt. Einer von den beiden Gangstern hatte Cheechs Faust in seiner großen Pranke, als wär’ sie ein kleiner Ball. Cully schubste mich mit der Schulter aus der Balance.
Cheech kreischte den großen Kerl an: „Du Saukerl! Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin?“
Zu meiner Überraschung ließ der Ganove Cheechs Hand los und trat zurück. Er hatte seine Aufgabe erfüllt. Er war eine vorbeugende, nicht eine strafende Gewalt. Unterdessen hatte keiner auf mich geachtet. Sie alle waren durch Cheechs Wut eingeschüchtert, alle, außer dem jungen Croupier mit dem Diamantring. Der sagte sehr ruhig:
„Mr. A., Sie benehmen sich daneben.“
Mit unglaublicher, peitschenschneller Wut hieb Cheech dem jungen Croupier die Faust direkt auf die Nase. Der Croupier taumelte rückwärts. Blut pulste auf sein weißes Plisséhemd und verschwand in dem Blauschwarz seines Smokings. Ich schoß an Cully und den zwei Gangstern vorbei und versetzte Cheech einen Hieb auf die Schläfe, der ihn zu Boden gehen ließ. Und er stand doch sofort wieder auf. Ich war überrascht. Jetzt würde alles ziemlich ernst werden. Der Kerl hatte Nukleargift als Brennstoff.
Und dann stieg der Ladderman von seinem hohen Stuhl herunter, und ich konnte ihn unter der grellen Lampe des Bakkarat-Tischs deutlich erkennen. Sein Gesicht war zerfurcht und pergamenthaft bleich, wie wenn sein Blut in unzähligen Jahren in der Klimaanlage weißgefroren wäre. Er hob eine Geisterhand hoch und sagte ruhig: „Stop!“
Alles gefror. Der Ladderman richtete einen langen Knochenfinger auf Cheech und sagte: „Cheech, machen Sie keine Bewegung. Sie stecken in ziemlichen Schwierigkeiten. Glauben Sie mir.“
Cully brachte mich durch den Eingang in der Balustrade, und ich war nur allzu bereit zu gehen. Aber dennoch kamen mir einige der Reaktionen rätselhaft vor. Das Gesicht des jungen Croupiers wirkte irgendwie beängstigend tödlich, auch noch mit dem herunterfließenden Blut. Er hatte keine Furcht, er war nicht benommen oder schwer genug angeschlagen, um nicht zurückzuhauen. Aber er hatte nicht einmal die Hand gehoben. Und seine Kollegen waren ihm auch nicht zu Hilfe geeilt. Sie hatten Cheech mit irgendwie ehrfürchtigem Entsetzen angestarrt, das nicht Angst war, sondern Mitleid.
Cully schob mich durch das Casino, durch das brandungshafte Gedröhn der unzähligen Spieler, die ihre Wudu-Flüche und Wudu-Gebete über Würfeln, Blackjack und dem wirbelnden Rouletterad murmelten. Schließlich kamen wir in die relative Stille der riesigen Cafeteria.
Ich fand den Raum ansprechend, mit den grünen und gelben Stühlen und Tischen. Die Kellnerinnen waren jung und sahen hübsch aus in ihren schmucken goldfarbenen kurzrockigen Uniformen. Die Wände waren alle aus Glas; man konnte die Außenwelt sehen, den teuren grünen Rasen, den himmelblauen Swimming-pool, die in Reihe angepflanzten großen Palmen. Cully führte mich zu einer der großen Sitznischen, an einen Tisch, der für sechs Personen gereicht hätte und Telefone hatte. Er betrat den Platz, als wäre es sein gutes Recht.
Während wir unseren Kaffee tranken, kam Jordan an uns vorbeigeschlendert. Cully sprang sofort auf und packte ihn am Arm. „Hallo, Junge“, sagte er, „trinken Sie einen Kaffee mit Ihren Bakkarat-Kumpeln.“ Jordan schüttelte den Kopf, aber dann sah er mich in der Nische sitzen. Er lächelte mich merkwürdig an, aus irgendeinem Grund amüsiert, und entschied sich anders.
So also waren wir uns zuerst begegnet, Jordan, Cully und ich. An jenem Tag in Vegas, als ich Jordan traf, sah er nicht übel aus, trotz seines weißen Haares. Es umgab ihn eine nahezu undurchdringliche Aura von Reserviertheit, die mich einschüchterte, aber Cully merkte nichts davon. Cully war einer von den Leuten, die den Papst zu einer Tasse Kaffee abschleppen würden.
Ich spielte immer noch auf unschuldiger Junge. „Warum zum Teufel ist denn dieser Cheech so sauer geworden?“ fragte ich. „Jesus, und ich hab’ gedacht, wir alle hätten einen Riesenspaß.“
Jordans Kopf ruckte hoch, er schien zum erstenmal aufmerksam zu verfolgen, was los war. Außerdem lächelte er mich an, wie man ein Kind anlächelt, das über sein Alter hinaus klug zu sein versucht.
Cully war keineswegs so begeistert. „Hör zu, Junge“, sagte er. „Der Ladderman hatte dich in zwei Sekunden durchschaut. Wozu zum Teufel, glaubst du, sitzt der da droben? Seine beschissene Nase auszubohren? Oder die Katzen rumlaufen zu sehen?“
„Ja, okay“, sagte ich. „Aber keiner kann sagen, es war meine Schuld. Cheech hat sich danebenbenommen. Ich bin Gentleman geblieben. Das müßt ihr doch zugeben. Das Casino kann sich über mich nicht beklagen.“
Cully lächelte mich freundlich an. „Ja, das hast du wirklich gut gedreht. Da warste wirklich clever. Cheech hat überhaupt nichts gemerkt und ist direkt in die Falle gerannt. Aber eins hast du nicht begriffen. Cheech ist ein gefährlicher Mann. Und deshalb ist es jetzt mein Job, dich zusammenzupacken und in eine Maschine zu setzen. Was für ein verdammter Name ist das überhaupt: Merlin?“
Ich gab keine Antwort, streifte mein Sporthemd hoch und zeigte ihm meinen nackten Bauch und die Brust. Ich hatte da eine lange, ziemlich scheußliche violette Narbe. Ich griente Cully an und sagte: „Weißt du, was das ist?“
Jetzt war er auf der Hut. Das Gesicht wie das eines Falken.
Ich gab es ihm löffelweise. „Ich war im Krieg“, .sagte ich langsam. „Sie kriegten mich mit einer MG-Garbe, und dann mußten sie mich zusammennähen wie ein Brathuhn. Du glaubst, Ich scher’ mich einen Dreck um dich und Cheech? Nicht die Bohne!“
Cully war nicht beeindruckt. Jordan lächelte noch immer. Alles was ich sagte, war die Wahrheit. Ich war im Krieg gewesen, und ich hatte im Gefecht gestanden, aber ich wurde nie getroffen. Was ich Cully zeigte, war die Narbe von meiner Gallenoperation. Sie batten eine neue Operationsmethode ausprobiert, und die hatte diese eindrucksvolle Narbe hinterlassen.
Cully seufzte und sagte: „Kid, du bist ja vielleicht härter, als du aussiehst, aber bestimmt nicht hart genug, um gleichzeitig mit Cheech hierbleiben zu können.“
Ich dachte daran, wie Cheech blitzartig wieder vom Boden hochgekommen war, und wurde etwas unsicher. Einen Augenblick lang überlegte ich, ob ich mich nicht von Cully in ein Flugzeug setzen lassen sollte. Aber dann schüttelte ich den Kopf.
„Schau mal, ich versuch’ doch bloß zu helfen“, sagte Cully. „Nach dem, was passiert ist, wird Cheech hinter dir her sein, und du bist nicht von seinem Kaliber, glaub mir.“
„Wieso nicht?“ fragte Jordan.
Cully antwortete sehr schnell: „Weil der Junge da ein Mensch ist, und Cheech ist keiner.“
Es ist komisch, wie Freundschaften entstehen. In diesem Moment wußten wir noch nicht, daß wir Vegas-Kumpane sein würden. Eigentlich hatten wir alle drei allmählich die Nase voll voneinander.
Cully sagte: „Ich fahr’ dich zum Flughafen.“
„Du bist ein prima Junge“, sagte ich. „Ich mag dich. Wir sind Bakkaratkumpel. Aber wenn du mir nochmal sagst, du fährst mich zum Flugplatz, dann wachst du im Krankenhaus auf.“
Cully tat richtig erheitert. „Na komm schon“, sagte er. „Du hast dem Cheech einen sauberen Haken versetzt, und der war gleich wieder auf den Beinen. Du bist eben keine Schlägertype.“
Darüber mußte nun auch ich lachen, denn es stimmte ja. Ich war nicht in meiner Rolle. Und Cully fuhr fort: „Du zeigst mir, wo dich Kugeln getroffen haben. Damit bist du aber noch kein harter Bursche, damit bist du das Opfer von ’nem andern harten Burschen. Wenn du mir einen zeigst, der Narben hat, weil du ihm Kugeln verpaßt hast, machst du mir Eindruck. Und wenn Cheech nicht sofort wieder auf die Beine gekommen wäre, als du ihm den versetzt hast, hättest du mir auch Eindruck gemacht. Komm aus den Wolken herunter. Ich tu’ dir bloß einen Gefallen. Ehrlich.“
Nun, er hatte mit jedem Wort recht. Aber das änderte nichts. Ich hatte keine Lust, zu meiner Frau und den drei Kindern und in mein verkorkstes Leben zurückzugehen. Vegas gefiel mir. Das Casino gefiel mir. Spielen war genau das, was mir paßte. Man konnte dabei allein sein, ohne einsam zu sein. Und immer passierte dabei etwas, so wie eben. Ich war kein hartgesottener Bursche, aber was Cully nicht begriff, war, daß praktisch nichts mir Angst einjagen konnte, weil ich an diesem Punkt meines Lebens mich einen Dreck um irgend etwas kümmerte.
Also sagte ich zu Cully: „Ja, recht hast du. Aber ich muß noch ein paar Tage bleiben.“
Nun schaute er mich richtig von oben bis unten an. Dann zuckte er mit der Schulter, nahm den Scheck und zeichnete ihn ab und stand auf. „Ich treff’ euch noch, Jungs“, sagte er und ließ mich mit Jordan allein.
Wir fühlten uns beide nicht wohl. Wir wollten keiner in der Gesellschaft des anderen sein. Ich spürte, daß wir beide Vegas für einen ähnlichen Zweck benutzten, nämlich uns vor der realen Welt zu verstecken. Aber wir wollten nicht unhöflich sein. Jordan wohl hauptsächlich, weil er ein enorm sanfter, freundlicher Mann war. Und wenn es mir auch sonst nie schwerfiel, Leute abzuschütteln, so war da etwas an Jordan, das ich instinktiv mochte, und sowas passierte mir so selten, daß ich ihn nicht verletzen wollte, indem ich ihn jetzt allein sitzen ließ.
Dann fragte Jordan: „Wie schreiben Sie Ihren Namen?“
Ich buchstabierte ihn. M – e – r – l – i – n.
Er schenkte mir sein mildes Lächeln. „Ihre Eltern haben wohl gehofft, aus Ihnen würde ein Zauberer werden, wenn Sie erwachsen sind?“ fragte er. „Und das haben Sie am Bakkarat-Tisch zu beweisen versucht?“
„Nein“, sagte ich. „Merlin ist mein Familienname. Ich habe ihn geändert. Ich wollte nicht König Arthur sein und Lancelot auch nicht.“
„Merlin hatte auch seinen Ärger“, sagte Jordan.
„Ja, aber er ist nie gestorben“, sagte ich.
Am Morgen nach der Prügelei mit Cheech schrieb ich den täglichen Kurzbrief an meine Frau und informierte sie, daß ich in ein paar Tagen heimkommen würde. Dann schlenderte ich durch das Casino und sah Jordan an einem der Craps-Tische. Er wirkte wie ausgehöhlt. Ich berührte ihn am Arm, und er lächelte dieses milde Lächeln, das mich immer berührte. Vielleicht weil ich der einzige war, dem er so bereitwillig zulächelte. „Gehen wir frühstücken“, sagte ich. Ich wollte, daß er sich ein wenig erholte. Offensichtlich hatte er die ganze Nacht durchgespielt. Ohne ein Wort nahm Jordan seine Chips und ging mit mir in die Cafeteria. Ich hatte den Brief noch immer in der Hand. Er schaute darauf, und ich sagte: „Ich schreibe meiner Frau jeden Tag.“
Jordan nickte und bestellte sein Frühstück. Eine ganze Mahlzeit im Vegas-Stil. Melone, Eier und Schinken, Toast und Kaffee. Aber er aß wenig, nur ein paar Bissen. Dann der Kaffee. Ich wählte ein Steaksaignant, was ich morgens gerne hatte, aber nur in Vegas aß.
Während wir noch frühstückten, kam Cully herein, die rechte Hand voller roter Fünf -Dollar-Chips.
„Hab’ grad meine Tagesspesen gedeckt“, sagte er selbstsicher. „Hab’ einen Schuh abgesahnt und meine Prozentwette gelandet.“ Er setzte sich zu uns und bestellte Melone und Kaffee.
„Merlin, ich hab’ ’ne gute Nachricht für dich“, sagte er dann. „Du brauchst nicht aus der Stadt zu gehen. Cheech hat sich gestern abend einen Riesenfehler geleistet.“
Also, aus irgendeinem Grund machte mich das richtig sauer. Er harkte immer noch auf der Sache herum. Er war genau wie meine Frau, die mich ständig anbohrte und sagte, ich müsse mich anpassen. Ich mußte nichts, gar nichts! Aber ich ließ ihn weiterquasseln. Jordan sagte wie üblich kein Wort, schaute mich bloß kurz an. Ich hatte das Gefühl, er konnte meine Gedanken lesen.
Cully aß und redete hastig und nervös. Es war eine Menge Energie in ihm, genau wie bei Cheech. Nur schien sie bei ihm mit Freundlichkeit geladen, damit die Welt auf besser geölten Rädern lief. „Du weißt doch, der Croupier, den Cheech auf die Nase gehauen hat und das ganze Blut und so. Hat dem Knaben das Hemd ruiniert. Dieser Knabe ist der Lieblingsneffe des Polizeichefs in Las Vegas.“
Ich hatte damals noch kein Gefühl für Abstufungen. Cheech war ein richtig harter Brocken, ein Killer, ein schwerer Spieler, vielleicht sogar einer von den Gangstern, die in Vegas das Sagen hatten. Was war daneben schon der Neffe des Polizeichefs der Stadt? Und was sollte schon seine blöde blutende Nase? Ich äußerte das laut. Cully genoß die Chance, mich zu belehren.
„Also, das mußt du verstehen“, sagte er. „Der Polizeiboss von Las Vegas ist sowas wie früher die alten Könige. Er ist ein großes fettes Roß und trägt ’nen Stetson und ein Holster mit ’nem 45er drin. Seine Familie sitzt schon ewig in Nevada. Die Leute wählen ihn jedes Jahr wieder. Sein Wort ist Gesetz. Jedes Hotel in der Stadt zahlt ihm Prämien. Jedes Casino flehte ihn an, sein Neffe solle für sie arbeiten, und man bot ihm Spitzenbezahlung als Bakkarat-Croupier. Der sahnt soviel ab wie der Ladderman. Und jetzt mußt du wissen, daß der Polizeiboss die Verfassung der Vereinigten Staaten und die Bill of Rights für einen Fehltritt von milchbärtigen Oststaatlern hält. So muß sich zum Beispiel jeder Besucher, der irgendwas Kriminelles auf dem Kerbholz hat, sofort melden. Und glaub mir, er tut’s besser. Unser Chief mag auch keine Hippies. Hast du bemerkt, daß es in der Stadt keine langhaarigen Burschen gibt? Schwarze, also auf die ist er nicht wild. Oder Landstreicher und Bettler. Vegas ist vielleicht die einzige Stadt in USA, wo’s keine Bettler gibt. Er mag die Puppen. Gut für’s Casinogeschäft. Aber er kann Zuhälter nicht leiden. Es stört ihn nicht, wenn ein Dealer davon lebt, daß seine Puppe auf’n Strich geht oder so. Aber wenn irgend so ’n schlauer Kerl sich ’ne Reihe Mädchen aufbaut, dann Vorsicht. Huren hängen sich immer wieder in ihren Zellen auf, schneiden sich die Pulsadern durch. Bankrotte Spieler bringen sich um. Verurteilte Mörder, Bankbetrüger. Eine Menge Leute bringen sich im Gefängnis um. Aber hast du schon je davon gehört, daß ein Zuhälter Selbstmord macht? Also, Vegas hält den Rekord. Im Kittchen von unserm Chef haben sich schon drei Macker umgebracht. Dämmert dir vielleicht jetzt was?“
„Aber was ist mit Cheech los?“ fragte ich. „Ist er im Knast?“
Cully lächelte. „Er ist gar nicht bis dahin gekommen. Er hat versucht, Gronevelts Hilfe zu kriegen.“
Jordan murmelte: „Xanadu Nummer eins?“
Cully sah ein wenig verblüfft drein.
Jordan lächelte. „Ich höre zu, was die Telefonpagen ausrufen, wenn ich nicht spiele.“
Eine Weile lang wirkte Cully ein wenig verwirrt. Dann redete er weiter.
„Cheech bat Gronevelt, ihm zu helfen und ihn aus der Stadt rauszubringen.“
„Wer ist Gronevelt?“ fragte ich.
„Das Hotel gehört ihm“, sagte Cully. „Und laß dir sagen, der saß ganz schön in der Scheiße. Cheech ist nämlich nicht allein, weißt du.“
Ich schaute ihn fragend an. Ich hatte keine Ahnung, was er meinte.
„Cheech hat Verbindungen“, sagte Cully bedeutungsvoll. „Trotzdem, er mußte ihn dem. Chef geben. Drum liegt Cheech jetzt im Städtischen Krankenhaus. Er hat einen Schädelbruch, innere Verletzungen und braucht kosmetische Operationen.“
„Jesus“, sagte ich.
„Widerstand bei der Verhaftung“, sagte Cully. „Das ist unser Chef. Und wenn Cheech sich erholt hat, darf er nie wieder nach Vegas kommen. Aber außerdem wurde der Pit-Boss gefeuert. Der war dafür verantwortlich, auf den Neffen aufzupassen. Der Chef gibt ihm die Schuld. Und jetzt darf der nicht mehr in Vegas arbeiten. Wird sich ’nen Job in der Karibik suchen müssen.“
„Keiner sonst stellt ihn ein?“ fragte ich.
„Das ist es nicht“, sagte Cully. „Aber der Chef hat ihm erklärt, er will ihn nicht mehr in der Stadt sehen.“
„Und das reicht?“ fragte ich.
„Das reicht“, antwortete Cully. „Da gab’s mal einen Pit-Boss, der schlich sich wieder in die Stadt und arbeitete in einem anderen Job. Der Chef kam zufällig vorbei und zerrte ihn einfach aus dem Casino. Drosch ihn, bis er Scheiße schwitzte. Danach hatten alle begriffen.“
„Aber wie zum Teufel kommt er denn mit so ’nem Scheiß durch?“ sagte ich.
„Weil er ein regulär gewählter Vertreter des Volkes ist“, sagte Cully. Und da lachte Jordan zum erstenmal laut. Ein grandioses Gelächter. Und die Zurückhaltung und Kälte, die von ihm immer auszugehen pflegten, waren damit fortgeschwemmt.
Später am Abend brachte Cully Diane ins Foyer, wo Jordan und ich eben Pause machten. Sie hatte sich erholt von dem, was Cheech ihr in der vergangenen Nacht angetan haben mochte. Man sah es deutlich, sie kannte Cully ziemlich gut. Und außerdem wurde klar, daß Cully sie uns, Jordan und mir, als Köder unter die Nase hielt. Wir konnten mit ihr ins Bett steigen, wann immer wir wollten.
Cully machte kleine Scherzchen über ihre Brüste, ihre Beine, ihren Mund, wie hübsch das alles sei und wie sie ihre schwarze Haarmähne wie eine Peitsche benützte. Doch in die plumpen Komplimente mischten sich ernstgemeinte Bemerkungen über ihren guten Charakter, so Sachen wie: „Hier ist eins von den ganz wenigen Mädchen in der Stadt, die euch nicht ausnehmen.“ Oder: „Sie ist nie auf einen freien Einsatz aus. Sie ist ein prima Mädchen und gehört eigentlich gar nicht in diese Stadt.“ Und dann, um seine Zuneigung zu beweisen, hielt er Diane die Handfläche hin, damit sie nicht nach dem Aschenbecher greifen mußte, um ihre Zigarettenasche abzustreifen. Es war eine primitive Galanterie, aber hier in Vegas von gleichem Wert, wie wenn man einer Herzogin die Hand küßte.
Diane war sehr still, und mich verstimmte es ein wenig, daß sie sich mehr für Jordan interessierte als für mich. Hatte ich sie nicht gerächt wie der edle Ritter? Hatte ich nicht den schrecklichen Cheech ihretwegen gedemütigt? Aber als sie aufstand, um ihre Runde als Anreißerin beim Bakkarat zu übernehmen, beugte sie sich zu mir herunter und küßte mich auf die Wange, lächelte ein bißchen traurig und sagte: „Ich bin froh, daß Sie okay sind. Ich hab’ mir Sorgen um Sie gemacht. Aber Sie sollten nicht so verwegen sein.“ Und dann war sie weg.
In den folgenden Wochen erzählten wir einander unsere Lebensgeschichte und lernten uns kennen. Der Drink am Nachmittag wurde zu einem Ritual, und meistens aßen wir auch zu Abend gemeinsam, um ein Uhr nachts, wenn Diane ihre Runde am Bakkarat beendet hatte. Aber es hing immer davon ab, wie sich unser Spiel entwickelte. Wenn einer von uns heiß wurde, ließ er die Mahlzeiten ausfallen, bis sich sein Glück wendete. Am häufigsten passierte es Jordan.
Doch dann gab es die langen Nachmittage, an denen wir draußen am Swimming-pool saßen und unter der brennenden Wüstensonne redeten. Oder mitternachts über den in Neon ertrinkenden Strip wanderten, vorbei an den glitzernden Fata Morganas der Hotels inmitten der weiten Wüste.
Jordans Geschichte schien die simpelste und banalste zu sein und er der am wenigsten ungewöhnliche Mensch in unserer Gruppe. Er hatte ein völlig ungetrübtes Leben geführt, ein Schicksal gehabt wie tausend andere auch. Er war sowas wie ein Managergenie gewesen und besaß mit fünfunddreißig seine eigene Firma, die Stahl kaufte und verkaufte. Als Mann der mittleren Kategorie konnte er ganz angenehm leben. Er heiratete eine schöne Frau, und sie hatten drei Kinder, ein großes Haus und alles, was sie sich wünschten. Freunde, Geld, Berufserfolg und echte Liebe. Und das dauerte zwanzig Jahre lang. Doch dann wuchs seine Frau, wie Jordan es ausdrückte, aus ihm hinaus. Er hatte seine ganze Energie darauf verwendet, seine Familie gegen die dschungelhafte Wirtschaft abzusichern. Es hatte seines ganzen Willens und seiner gesamten Energie bedurft, sie vor diesen Schrecken zu schützen. Seine Frau hatte getreulich ihre Pflichten als Gattin und Mutter erfüllt. Aber dann war eine Zeit gekommen, in der sie mehr als nur dies vom Leben erwartete. Sie war eine geistreiche Person, wißbegierig, intelligent, belesen. Sie verschlang Romane und Theaterstücke, ging in Museen, war in allen Kulturzirkeln der Stadt zu finden und teilte alle diese Freuden mit Jordan. Er liebte sie noch tiefer. Bis zu dem Tag, da sie ihm erklärte, sie wolle sich scheiden lassen. Da hörte er auf, sie zu lieben, und er hörte auch auf, seine Kinder und seine Familie und seine Arbeit zu lieben. Er hatte das Menschenmögliche für die Seinen getan. Er hatte sie vor allen Gefahren der Außenwelt abgeschirmt, hatte eine Festung aus Geld und Einfluß für sie errichtet und hätte sich nie träumen lassen, daß die Zugbrücke von innen geöffnet werden könnte.
Er erzählte die Geschichte zwar nicht so, aber ich nahm es so auf. Er sagte nur einfach und schlicht, daß er nicht „mit seiner Frau mitgewachsen“ sei. Daß er zu tief im Beruf gesteckt habe und sich daher zuwenig um seine Familie kümmern konnte. Daß er seiner Frau überhaupt nicht böse gewesen sei, als sie sich scheiden ließ und einen seiner Freunde heiratete. Weil dieser Freund ihr eben so sehr ähnlich war: sie hatten den gleichen Geschmack, die gleiche Art von Witz, die gleiche Lust, das Leben zu genießen.
Also hatte Jordan allem zugestimmt, was seine Frau forderte. Er hatte seine Firma verkauft und ihr das ganze Geld gegeben. Sein Rechtsanwalt sagte ihm, er sei viel zu großzügig, er werde es später bereuen. Aber Jordan sagte, er sei gar nicht großzügig, denn er könne noch eine ganze Menge neues Geld verdienen, aber seine Frau und ihr neuer Mann könnten das nicht. „Ihr glaubt es mir vielleicht nicht, wenn ihr mich spielen seht“, sagte Jordan, „aber ich bin angeblich ein bedeutender Geschäftsmann. Ich habe aus den ganzen Staaten Angebote bekommen. Wenn mein Flugzeug nicht in Vegas gelandet wäre, würde ich mich jetzt an meine erste Million in Los Angeles ranarbeiten.“
Es war eine gute Geschichte, aber für mich hatte sie einen falschen Zungenschlag. Er war einfach ein zu netter Typ. Das Ganze war zu gesittet.
Was an der Sache faul war, das war, daß er in keiner Nacht schlief, wie ich wußte. Jeden Morgen wanderte ich ins Casino und würfelte, um mir Appetit aufs Frückstück zu verschaffen. Und immer fand ich Jordan am Craps-Tisch. Klar hatte er die ganze Nacht durchgespielt. Manchmal, wenn er müde war, fand man ihn in den Roulette- oder Blackjack-pits. Und je mehr die Tage vergingen, desto schlimmer und schlimmer sah er aus. Er wurde immer hagerer, seine Augen schienen von rotem Schleim zu triefen. Doch er war stets freundlich und zurückhaltend. Und er sagte niemals auch nur ein Wort gegen seine Frau.
Manchmal, wenn Cully und ich allein im Foyer waren oder allein aßen, sagte Cully: „Glaubst du dem verdammten Jordan? Glaubst du wirklich, daß ein Kerl sich von einem Weib dermaßen durcheinanderbringen läßt? Und kannst du dir vorstellen, wieso der über die redet, als ob sie die beste Fotze wär’, die’s je gegeben hat?“
„Sie ist kein Weibsstück“, sagte ich. „Sie war schon jahrelang seine Frau. Die Mutter seiner Kinder. Sie war der Fels, auf den er seinen Glauben setzte. Er ist ein altmodischer Puritaner, der von einem Glaskuller aus der Bahn gebracht wurde.“
Es war dann Jordan, der mich zum Reden brachte. Einmal sagte er: „Du fragst ziemlich viel, aber du selber sagst ziemlich wenig.“ Er hielt einen Moment inne, als überlege er sich, ob er wirklich so interessiert sei, die Frage zu stellen. Dann sagte er: „Wieso bleibst du so lang hier in Vegas?“
„Ich bin Schriftsteller“, sagte ich. Und erzählte dann weiter. Die Tatsache, daß ich einen Roman veröffentlicht hatte, beeindruckte beide, und derartige Reaktionen haben mich schon immer amüsiert. Aber was die zwei wirklich erstaunte, war, daß ich einunddreißig war und vor meiner Frau und meinen drei Kindern geflüchtet war.
„Also ich hätte dich höchstens für fünfundzwanzig gehalten“, sagte Cully. „Und außerdem hast du ja keinen Ehering.“
„Ich habe nie einen getragen“, sagte ich.
Jordan sagte spöttisch: „Du brauchst keinen Ring. Du siehst auch ohne schon schuldbewußt genug aus.“ Aus irgendeinem Grund konnte ich mir nicht denken, daß er so einen Witz riß, als er noch verheiratet war und in Ohio lebte. Er hätte das damals für unhöflich gehalten. Oder daß solche Freiheiten eigentlich nicht zu ihm paßten. Oder daß seine Frau so etwas zu ihm sagte und er es, einfach in seinem Sessel zurückgelehnt, anhörte und es genoß, weil sie sich das leisten konnte, er aber nicht. Mir machte es jedenfalls nichts aus. Also erzählte ich ihnen die Geschichte von meiner Heirat, und dabei kam auch heraus, daß die Narbe auf meinem Bauch, die ich ihnen gezeigt hatte, keine Kriegsverletzung war, sondern von einer Gallenoperation stammte. An diesem Punkt meiner Erzählung lachte Cully und sagte: „Du verdammter beschissener Künstler.“
Ich zuckte die Achseln, lächelte und erzählte weiter.