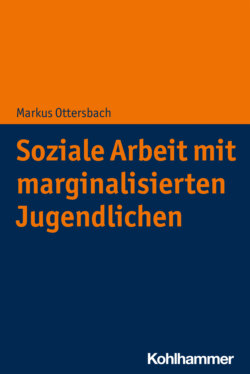Читать книгу Soziale Arbeit mit marginalisierten Jugendlichen - Markus Ottersbach - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Literaturempfehlungen
ОглавлениеBeck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Bourdieu, Pierre (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Reinhard Kreckel (Hg.): Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt Sonderband 2). Göttingen: Verlag Otto Schwarz & Co, S. 183–198.
Bourdieu, Pierre (1997): Zur Genese der Begriffe Habitus und Feld. In: Bourdieu, Pierre (Hg.): Der Tote packt den Lebenden. Schriften zu Politik und Kultur 2 (hg. von Margareta Steinrücke). Hamburg: VSA-Verlag, S. 59–78.
Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Müller, Hans P. (1992): Sozialstruktur und Lebensstil. Der neue theoretische Diskurs über soziale Ungleichheit. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
6 An einigen Stellen spricht Beck (1986, S. 194f.) von Lebensformen, obwohl Lebensformen weitaus mehr sind als Beziehungsformen und er sich vor allem auf Formen sozialer Beziehungen bezieht.
7 Pluralisierung und Individualisierung sind aber nicht deckungsgleich. Sie bedingen sich nicht gegenseitig, da Pluralisierung ohne Individualisierung möglich ist. Gesellschaften können pluralistisch sein, ohne gleichzeitig eine Individualisierung zu realisieren. Individualisierung entsteht erst, wenn der Aspekt der freiwilligen und notwendigen Wahl realisiert ist. Deshalb ist Pluralisierung eine wichtige, aber keine hinreichende oder notwendige Voraussetzung für Individualisierung (vgl. hierzu Wohlrab-Sahr 1997, S. 27f.).
8 Giddens (1996, S. 84f.) interpretiert das Modell der Weltsystemtheorie als eindimensional, weil es lediglich die ökonomische Globalisierung berücksichtigt. Er (ebd., S. 92f.) differenziert zwischen vier Dimensionen der Globalisierung, dem kapitalistischen Weltsystem, dem System der Nationalstaaten, der industriellen Entwicklung mit dem Aspekt der internationalen Arbeitsteilung und der militärischen Ordnung. Ein weiterer, alle Dimensionen überwölbender Aspekt der Globalisierung ist die kulturelle Globalisierung in Form der Kulturtechniken, die ein wesentliches Element der reflexiven Moderne und der Diskontinuitäten, »(…) die zu einer scharfen Trennung des Modernen vom Traditionalen geführt haben« (ebd., S. 100), darstellt.
9 Zurzeit neigen z. B. Regierungen in Polen oder Ungarn einerseits dazu, rechtsstaatliche Errungenschaften wie eine unabhängige Justiz oder freie Medien zu bekämpfen, und andererseits, traditionelle Institutionen wie Familie, Kirche etc. gegenüber neuen sozialen Gemeinschafts- und Beziehungsformen besonders zu schützen und zu fördern.
10 Bourdieu führt auch noch das symbolische Kapital an (vgl. Bourdieu 1983), das eine Art übergeordnete Rolle innehat. Unter symbolischem Kapital versteht er die jeweilige Konkretisierung von ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital. Alle drei Kapitalsorten finden ihren Ausdruck in Formen des symbolischen Kapitals, das eingesetzt wird, um den Lebensstil zu repräsentieren.
11 Der Unterschied zwischen Gesetzen und Normen wird vor allem bei den Auswirkungen und Folgen bei Verstößen sichtbar. Im Grunde sind Gesetze verpflichtend und Normen freiwillig. Bei Verstößen gegen Gesetze erfolgt – je nach Schwere der Gesetzesverletzung – eine gerichtliche Verurteilung mit anschließendem Strafvollzug, bei Verstößen gegen Normen erfolgen meist Disziplinarmaßnahmen.
12 Bereits Weber (1980, S. 236ff.) sprach von Lebensführung, Lebensgewohnheiten, Lebensgepflogenheiten oder von Habitus und bezog sich dabei auf eine von Standeszugehörigkeit und Bildung beeinflusste Ausdrucksform, deren Funktion darin besteht, Identität und Distinktion zu symbolisieren und als Mittel zur Schließung sozialer Beziehungen bzw. zur Aneignung von Lebenschancen einer Statusgruppe zu dienen (vgl. auch Müller 1992, S. 371ff.). Während Weber bei der Definition seines Lebensstilbegriffs den kapitalistisch motivierten, utilitaristisch-zweckrationalen Lebensstil vor Augen hatte, ist der Begriff später von Simmel in Bezug auf seinen identitätsstiftenden Aspekt weiterentwickelt worden (vgl. hierzu Ritter 1996, S. 61ff.).