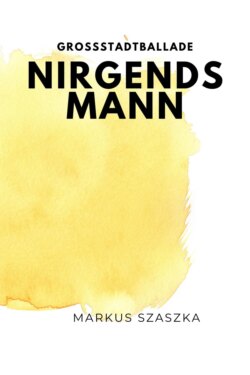Читать книгу Nirgendsmann - Markus Szaszka - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеIch lehnte über dem Fensterbrett in meiner Küche, inhalierte den todbringenden Qualm meiner treuen Lucky und sah zur anderen Straßenseite rüber. Mit meinen Fingern strich ich langsam über die Furchen auf meiner Stirn, die nur dann auftauchten, wenn ich mich sorgte. Das lange Verharren in dieser Haltung ließ meine Ellbogen schmerzen, doch derart in meinen Gedanken gefangen, merkte ich nicht viel davon. Ich bewegte mich noch weniger, als ein bekifftes Faultier es an diesem warmen Spätsommerabend getan hätte. Nur die kaum wahrnehmbaren Bewegungen meiner Finger, Handgelenke, Augenlider und Lippen hätten einem vorbeigehenden und zufällig hochsehenden Passanten Anhaltspunkte geliefert, dass es sich bei mir um einen Menschen und nicht um eine Schaufensterpuppe handelte, was in dieser bis zum Anschlag hippen Stadt nichts Ungewöhnliches gewesen wäre.
Das gegenüberliegende Fensterbrett erforderte meine ganze Aufmerksamkeit und ließ nicht zu, dass ich mich abwandte. Es war bereits die dritte Zigarette, die ich rauchte, obwohl es nur eine kurze Pause werden sollte und ich zurück an die Arbeit wollte. Das Fensterbrett, eines von vielen, gehörte zu einem riesigen, verlassenen Fabrikgebäude, dessen volle Größe ich von meiner Wohnung aus bestaunen konnte. Wozu das Gebäude einst gedient hatte, wusste ich nicht. Es hatte ein beeindruckend großes, massives Eingangstor aus grün lackiertem Holz, vier Stockwerke und ein burgunderrotes Schindeldach. Der graue Putz war größtenteils abgeblättert und offenbarte deutlich ansehnlichere Backsteinziegel. Manche der leicht zerbrechlichen, hohen und undurchsichtigen Industriefenster waren zerbrochen und gaben den Blick auf Teile des Holzbodens und Maschinen im Inneren des Gebäudes frei. Von meiner Position aus ähnelte dieser Anblick einem Puzzle. Die Fenster waren von innen verstaubt und von außen schmutzig vom Straßendreck. Viele von ihnen reflektierten dennoch ein goldenes, leuchtendes M, das auf meiner Straßenseite über den Köpfen der Berliner Gesellschaft in die Höhe ragte. Auch das Fenster gegenüber von mir, das mit dem Fensterbrett, auf das ich starrte, war mit neongelber Farbe gefüllt.
Es war schon der zweite Abend, an dem etwas nicht stimmte und mich der Anblick des schmalen Blechteils vor mir beunruhigte. Für gewöhnlich flatterte in etwa zu dieser Zeit ein Taubenpärchen herbei, um sich auf dem unappetitlich zugekoteten Sims, ihrem angestammten Heim, zur Nachtruhe niederzulassen. So war es jeden Abend gegen siebzehn Uhr gewesen, zumindest während der paar Wochen, in denen ich nun in der Torstraße wohnte. Ich mochte es, die beiden dabei zu beobachten, wie sie nebeneinander schliefen, wie sie ihre Hinterteile oder ihre ausladenden Brustkörbe aneinander kuschelten, wie das Weibchen dem Männchen in den Schnabel pickte, als ob sie ihn küsste, oder wie das größere Männchen dem kleineren Weibchen einen Flügel über den Rücken legte, als ob er sie zu wärmen versuchte.
Mir gefielen sie sehr gut. Sie waren romantisch, viel romantischer, als ich es seit langem mit irgendwem gewesen war, und bei Gott romantischer, besser gesagt bei Zufall romantischer, als diese ganze Stadt es war. Sie gefielen mir, weil sie anders waren als ich, anders als alle in Berlin, die einzig wahren Hipster; zwei zerrockte Taubenseelen, nicht schön anzusehen, mit zerzaustem Gefieder, vom harten Straßenleben gezeichnet, doch wahrlich ineinander verliebt, treu, füreinander da, komme, was wolle.
Ich hatte mir die Regel aufgestellt, nicht in der Wohnung zu rauchen, auch wenn ich allein war und es niemanden gestört hätte. Mein angestammtes Raucherfenster war das in der Küche. Meine Nikotinsucht band mich also an diese beiden Vögel und somit auch an deren Schicksal. Ihr Anblick machte mich glücklich und erweichte mein Herz, was es dringend nötig hatte, da es in den letzten paar Jahren meines damals zweiunddreißigjährigen Lebens stetig härter geworden war, eine Hornhaut bekommen hatte. Im Nachhinein kann ich sagen, dass es noch immer das eines kleinen verletzbaren Jungen war, aber versteckt, hinter einer schwer zu durchdringenden, krustigen Schicht aus Alkohol, Cannabisstaub und den Resten der Begegnungen mit Menschen, die schon vor mir abgehärtet worden waren, durch Umstände, von denen ich nichts wusste.
An diesem Abend war der Tauberich allein, so wie schon am Abend zuvor. Vierundzwanzig Stunden lang hatte er auf seine Frau gewartet, die seit gestern nicht von ihrer täglichen Futtersuche zurückgekehrt war. Normalerweise waren die beiden tagsüber unterwegs, doch an diesem Donnerstag hatte der Tauberich keinen Rundflug unternommen, hatte nicht nach Futter Ausschau gehalten und war an Ort und Stelle sitzen geblieben, um verwirrt und unruhig herumzuschauen, es zu suchen, das Weibchen, mit dem er wer weiß wie viele Jahre gemeinsam verbracht hatte. Noch ahnte er es nicht, und auch ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch Hoffnung, aber sie kam nicht wieder. Vielleicht war die Vermisste Opfer einer Frontschürze oder eines gefräßigen Katers geworden, auch das wusste ich nicht, aber ich wusste, dass mich der Anblick des vereinsamten Tauberichs mitnahm.
Ich versuchte, mich möglichst tief in dieses bedrängende Gefühl hineinzuversetzen, es auszukosten, so intensiv und so lange es ging. Es machte mir Spaß, traurig zu sein. Zu selten waren solche Momente in meinem Leben geworden, also galt es, die Gunst der Stunde zu nutzen. Ich versuchte, von jeder kleinen Bewegung des Vogels auf dem gegenüberliegenden Fensterbrett Notiz zu nehmen. Die im kühler werdenden Wind hin und her wogenden Federn, die an der Hausmauer kauernde Sitzposition des Tieres und sein verlorener Blick blieben mir besonders gut im Gedächtnis. Als ein Pfarrer in einer der Nachbarstraßen die Kirchenglocke zur vollen Stunde zu läuten begann, verlieh ihr Klang dem traurigen Bild eine weitere melancholische Facette, und es wurde zunehmend schwer, traurig zu bleiben, weil die akustische Untermalung, die der liebe Zufall geschickt haben musste, derart passend geraten war. Die Schwermut schwand, doch das Glück, nach langer Zeit wieder eine profunde Empfindung gekostet zu haben, blieb.
Der Bann der Fensterbrett-Story ließ mich langsam los. Morgen würde ich noch einmal nach dem armen Kerl schauen, beschloss ich, richtete mich auf, drückte den seit mehreren Minuten bis auf den Filter abgebrannten Zigarettenstummel im Deckel eines Einmachglases aus, der mir auf meinem Fensterbrett gute Dienste leistete, und rieb mir die Ellbogen, die vom langen Abstützen wund geworden waren.
Ohne einen bestimmten Grund warf ich noch einen Blick auf die Straße, wo die eigentliche Show stattfand. Ich sah die Zukunft, wie sie in Science-Fiction-Filmen des späten zwanzigsten Jahrhunderts dargestellt worden war, allerdings weit weniger perfekt, als die Menschen sie sich vorgestellt hatten. Ich sah den abendlichen Berufsverkehr und ein paar Passanten, die mit hochleistungsfähigen Smartphones in ihren Händen und verstaubten Gesinnungen in ihren Köpfen herumliefen, unfähig, irgendetwas davon vernünftig zu nutzen. Ich sah, dass kaum einer etwas unternahm, um diese sterbende Welt besser zu machen, obwohl die meisten alle Möglichkeiten dazu gehabt hätten. Ich sah, dass sich diese lauten Winzlinge stattdessen lieber darstellten und versuchten, so gut es ging mit brillantem Einfallsreichtum der Wirklichkeit zu entfliehen. Bequemlichkeit ging vor, Tugenden waren fast vergessen, sich selbst zu belügen, war zum Volkssport geworden.
Ich sah mich selbst dort unten.
Alles war beim Alten, 2018, in Berlin, auf der Torstraße.