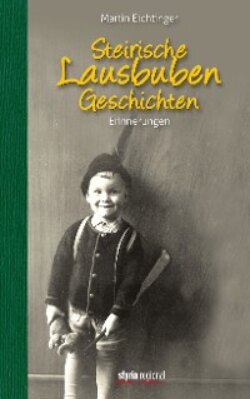Читать книгу Steirische Lausbubengeschichten - Martin Eichtinger - Страница 8
ОглавлениеDie handelnden Personen
Frau Sirf
Unsere Nachbarin, deren familiäre Wurzeln in das Abstaller Becken im heutigen Slowenien zurückreichten, war eine stolze Großbäuerin. Das Schicksal hatte es mit ihr nicht sehr gut gemeint. Jung und kinderlos verwitwet bewirtschaftete sie mit nur einer Magd einen mittelgroßen Bauernhof, dessen Felder genug Ertrag für ein Dutzend Stück Großvieh, Schweine und reichlich Federvieh brachten. Schließlich adoptierte sie den unehelichen Sohn ihrer Magd in der Hoffnung, einen Erben für den Bauerhof gefunden zu haben. Diesen zog es aber in die weite Welt, und auch die Magd verließ den Hof. Frau Sirf verpachtete die meisten ihrer Felder und Wälder und schränkte ihren Viehbestand auf das ein, was sie selbst zu ihrem Leben brauchte.
Frau Počič
Auch unsere zweite Nachbarin war verwitwet. Doch hatte sie einen Sohn, der sich mit seiner Familie in Mureck niedergelassen hatte. Die beiden Enkelkinder waren in ihrer Jugend – sie waren etwas älter als wir – häufige Gäste bei der Großmutter und oft auch unsere Spielgefährten. Der Hof von Frau Počič hatte viel weniger Grund als jener von Frau Sirf. Solange ich mich zurückerinnern kann, lagen die beiden Bäuerinnen in einem freundschaftlich-rivalisierenden Wettstreit. Wer hatte den ersten Fernseher, wer das schönere Haus, wer das bessere Geselchte. An manchen Tagen wurde das Gartentor im Zaun, der die beiden Grundstücke und Bauernhöfe trennte, versperrt, weil man sich nicht ausstehen konnte, nur um dann bald darauf wieder in trauter Zweisamkeit mit den großen alten Puch-Fahrrädern nach Mureck in die Kirche zu fahren.
Frau Zwirnik
Es muss die harte Arbeit am Feld gewesen sein, für die es damals in den Sechziger- und Siebzigerjahren nur wenig maschinelle Unterstützung gab – schon ein Traktor war nur etwas für die größeren Bauernhöfe –, sicher auch ein Grund für den frühen Tod vieler Bauern. So war auch Frau Zwirnik Witwe. Sie bewohnte das kleine Bauernhaus am Ende der langen Geraden, die von unserem Haus nach Norden führte, und an dem vorbei man um eine scharfe Kurve fuhr, ehe – nach einer weiteren Kurve – die ersten Bauernhäuser von Weitersfeld-Dorf auftauchten. Von Frau Zwirnik, einer kleinen Person, die immer leicht nach vorne gebeugt in schnellen Trippelschritten an unserem Haus vorbei zu Besuch bei ihren zwei Freundinnen kam, ist mir seltsamerweise ihre Korbtasche in Erinnerung. Diese aus Stroh geflochtene Korbtasche mit Lederhenkeln konnte sie bei ihren Fahrten nach Mureck auch über die Lenkstange ihres Rades hängen. In diesem Falle war sie schon von weitem zu erkennen, wenn sie, mit Mantel und Kopftuch bekleidet – die Bäuerinnen in der Gegend waren selten ohne Kopftuch unterwegs –, die lange Gerade heruntergeradelt kam und beim Kreuz in die Straße nach Mureck einbog. Frau Zwirnik hatte eine finstere Stube, in die wir Kinder nicht sehr gerne gingen. Der benachbarte Wald, das Schneeglöckchen- und Krokusparadies von Weitersfeld, warf seinen Schatten auf ihren Hof. Sie nähte viel bei Tag ohne Licht, und ich wunderte mich stets, wie sie dies schaffte.
Stockerwirt
Am Dorfplatz gelegen, war dieses Dorfgasthaus die zentrale Umschlagstelle für den Tratsch des Dorfes. Anglerlatein, also die leichte bis schwere Übertreibung über die Größe der gefangenen Fische, war dort an der Tagesordnung, und mit jedem Bier wurden die Erzählungen fantastischer. Dabei wurde am Mühlgang und in der Mur von den Dorfbewohnern nur selten geangelt. Das war offensichtlich uns Städtern vorbehalten. Die Einheimischen waren mit dem Trauper unterwegs. Ein Trauper besteht aus einer vier bis fünf Meter langen Stange mit etwa fünf Zentimeter Durchmesser, an deren Ende ein Kreuz aus vier kurzen Metallröhren angebunden ist. In diese Röhren werden etwa eineinhalb Meter lange biegbare Eisenstangen gesteckt, die die vier Ecken eines quadratischen Fischnetzes auseinanderziehen. Der Trauperer legt mit der Stange das Netz in den Fluss und wartet eine Weile, bis die Fische wieder über die Stelle des Netzes schwimmen. Dann wird das Netz mit einem Ruck hochgehoben und nicht selten ist dann auch ein größerer Fisch mit drin. Von den Anglern, die mit Rute und Solin in waidmännischer Art Jagd auf Fische machten, wurden die Trauperer verächtlich als „Wasserseicher“ bezeichnet.
Herr Sturmmayer
Unweit des Stockerwirtes steht – mitten im Ort – ein großer Bauernhof, der größte des Ortes. Von ihm hatten meine Eltern das Grundstück für den Bau unseres Hauses gekauft, und er und seine Frau waren der Familie all die Jahre ganz besonders freundschaftlich verbunden. Beim Haus hieß es Fietsch, weshalb der Bauer, Josef mit Vornamen, oft auch Fietschn-Seppl genannt wurde. Der „Beim-Haus-Name“ oder Vulgo-Name war die Orientierungshilfe am Land schlechthin. Hatte ein Bauer eine Erbin eines Hofes geheiratet und sozusagen zugeheiratet, so war der Vulgo-Name des Hofes Garant dafür, dass jeder im Ort wusste, welches Gehöft gemeint war, auch wenn sich der Name des Eigentümers geändert hatte. Oft wurde die Geschichte des Bauernhofes in künstlerischer Ausgestaltung an der Hausmauer bis zum Namensgeber des Vulgo-Namens zurückverfolgt und stolz präsentiert. Dabei reichten die Namen mehrere Jahrhunderte zurück und zeigten die große geschichtliche Kontinuität der bäuerlichen Besiedlung in der Region.
Auf dem Hof des Sturmmayer-Seppl haben wir viel Zeit verbracht. Er hatte die schönsten Rinder weit und breit, einen sauberen Stall und war in der Rinder- und Schweinezucht sehr erfolgreich. Und er war der ungekrönte Schnapser-König des Dorfes. Dieses Kartenspiel konnten wir schon, bevor wir in die Schule kamen. Das entsprach dem viel erzählten Witz, dass die Kinder am Land vor Schulbeginn bis 66 zählen können, weil das die Grenze zum Gewinn der Schnapser-Partie ist. Seppl wusste beim Viererschnapsen nicht nur, wie viele Punkte jeder hatte, sondern auch bald, wer welche Karten in der Hand haben musste und welcher Weg zum Sieg führte, den man gegen ihn nur selten davontragen konnte. Gerne sind mein Vater, mein Bruder und ich, auch später noch in den Neunzigerjahren, bei Seppl zum Schnapsen eingekehrt.
Der General
Noch heute weiß ich seinen genauen Namen nicht. Er war überall der General. Seine großen Besitzungen schlossen westlich an die Felder von Frau Sirf an und reichten bis zur Ortsgrenze zwischen Weitersfeld und Lichendorf. Es waren kilometerlange Felder, die stets für Monokulturen, im Regelfall Mais, genutzt wurden. Für uns Kinder war es faszinierend, die unendliche Weite dieser Felder zu bestaunen. Dabei hatten wir auch eine Mutprobe der besonderen Art entwickelt: Mitten durch die Felder führte ein Feldweg (ein Roan), zwei stark verwachsene Fahrspuren mit einer hohen Mittelwölbung dazwischen, die es eigentlich nur Traktoren erlaubte, den Weg zu befahren. Von diesem Weg, den wir mit unseren Fahrrädern befuhren, schlugen wir uns durch das Maisfeld zum Mühlgang, wo wir gerne fischten und auch ein Haus gebaut hatten. Es ist gespenstisch, durch ein quadratkilometergroßes Maisfeld zu wandern, wenn der Mais übermenschengroß hochgeschossen ist. Leicht verliert man die Orientierung, auch wenn man in den Furchen zwischen den Maiszeilen geht. Und wenn man alleine unterwegs ist, dann befällt einen die Angst, aus dem Feld nie mehr herauszufinden.
Mitten in den Feldern – zu erreichen nur über den besagten Feldweg – stand das Haus des Generals, das er kaum je bewohnte. Angeblich war er viel auf Reisen in aller Welt unterwegs. Am westlichen Ende seiner Besitzungen hatte der General große Garagen und Geräteschuppen. Von alten Motorbooten über alte Autos bis zu ausrangierten landwirtschaftlichen Maschinen reichte das metallene Wirrwarr. Ein für Buben faszinierender Schrottplatz, aber auch ein Beweis für den Reichtum des Generals.