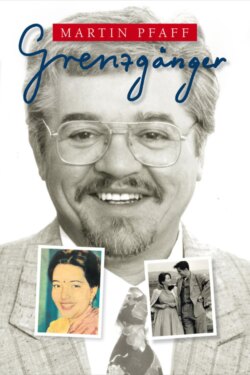Читать книгу Grenzgänger - Martin Pfaff - Страница 10
4. Auf dem Landweg nach Indien:
Auf den Spuren alter Kulturen
(1957 bis 1958) 4.1. Von Baden bei Wien nach Teheran:
Vorwärts in die Vergangenheit!
ОглавлениеAm Samstag, dem 28. September 1957, nach einem langen Abschied von meinen Eltern, war es so weit: Begleitet von den Tränen meiner Mutter und dem sorgenvollen Gesicht meines Vaters brachen wir um 15 Uhr 30 auf – in Richtung Graz. Als wir vom Helenental kommend am Badener Strandbad vorbeifuhren, erblickte ich eine ehemalige Tanzpartnerin, die mir immer noch nicht gleichgültig war. Sie ging mit ihrer Freundin spazieren.
„Entschuldige, Father! Ich will mich kurz von jemandem verabschieden!“ Und so geschah es: „Ich bin auf der Fahrt nach Indien. Ich wollte nur Lebewohl sagen!“ Ihre Augen weiteten sich, und in meinem Kopf kreisten viele Gedanken: Tat es ihr leid, dass wir uns niemals näher gekommen waren? Verstand sie meine Indienreise als eine Flucht aus einer für beide Seiten unbefriedigenden Beziehung? Gehemmt wie wir beide waren sagte sie kein Wort, außer einem kurzen Abschiedswunsch. Ich tat das gleiche. Damit war auch dieses rissige Band gekappt. Wir fuhren weiter.
In Graz begann ein Muster, das sich auf den folgenden Etappen unserer Reise wiederholen sollte: Father Abrahams Wunsch war es in der Regel, die örtlichen Würdenträger – in Graz den Bischof – zu besuchen, um Unterstützung für das anvisierte Projekt der Gründung einer Blindenschule zu bekommen.
Ich empfand den Aufbruch zur Reise auch als Aufbruch in meine Zukunft: als Erwachsener, als selbstbestimmter Mensch, als Mann. Ich war in Hochstimmung und bereit, die Welt zu erobern.
Am Montagabend, dem 30. September 1957, erreichten wir Leibnitz. Ich wählte ein komfortabel aussehendes Hotel. Nach dem Essen zog sich Father Abraham zur Nachtruhe zurück, und ich unterhielt mich mit einer jungen Dame, ungefähr in meinem Alter, bis zu später Stunde. Und so kam es, dass ich an diesem Abend im Alter von achtzehneinhalb Jahren „meine Unschuld verlor“ …
Am nächsten Morgen sagte sie beim Abschied: „Glaub ja nicht, dass ich immer so schnell zu haben bin. Bei dir habe ich eine Ausnahme gemacht.“
„Warum?“
„Weil du dem Schauspieler so ähnlich siehst!“
„Welchem Schauspieler?“, fragte ich neugierig.
„Ich kann mich an seinen Namen nicht erinnern!“
So viel zum Thema Illusionen.
Am nächsten Tag überquerten wir die Grenze nach Jugoslawien. Der Regen trug nicht gerade zur Aufhellung der Stimmung bei, auch nicht die Mienen der Menschen. In mein Tagebuch notierte ich: „Atmosphere dull and people gloomy.“ Der weitere Weg nach Belgrad fand auf einer guten Straße statt, mit wenig Verkehr, aber mit Rindern und Pferden auf der Fahrbahn.
Zu unseren „Ritualen“ des Kennenlernens einer neuen Station auf der Reise gehörte natürlich der Besuch der Heiligen Messe. Ich war sehr beeindruckt von den Gebeten und Gesängen in serbischer Sprache. Ebenso gehörte der Besuch beim Indischen Botschafter zu den Gepflogenheiten Father Abrahams.
Darüber hinaus besuchten wir in Belgrad die in einem Vorort gelegene Blindenschule, sowie ein gewaltiges Monument, an dem Diplomaten bei Ankunft im Land einen Kranz niederlegten, zum Zeichen ihres Respekts vor der Geschichte des Landes.
Nächste Station: Skopje. Wir waren zu Gast beim Erzbischof von Skopje und speisten mit ihm an diesem und am folgenden Tag. Am Morgen besuchten wir den Gottesdienst und danach die Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Ich war aufgeregt, zum ersten Mal eine Moschee – mit Hauptgebäude und Minarett – zu sehen. Erinnerungen an die Reisebeschreibung von Karl May über islamische Länder wurden wach, ein Hauch von Orient und Exotik.
Am Abend waren die Straßen voller Menschen: Das Flanieren zählte wohl zu den wenigen Vergnügungen der Bevölkerung. Die Menschen schienen sehr unglücklich zu sein. Ihre Lebensbedingungen zeigten Armut, Armut, Armut. Ich sah viele Menschen in den Dörfern, die barfuß umhergingen – im Oktober, bei Nässe und Kälte.
Ich war erstaunt, welch leichten Zugang Father Abraham sowohl zu katholischen als auch zu orthodoxen Priestern und Bischöfen hatte – und im weiteren Verlauf unserer Reise noch haben würde. Aber Father lieferte mir, auf meine Frage hin, sehr bald den Grund: „Du musst die Geschichte des Christentums in Indien und insbesondere in der Region Travancore (heute Kerala) kennen, um dies zu verstehen. Das Christentum kam schon im Jahr 52 n. Chr. nach Südindien. Der Apostel Thomas erreichte die Malabar-Küste, um der jüdischen Gemeinde die Botschaft vom Erlöser zu bringen. Schon im Altertum gab es Handel zwischen der Golfregion und Südindien: Mit dem Südwest-Monsun segelten Händler in Richtung Südosten bis an die Malabar-Küste. Mit indischen Handelswaren wie Gewürzen und Textilien und mit dem Nordost-Monsun im Rücken segelten sie dann nach Nordwesten zurück in die Golfregion. Jahrhunderte später kam Thomas der Syrer auf demselben Weg nach Südindien und war äußerst erstaunt, Christen vorzufinden. Diese Christen schlossen sich dann mit der syrisch-orthodoxen Kirche zusammen, deren Oberhaupt – der Patriarchos – im syrischen Homs residiert. Noch heute muss jeder, der Patriarchos werden will, einige Jahre in Südindien verbringen. Denn es gibt mehr Christen der syrisch-orthodoxen Kirche in Indien als in Syrien!“
Ich lauschte gebannt. Father Abraham fuhr fort: „Die syrisch-orthodoxe Kirche ist heute Mitglied im Ökumenischen Rat der Kirchen, in dem vor allem auch die Protestanten vertreten sind. Unter den südindischen Christen gibt es neben Orthodoxen, Katholiken und Protestanten auch einen Zweig der orthodoxen Kirche, der mit Rom uniert ist, also den Papst als Statthalter Christi auf Erden anerkennt. Als südindischer, aber orthodoxer Priester fühle ich mich frei, auf alle Religionsgemeinschaften zuzugehen – ob orthodox, katholisch oder protestantisch!“
Als Zisterzienserzögling war ich verblüfft über diese Flexibilität. Aber mir gefiel diese Offenheit gegenüber allen institutionellen kirchlichen Einrichtungen besser als eine enge Auslegung des christlichen Auftrags. „War Christus denn katholisch?“, fragte ich mich leicht ironisch.
Im Fall von Father Abraham war mir nicht ganz klar, ob er dem jeweiligen kirchlichen Würdenträger die Unterschiede der Institutionen des jetzigen Kerala erläuterte, oder ob er seine Gesprächspartner im Dunkeln ließ, weil er diese Unterschiede als trivial erachtete. Jedenfalls hörte ich seine Predigten in englischer Sprache und war wie alle übrigen Zuhörer fasziniert. Er sprach die Gefühle der Menschen besser an als alle Priester, die ich bisher kennengelernt hatte. Er hatte die Gabe, die Menschen durch sein Wort und seine Persönlichkeit zu begeistern: In seinen Händen wurden sie weich wie Wachs.
Bald merkte ich, dass Father sich dieser Macht durchaus bewusst war. Sein Handeln war also nicht nur von Gottvertrauen, sondern auch von Selbstvertrauen bestimmt: Es würde schon alles gut gehen!
Ein Teil seiner Wirkung war sicher auf sein Charisma zurückzuführen: Hier stand ein blinder Mann, der trotz seines Handicaps durch die Welt reiste. Ein Mann, der für die anderen blinden Menschen seines Landes etwas tun wollte, um ihr Leben zu verbessern. Jemand, den man bewundern konnte! Von Father Abraham erfuhr ich, dass Blindheit in der Regel definiert wird als ein Zustand, in dem ein Mensch nicht normal lesen und schreiben kann. Demnach bedeutet Blindheit nicht zwangsläufig ein totales Fehlen von visueller Wahrnehmung. Father Abraham konnte nicht völlig blind sein. Das wurde mir sehr bald durch zahlreiche Beobachtungen klar. Offensichtlich konnte er einiges wahrnehmen, Konturen, Unterschiede zwischen Licht und Dunkel, die Anwesenheit von Menschen. Wie weit dieses Ausmaß an Sehvermögen ging und ob es konstant war oder von den Umständen abhing, konnte ich nicht feststellen. Ihn zu fragen, oder gar zu hinterfragen, verbot mir der Respekt vor Priestern, den ich durch meine Erziehung in der Klosterschule erlangt hatte.
Die Reise mit dem sehbehinderten Pater änderte einen wesentlichen Faktor: Es war nicht daran zu denken, auf Campingplätzen zu übernachten, schon gar nicht in dem relativ kleinen Zelt. Die Benutzung der Toilette war für Father in einem westlich ausgerichteten Hotel unproblematisch, bei mediterranen Toiletten schon etwas schwieriger, aber bei den primitiven Toiletten auf Campingplätzen undenkbar. Also übernachteten wir fast ausnahmslos in Hotels oder Privathäusern.
Mit der Überquerung der Grenze nach Griechenland kamen wir erneut in ein anderes Land und fühlten uns wie in einer anderen Welt. Es fing an mit der guten Straße und setzte sich fort in den Mienen, der Kleidung und dem Verhalten der Menschen. Hier war ich nun endlich in dem Land, das der westlichen Zivilisation so viel gegeben hatte. Ich dachte an die Jahre des Büffelns der klassischen griechischen Sprache. Damals konnte ich noch längere Passagen der Odyssee aus dem Gedächtnis rezitieren. Noch Jahre später machte ich mir vor größeren Prüfungen oder einem wichtigen Vortrag Mut, indem ich die ersten Verse der Odyssee in meinen Gedanken rezitierte: „Andra moi ennepe Musa, polytropon hos mala pola …“ Damals in Griechenland hatte ich keine Ahnung, dass mein Leben tatsächlich einer Odyssee gleichen würde.
An einem Freitag, dem 11. Oktober 1957, überquerten wir die hohen Berge Nordgriechenlands. Der Anblick des Olymp war beeindruckend. Ich musste unbedingt auf einer kleinen Nebenstraße hinauf zu den Höhen des Olymp, dem Sitz der Götter in der hellenischen Mythologie. Der Weg führte durch eine zerfurchte Landschaft mit Gräben, Schluchten und vielen Felsen. Wir trafen nicht Zeus, den Göttervater, sondern lediglich eine Schafherde mit einem Hirten und dessen Hunden. Der Hirte hatte graue Haare, trug einen Schnurrbart und stützte sich lässig auf einen langen Stab. Seinen gestrickten Pullover verdeckte eine Jacke unbestimmbaren Alters. Die weite Hose konnte ein Erbstück von mehreren Generationen sein. Was beeindruckte, war das seltsam entrückte Lächeln, scheinbar über irdische Probleme erhaben, zufrieden mit sich und der Welt. Hier auf der breiten, steinigen Wiese, mit seiner Herde von hellen und dunklen Schafen und seinen treuen Hunden, hatte er wohl sein Idyll gefunden. Ich konnte keine Flöte entdecken – aber vielleicht war er doch Pan in Verkleidung? Auf solche Gedanken konnte man bei diesem hellblauen Himmel, dem klaren Licht und der kühlen Luft leicht kommen. Selbst seine Hunde waren scheinbar mit sich zufrieden und keineswegs aggressiv.
Über Eleusis (Elefsis), den Ort der alten Mysterienspiele, erreichten wir Athen. Von Sparta, Athen, Theben, Korinth und Delphi hatte ich schon lange geträumt. Selbst wenn ich keine weiteren archäologischen Stätten hätte besuchen können, so wäre meine Maturareise schon ein erheblicher Erfolg gewesen.
Wir wohnten im Hotel Alexandra und blieben eine ganze Woche in der Stadt. Für mich waren die Höhepunkte der Besuch der Akropolis, der Agora (des klassischen Marktplatzes) und der Universität Athen. Für Father stellten wohl der Besuch einiger Kirchen wie der Santa-Marina-Kirche sowie die Besichtigung der Blindenschule in Neo Phaleron bleibende Erinnerungen dar.
Meine Erinnerungen an große Philosophen wie Platon und Sokrates, an berühmte Dichter, an bahnbrechende Künstler wurden hier für mich viel realer und handfester. Parthenon, Erechtheion, Nike-Tempel und Propyläen – Teile dieses Tempels der Demokratie! Auf diese Griechenlandreise hatte mich meine humanistische Ausbildung vorbereitet – genauso wie auf die Reise zwei Jahre zuvor, als ich in per Autostopp bis nach Palermo getrampt war und dabei antike Stätten besucht hatte.
Mir wurde bewusst, wie sehr wir doch alle „Griechen“ und „Römer“ sind: durch unsere Art zu denken, durch Institutionen wie Gymnasium, Theater, Stadion, Parlament und vieles mehr. Wir stehen kulturell, politisch und wissenschaftlich auf den Schultern der Giganten des Altertums, meist ohne uns dieser Tatsache bewusst zu sein.
Ich erinnerte mich an den Rat, den Sokrates Phaetons Bruder Glaukon gab, der im Dialog mit Sokrates große Wissenslücken über das Gemeinwesen offenbarte, in dem er Ruhm und Ehre erlangen wollte: „Sei vorsichtig, Glaukon, dein Streben nach Ruhm könnte sonst ins Gegenteil umschlagen! Merkst du nicht, wie leichtsinnig es ist, etwas zu tun oder zu reden, wovon man nichts versteht? … Wenn du im Staate Hochachtung und Ruhm genießen möchtest, dann erarbeite dir zuallererst die Kenntnisse, welche du für die Aufgaben brauchst, die du lösen willst!“
Ich hatte mir schon im Gymnasium vorgenommen, den Fingerzeig des Sokrates zu befolgen, sollte ich einen ähnlichen Lebensweg gehen. Sicher würde es vielen in der Politik guttun, wenn sie den Rat des Sokrates beherzigten.
Nach einer ausführlichen Besichtigung der Ruinen von Eleusis fuhren wir zum historischen Delphi, dem geistigen Zentrum der alten Griechen, in ihren Augen der Nabel der Welt.
Vom Balkon unseres Hotelzimmers aus eröffnete sich schon in den frühen Morgenstunden ein fantastischer Blick über die Olivenhaine hinunter bis zum Meer. Je höher die Sonne stand, umso mehr trat das Tal aus dem Bereich der Schatten, umso mehr glänzte das Meer in der Ferne.
Den Anfang der Besichtigung bildete das Museum von Delphi mit Exponaten, die mehr als zweitausend Jahre Geschichte reflektierten: der bronzene Wagenlenker, die Sphinx und – etwas neueren Datums – die Statue des Augustus. Nachdenklich machte mich die Statue des jugendlichen Antinoos: Sein Gesichtsausdruck zeigt das Ende der sorgenfreien Jugend und den Beginn des ernsteren Mannesalters. Damit konnte ich mich identifizieren. Und ich dachte an Michelangelos David: War er vielleicht von dieser Statue inspiriert worden? Wir besuchten den Tempel des Apollon, die Stätte, an der die Priesterin – fälschlich „Pythia“ genannt – ihre berühmten Orakelsprüche offenbarte, sowie die Schatzhäuser, das alte Theater und vieles mehr.
Am 23. Oktober 1957 erreichten wir Istanbul. Wieder ein anderer – muslimisch geprägter – Kulturkreis: Hier war der Atem des Orients in den Moscheen, auf den Basaren und in der fremden Küche zu spüren. Gleichzeitig konnten wir die Zeichen der Geschichte nicht übersehen – die Hagia Sophia; die Blaue Moschee, die durch sechs Minarette geschmückt ist; der Sultanspalast Dolmabahçe-Serail.
Kleinasien war schon immer eine Brücke zwischen Asien, Afrika und Europa gewesen. Und die Konflikte zwischen Großreichen und anderen Regionen liefen oft über Kleinasien hinweg: die Perserkriege mit Griechenland und die Gegenkampagne Alexanders des Großen; das tausendjährige Byzantinische Reich, das auf seinem Höhepunkt Nordafrika, Ägypten, Palästina, Syrien, Anatolien, den Balkan, Dalmatien und Rom (einschließlich des italienischen Stiefels) umfasste; später die Araber, die seldschukischen und osmanischen Türken, deren Reich vom Persischen Golf bis zum Atlantik und vom Indischen Ozean bis vor die Tore Wiens reichte. Ein üppiges Menü für einen, der die Kulturgeschichte und politischen Entwicklungen jahrelang am humanistischen Gymnasium verschlungen hatte. Eine bessere Reise unmittelbar nach der Matura konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Ein besonderes Ereignis war der Besuch beim Patriarchen der griechisch-orthodoxen Kirche. Father und ich wurden zum Mittagessen eingeladen. Mein Gott – man stelle sich vor, man würde als Katholik vom Papst persönlich an den Mittagstisch gebeten! Für mich war das ein beeindruckendes Erlebnis, auch wenn mir die Abläufe beim Essen reichlich steif und ritualisiert in Erinnerung sind.
In Istanbul besorgten wir uns Visa für Syrien und den Libanon. Für unsere Reise wählten wir nicht den kürzeren Weg über die Osttürkei nach Persien, sondern unternahmen – dem Pfad Alexanders des Großen weitgehend folgend – einen Umweg nach Süden. Am Sonntag, dem 27. Oktober 1957, setzten wir den Fuß auf das asiatische Festland und fuhren nach Ankara. In Erinnerung blieb mir die moderne Stadt vor allem durch das Atatürk-Mausoleum: Es symbolisiert die Erinnerung an den großen Mustafa Kemal, genannt Atatürk, Vater der Türken. Seine charismatische Persönlichkeit wurde und wird von vielen Reformern in Entwicklungsländern als Vorbild angesehen. Damals konnte ich nicht vorhersehen, dass ich einige Jahre später die Tochter eines nicht weniger charismatischen Mannes heiraten würde, eines Inders, der Jahrzehnte nach seinem Tod in Indien einen ähnlichen Kultstatus besitzt wie Atatürk in der Türkei.
Zwei Tage später fuhren wir weiter gen Südosten und überquerten die Gebirgskette des Taurus mit seinen schneebedeckten Spitzen. Dramatisch der Kontrast zwischen den ausgetrockneten Ebenen und abgeernteten Feldern im Vordergrund und der dahinter aufragenden Bergkette mit ihren schneebedeckten Köpfen. Großartig auch der Blick von der Bergeshöhe hinunter in die Ebene und auf das Meer in der Bucht von Mersin.
Am nächsten Morgen brachen wir in Richtung Syrien auf. Durch die fruchtbare Ebene von Adana und um den Iskenderun-Golf herum gelangten wir zur Stadt Iskenderun („Alexandria ad Issum“). Unweit von hier focht Alexander – im arabischen Sprachraum „Iskander“ genannt – die zweite Entscheidungsschlacht gegen eine zahlenmäßig weit überlegene Armee von Persern, Medern und deren Hilfsvölkern. Schon bei der ersten Schlacht hatten sie den hüfttiefen Granicus-Fluss mit seinen steilen Flussbänken durchquert, bevor sie sich auf die gewaltige Armee der Perser stürzen konnten, mit Alexander an der Spitze seiner Kavallerie.
Bei Issus hatte der Perserkönig Darius seine Armee hinter den Makedoniern in Stellung gebracht. Dadurch hatte er sie gegen die hohen Berge und die Syrische Pforte – ein zentraler Pass auf dem Weg nach Syrien – eingekesselt. Alexander drehte den Spieß um, wandte sich zurück und überquerte den Pinarus-Fluss in Richtung der Perser. So erreichte er mit seinem Heer eine Engstelle zwischen dem Meer und den Bergen, bei der die Perser ihre zahlenmäßige Überlegenheit nicht ausspielen konnten. Die Phalanx-Bataillone griffen frontal an, während die von Alexander persönlich geführten Kavallerien mit einem lateralen Angriff von der Nähe der Hügel aus überraschten. Wie schon am Granicus brachte die überlegene Strategie Alexanders den Sieg. Der Perserkönig ergriff die Flucht.
Unsere Fahrt nach Süden führte durch Latakia und Antakya, das historische Antiochia: Hier hatte der heilige Petrus die erste christliche Kirche der Welt errichtet, hier hatte er nach der Version der syrisch-orthodoxen Kirche seinen Thron als Patriarch etabliert, hier wurden die Gläubigen zum ersten Mal als „Christen“ bezeichnet. Und hier sind noch die Überreste der Felsen und Höhlen zu sehen, in denen sich die Christen vor der Verfolgung durch die Juden versteckten.
„Wo befindet sich deiner Meinung nach das eigentliche geografische Zentrum des Christentums?“, fragte ich Father Abraham. „In Antiochia, wo der heilige Petrus angeblich seinen ersten Bischofssitz etablierte? Oder in Rom, wo er den Märtyrertod starb?“
Father überlegte nicht lange: „Jerusalem, wo Christus den Opfertod starb, ist das ideelle Zentrum. Aber danach kommt sicher Antiochia, nicht Rom! Rom ist das Ergebnis einer politischen Entscheidung: Kaiser Konstantin favorisierte das Christentum als ideologische Klammer, die sein Reich zusammenhalten sollte. Es ging ihm also mehr um eine einheitliche politische Ordnung als um seinen Glauben. Überliefert ist, dass er selbst sich erst auf dem Totenbett zum Christentum bekannte. Deshalb etablierte er Konstantinopel als ‚zweites Rom‘, im Rang unmittelbar nach Rom angesehen. Ohne Konstantin wäre die Geschichte der römisch-katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche anders verlaufen!“
In Damaskus wiederholte sich das inzwischen bekannte Muster: Beim Besuch der Indischen Botschaft wurden wir von einem Botschaftsangehörigen eingeladen, bei ihm und seiner Familie zu wohnen: Das Ehepaar Kurup hatte zwei größere Jungen im Alter von zehn und vierzehn Jahren und zwei kleinere Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, im Alter von sechzehn Monaten. Diese Hindufamilie hätte jedem Christen ein Beispiel für Nächstenliebe geben können: Wir lebten, aßen und schliefen hier für längere Zeit – und behielten die Freundlichkeit und Herzlichkeit dieser Menschen noch lange in Erinnerung.
Die Kurup-Familie bot uns eine Basis für den zwei Monate dauernden Aufenthalt in Damaskus. Von dort unternahmen wir Fahrten ins Umland sowie nach Beirut; und schließlich eine Schifffahrt von Beirut nach Alexandria. Dort nahmen wir ein Flugzeug nach Jordanien und besuchten die heiligen Stätten der Christenheit.
Jedem, der die Bedeutung des heiligen Paulus für die Entwicklung des Christentums kennt, stockt der Atem ob der historischen Bedeutung von Damaskus. Lebhaft erinnere ich mich an den orientalischen Basar, in dem alle Wohlgerüche des Orients zu Hause sind.
Father sprach nachdenklich: „Wenn ich daran denke, dass diese gesamte Region einmal christlich war …“
Und ich fragte: „Warum sind wohl schon in den Anfangsjahren so viele Menschen zum Islam übergetreten?“
„Ich glaube nicht, dass sie eine große Wahl hatten! Der Ansturm der Muslime gegen das Byzantinische Reich bedeutete in der Regel Bekehrung oder Tod für die Menschen in den eroberten Gebieten!“
„Aber heute noch wählen viele Menschen freiwillig den Islam als ihre Religion. Wenn ich mich nicht täusche, ist sie die zweitgrößte Religion in der Welt und diejenige mit der größten Zahl an Neuzugängen.“
„Ja“, erwiderte Father. „Das hat sicher seinen Grund …“
„Welchen? Worin liegt die Attraktivität des Islam?“
„Wenn ein Mensch sich dem einen wahren Gott hingibt – und Islam bedeutet genau diese Hingabe und Unterwerfung gegenüber Gott –, dann hat er ein geordnetes Universum von Geboten und Verboten. Das gibt ihm ein Gefühl der subjektiven Sicherheit und auch ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten!“
„Trifft dies nicht auf alle religiösen Gemeinschaften zu?“
„Ja, aber der Islam hat einige Elemente, die ihn für die Gläubigen besonders anziehend erscheinen lassen. Im Gegensatz zum westlichen Konzept der Trennung von Kirche und Staat basiert der klassische Islam auf der integrierten politischen und spirituellen Führung des Imam. Dies ergibt das geschlossene Weltbild, das ich eben angesprochen habe.“
„Ist das alles?“
„Viele Menschen überzeugen auch die sozialen Gebote – insbesondere das Zakat, die Verpflichtung, einen Teil seines Vermögens an die Armen und Bedürftigen zu geben. Und dazu kommt noch, dass es zumindest im Prinzip keine rassistische Diskriminierung geben darf. Letzteres ist vor allem in Afrika von Bedeutung, wenngleich die arabischstämmigen Teile Nordafrikas gegenüber den schwarzen Einwohnern Afrikas ein Gefühl der Überlegenheit an den Tag legen.“
„Aus der Sicht der einfachen Menschen sind das sicher wichtige Elemente. Aber welche Anziehungskraft hat der Islam für Gebildete und Intellektuelle?“
„Der Islam baut auf einer Reform des Judaismus und des Christentums auf. Im Gegensatz zum Christentum, so sehen es islamische Intellektuelle, sind aber keine Elemente enthalten, die das Bild eines universellen Monotheismus verzerren wie beispielsweise die christliche Dreifaltigkeit. Nach islamischer Überzeugung gibt es einen einzigen Gott – Allah. Und Mohammed ist sein Prophet, der bedeutendste in der Reihe der Propheten Abraham, Moses und Jesus. Die Muslime glauben, dass die ursprünglichen, reinen Botschaften der Propheten über die Zeit verzerrt wurden. Du siehst, dass der Islam für einen Intellektuellen durchaus Charme haben kann!“
Ich war überrascht: Bisher hatte ich keine so islamfreundliche Erklärung vernommen, schon gar nicht von einem Priester!
Am Montag, dem 11. November 1957, ging es dann zurück Richtung Damaskus. Die Strecke war mir mittlerweile bestens bekannt, doch diesen Tag sollte ich mein Leben lang in Erinnerung behalten. Fünfzehn Kilometer vor Damaskus, auf der schnurgeraden asphaltierten Hauptstraße zwischen Beirut und Damaskus, tauchte am rechten Wegrand und von Weitem sichtbar eine Schafherde mit Hirten auf. Unser Volkswagen war das einzige Fahrzeug weit und breit.
Als ich glaubte, schon fast an der Gruppe vorbei zu sein, sprang der Hirte plötzlich direkt vor unser Auto. Ich betätigte die Bremse, hatte aber keine Chance, ihm auszuweichen. Dumpf prallte er auf den Volkswagen und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Ich hielt auf dem Seitenstreifen und lief zu dem Hirten zurück. Er war bewusstlos. Am Volkswagen waren der linke Scheinwerfer, der linke Kotflügel und die Abdeckung des vorderen Stauraums beschädigt. Wir konnten den Bewusstlosen nicht in unseren Volkswagen laden und warteten, bis ein Bus kam. Mit der Hilfe von mehreren Reisenden legte ich den Mann in den Gang des Busses und bat den Fahrer, uns in das beste Krankenhaus in Damaskus zu bringen.
Father Abraham ließ ich, seinem Wunsch folgend, zurück. Ihm schien die Gefahr des Vandalismus und des Diebstahls bei einem Unfallauto am Straßenrand zu groß.
Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der Hirte Brüche am Bein und an der Hüfte erlitten hatte. Während der Untersuchungen wurde ich – der freiwillig den Mann versorgt und hergebracht hatte – vorsorglich in das „Gefängnis“ des Krankenhauses gesteckt. Die Polizei kam schließlich, um den Fall aufzunehmen und Anklage zu erheben. Die Beamten sprachen kein Wort Englisch oder Deutsch – auch nicht Französisch oder Italienisch. Ich sprach höchstens einige Worte Arabisch. Mit der Hilfe eines gebildeten „Mitgefangenen“ konnte ich klarmachen, dass ich – wie von Father empfohlen – die Indische Botschaft über unser Missgeschick informieren und den blinden Pater abholen wollte.
Die Polizei untersuchte den Unfallort akribisch. Ein Protokoll wurde auf Arabisch erstellt. Wie ich später durch einen sprachkundigen Menschen erfuhr, gab man dem Hirten die volle Schuld an dem Unfall.
Mit dem Unfallauto und eskortiert von der Polizei fuhren wir zum Haus der Kurups (der von mir zurechtgebogene Kotflügel stellte noch ein gewisses Hindernis dar). Der Diplomat gab sofort eine „Party“ für die Polizisten, mit Drinks (!), Abendessen und vielem mehr. Trotzdem war die Polizei verpflichtet, uns als ausländischen Unfallteilnehmern die Weiterfahrt zu verwehren, bis ein Gericht das Urteil gesprochen hatte. Also verbrachte ich die Nacht in der Polizeistation von Duma.
Am nächsten Tag präsentierte die Polizei mich und das Unfallprotokoll dem Richter. Da der Bericht des Krankenhauses noch nicht vorlag, weigerte sich dieser, mich gegen Kaution zu entlassen. Um sicherzustellen, dass ich das Land nicht verlassen würde, musste ich in sichere Verwahrung, sprich: ins Gefängnis von Damaskus überstellt werden. Father Abraham flossen die Tränen in den Bart.
In einem geschlossenen Kastenwagen wurde ich zusammen mit anderen Häftlingen zum Civil Jail of Damascus, dem Zivilgefängnis, gebracht. Dort begann für die Häftlinge die übliche Routine: Haare schneiden, duschen, Verteilung auf die Zellen.
Als die Wärter diese Prozedur mit mir durchführen wollten, packte mich die Wut: Wie ungerecht war es, dass ich diese Prozedur über mich ergehen lassen sollte, obwohl ich das Richtige und Ehrenvolle bei diesem Unfall getan hatte! Ich riss mich mit Gewalt von zwei Wärtern los, die mich auf den bereitgestellten Stuhl zum Haareschneiden drücken wollten und schleuderte diesen gegen die Wand. Dazu schrie ich wie ein Berserker: „Aleman! Aleman! Aleman!“ – „Ich bin Deutscher!“
Die Wärter reagierten verdutzt. Anstatt mich mit noch mehr Gewalt und Prügel gefügig zu machen, konsultierten sie ihren Vorgesetzten und verwiesen mich in eine Einzelzelle. Später wurde ich, aufgrund der Intervention des indischen Botschaftsangehörigen Herrn Advani und auf heftiges Betreiben von Father, einer besonders hervorgehobenen Gruppe von Gefangenen zugeteilt. Sie sprachen Englisch, waren akademisch gebildet und nahmen mich sehr höflich auf. Das Essen des Gefängnisses war kaum zu genießen: Die Elitegefangenen teilen mit mir ihr Essen, das sie von Restaurants aus der Stadt bezogen.
Bald erfuhr ich ihre Geschichte. Der Mann mit der höchsten Seniorität war Oberstleutnant, ein politischer Gefangener. Der zweite dieser Herren war hierher gekommen, da ihn die Polizei bei einem Kontrollpunkt mit zehn Kilogramm Opium und fünfzehn Kilogramm Heroin im Auto erwischt hatte. Der dritte Mitgefangene war der Sohn des höchsten Polizeioffiziers von Syrien und des Mordes angeklagt. Der vierte Gefangene saß wegen einer ähnlichen Anklage. Eine illustre Gesellschaft, in der ich da achtzehnjährig gelandet war. Man kann es als Glücksfall oder als Fügung des Schicksals ansehen, dass ich nicht zu den gewöhnlichen Kriminellen gesteckt wurde.
Am nächsten Tag kam Father in Begleitung eines indischen Botschaftsangehörigen zu Besuch. Nach einer weiteren Nacht dann das Wunder: Auf Fathers Einfluss hin – er hatte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und seine beträchtlichen Überredungskünste ins Spiel gebracht – wurde ich gegen Kaution entlassen. Die Kaution, deren Höhe bei Weitem meine und Fathers finanzielle Möglichkeiten überstieg, stellte der Vertreter des Vatikans.
Die nächsten sechs Tage waren wir damit beschäftigt, Gespräche mit dem Rechtsanwalt und den Behörden zu führen. Am 20. November war es dann tatsächlich so weit: Vor dem Untersuchungsrichter erzielten wir einen Kompromiss mit dem Anwalt der Gegenseite. Gegen Zahlung von sechshundert Syrischen Pfund – dies entsprach damals ungefähr fünftausend österreichischen Schilling – wurde die Klage zurückgezogen. Am nächsten Tag gab uns das Schatzamt den hinterlegten Kautionsbetrag zurück. Halleluja!
Im Zuge der Verhandlungen erfuhren wir von unserem Rechtsanwalt, dass dies kein Einzelfall war: Ärmere Syrer stürzten sich manchmal absichtlich vor ein ausländisches Automobil, um einen Unfall zu provozieren. Auch wenn die Beweisaufnahme zugunsten des Fahrers verlief, war von vornherein klar, dass die Fremden das Land nicht verlassen durften, bevor in einem langwierigen Prozess die Schuldfrage geklärt war. Die meisten zahlten lieber einen stattlichen Betrag, um zu einer „gütlichen Einigung“ mit dem Rechtsanwalt des Unfallopfers zu kommen.
Es bleibt die Frage, wie verzweifelt jene Menschen sein müssen, die Leib und Leben für eine solche Einkommensquelle riskieren. Schon damals kam mir der Verdacht, dass ein verarmter Mensch auf einen solchen diabolischen Plan gar nicht kommen würde, sondern dass es Drahtzieher im Hintergrund geben musste. Später jedenfalls sollte ich ähnliche Kartelle in Indien kennenlernen, die systematisch die Not der blinden Kinder ausnutzten.
Nun waren wir für neue Unternehmungen bereit. Father wollte noch einige prominente Persönlichkeiten besuchen, bevor wir uns auf den Weg nach Ägypten machten. Wir fuhren zunächst nach Beirut, zu Kardinal Agaganian. Obwohl mit orthodoxem Hintergrund, war er der katholischen Kirche und damit dem Papst in Rom untergeordnet. Danach besuchten wir Lady Simeon, die christliche Präsidentin des Libanon. Im friedlichen Libanon gab es damals eine Vereinbarung zwischen Christen und Muslimen zur turnusmäßig wechselnden Präsidentschaft: So einfach kann das Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen sein, wenn Toleranz und Respekt statt Rivalität und Herrschsucht zur Geltung kommen!
In Beirut kauften wir Schiffspassagen nach Alexandria für den 6. Dezember 1957 und trafen Moran Mar Ignatios, den Patriarchen von Antiochia, Oberhaupt der syrisch-orthodoxen Kirche. Father Abraham war vor Jahren zum Priester der syrisch-orthodoxen Kirche geweiht worden und traf nun mit dem Oberhaupt seiner Kirche zusammen.
Wir wurden in dessen Residenz in Homs zum Mittag- und Abendessen eingeladen und nahmen am nächsten Tag, einem Sonntag, an dem vom Patriarchen zelebrierten Gottesdienst teil. Es war dessen Namenstag. Ich konnte die Messe aus unmittelbarer Nähe verfolgen und Parallelen und Unterschiede zur katholischen Messe feststellen.
Am Nachmittag fuhren wir zurück nach Damaskus. Am 4. Dezember ließen wir unseren Volkswagen hinter Herrn Kurups Haus zurück und fuhren mit dem Überlandtaxi nach Beirut.
Nach einem Tag der Vorbereitungen – Ausreisevisum für den Libanon und Geldwechsel – verließen wir am 6. Dezember 1957 Beirut auf einem wenig vertrauenerweckenden türkischen Frachter namens Istanbul: voller Rostflecken und nicht gerade sauber.
Father und ich teilten eine Doppelkabine. Der erste Fehler bestand darin, dass sich Father – dem vom unangenehmen Wellengang speiübel war – in die Kabine zurückziehen und näher bei der Toilette sein wollte. Schon war es um ihn geschehen. Immer wieder musste er sich übergeben, bis er etwas Ruhe fand. Meinen Eltern schrieb ich: „Meine erste Seereise werde ich nicht so schnell vergessen. Jetzt im Winter türmt ein eisiger Westwind die Wellen auf, das Schiff geht bergauf und bergab, hin und her, und man wird von einer Seite der Kabine auf die andere geworfen. Sobald ich mich setze, habe ich das Gefühl, als ob sich das Schiff wie ein Riesenrad dreht. Die Kabinen sind von Magensäuregeruch erfüllt, denn alles von innen drängt nach außen. Wenn ich es in dem schlechten Geruch nicht mehr aushalte, krieche ich an den Wänden entlang an Deck. Dort befinden sich immer einige, die Neptun ihre letzte Mahlzeit opfern.“
Ich konnte aber Father nicht zu lange allein lassen. Ich hatte nicht vergessen, wie sehr er sich für mich während meiner Haft im Gefängnis von Damaskus eingesetzt hatte. Der Pflicht gehorchend bewegte ich mich, immer an der Wand entlang, zurück zu unserer Kabine. Der Geruch gab mir den Rest. Mein Tagebuch sagt dazu: „Verbrachte einen schrecklichen Tag und eine schreckliche Nacht an Bord.“ Die Erlösung brachte am nächsten Tag die Ankunft in Alexandria. Dann ging es per Eisenbahn weiter nach Kairo.
Die nächsten zehn Tage vergingen wie im Traum: Die Pyramiden von Gizeh verschlugen mir den Atem, welche gewaltige Bauleistung! Die großen Steinquader aus dem Felsen per Hand herauszuarbeiten, diese zum Nil und auf dem Nil zu der Baustelle zu transportieren, dann wieder an Land die langen Rampen hinaufzubefördern, bis die Steinquader millimetergenau auf- und zueinander passten. Für mich waren und sind diese Pyramiden der bleibende Beweis, dass der Glaube – an die Rolle der Pharaonen als Mittler zwischen den Göttern und den Menschen – Berge versetzen kann.
Bei der großen Pyramide des Pharao Cheops ging ich die Passage zu den Kammern des Pharao und der Königin: Die erste Kammer befindet sich exakt auf halber Höhe, die zweite auf einem Viertel der Höhe der einhundertfünfzig Meter hohen Pyramide! Ich kletterte über die Außenquader bis zur Spitze der Pyramide hoch und genoss einen großartigen Blick über die beiden anderen Pyramiden und das grüne Band des Nils.
Am nächsten Tag im Kairo-Museum wieder ein Fest für Sinne und Seele: Mumien, Statuen und Hieroglyphen als Zeugen einer uralten Zivilisation und Kultur. Beeindruckend waren auch die Exponate aus dem Grab des jugendlichen Pharao Tutenchamun.
Zu den für Father interessanten Kontakten zählten die Indische Botschaft und der syrische Erzbischof von Kairo, mit seinen zweiundneunzig Jahren der damals älteste Bischof der gesamten christlichen Welt. Darüber hinaus besuchten wir den Direktor des Bildungswesens, Dr. Atiik, und den Referenten für die Erziehung von Behinderten. Father wollte lernen, wie ein Schwellenland wie Ägypten diese Herausforderung aufgriff. Am Sonntag nahmen wir an der Heiligen Messe in der syrisch-katholischen Kirche teil, tags darauf sprachen wir mit Dr. Taha Hussein, dem früheren Bildungsminister Ägyptens. Seit seinem vierten Lebensjahr war er blind und dennoch ein äußerst gebildeter und an der Wissenschaft interessierter Mann, der es sogar auf den Posten eines Ministers geschafft hatte! Dieses Beispiel zeigt, dass man seine Grenzen überwinden kann: mit eisernem Willen, viel Fleiß und ein bisschen Glück!
Am Morgen des 20. Dezember stand meine erste Flugreise an. Meinen Eltern schrieb ich: „Um vier Uhr in der Früh mussten wir aufstehen, um fünf Uhr ging es in die Wüste zum Flugplatz. Um sieben Uhr hob sich unser Riesenvogel (von der AIR JORDAN) vom Betonboden ab und bald lag die Erde tief unter uns. Es ist wundervoll, die Sanddünen der Wüste, die Wasserplätze mit einigen Palmen und die schwarzen Flecke der Beduinenzelte tief unten zu sehen. Die Berge sind klein und wie Modelllandschaften, die Dörfer und Städte wie hineingeklebt. Am schönsten aber war es, über den Wolken dahinzusegeln, man sieht nichts von der Erde, nur Wolkenwatte tief unten.“
Wir landeten um 9 Uhr 35 am Flughafen Jerusalem.
Von dort ging es in die Altstadt Jerusalems, zum Casa Nova, der Pilgerherberge der Franziskaner. Am Nachmittag begann unser Besuch der heiligen Stätten – für jeden gläubigen Christen ein einmaliges und bewegendes Erlebnis. Die Grabeskirche war das erste Ziel. Nach zahlreichen christlichen Stätten suchten wir muslimische Heiligtümer auf: den Harem Esh Sheriff und den Felsendom, zwei beeindruckende Monumente auf den Grundfesten des alten Salomon-Tempels. Zweifelsohne hat der Felsendom mit seinen beeindruckenden Mosaiken, gebaut im 7. Jahrhundert, für Muslime dieselbe sakrale Bedeutung wie die christlichen Stätten für Christen. An dieser Stelle sollen alle alttestamentarischen Propheten und auch Christus gebetet haben, von hier soll der Prophet Mohammed in den Himmel aufgestiegen sein.
Der 24. Dezember begann mit einem Besuch bei der Bibelgesellschaft: Die Verantwortlichen überreichten ein passendes Weihnachtsgeschenk, eine Braille-Bibel in zwanzig Bänden. Nach dem Abendessen fuhren wir per Taxi nach Bethlehem, zur Kirche der Heiligen Katharina, die über der Geburtsgrotte Jesu erbaut worden war. Um 22 Uhr30 begann das feierliche Hochamt, zelebriert vom Lateinischen Patriarchen von Jerusalem. Es dauerte bis drei Uhr früh. Die Kirche war randvoll mit Menschen aus aller Welt. Welch ein Glück, dass wir noch Eintrittskarten erhalten hatten – ohne Fathers Status wäre es wohl ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.
Nach Hause schrieb ich: „Um einen guten Platz in der Kirche zu bekommen, waren wir schon um halb neun dort (für die Mitternachtsmesse). Mit der Zeit füllte sich die Kirche. Die Mitternachtsmesse war großartig organisiert und zeremoniell fast etwas zu pompös. Der erhabenste Augenblick war das Gloria: ein gewaltiger Chor, der ein mächtiges Gloria in excelsis Deo anstimmte, Lichter flammten auf, ein riesiger blauer Stern und die Botschaft der Engel in der Weihnachtsnacht. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind. Obwohl diese Messe an jener Stelle, wo Jesus vor ca. 1957 Jahren geboren wurde, etwas überladen war, wird sie doch für lange Zeit in meiner Erinnerung bleiben als die ‚Heilige Nacht in Bethlehem‘.“
Auf einer Reise, die von Höhepunkt zu Höhepunkt verlief, war die Christmette in Bethlehem in emotionaler Hinsicht der absolut „höchste Höhepunkt“.
Die Jahre meiner christlichen Erziehung in der Klosterschule hatten mich sicherlich sensibilisiert. Doch auch wenn man am Absolutheitsanspruch der römisch-katholischen Kirche zweifelt: Es bleibt etwas bestehen im Herzen, das man weder verleugnen will, noch verleugnen kann.
Am Weihnachtstag ging es zurück nach Damaskus, diesmal mit dem Überlandtaxi der Firma Petra. Indem eine größere Zahl von Passagieren, allerdings auf engem Raum, untergebracht wurde, konnten die Fahrten in diesen PKW-ähnlichen Fahrzeugen zu günstigen Preisen angeboten werden. Jeder Passagier zahlte einen eigenen Preis je nach Entfernung.
Am Freitag, dem 3. Januar 1958 machten wir einen Ausflug in das Dorf Malullah, das sich anschmiegt an die Steilhänge des Antilibanon. Heute noch sprechen die Menschen dort Aramäisch, die Sprache Christi. Sie gehören zur syrisch-orthodoxen Kirche, wie Father Abraham auch. In Europa lebende, aus dem Irak und Syrien geflohene orthodoxe Christen werden oft auch Assyrer, ihre katholischen Glaubensbrüder Chaldäer genannt.
Schon von Weitem sah man die Steilhänge, gekrönt von einem Band hoher Felsen. Tiefe Rinnen führten hinab ins Tal. Jetzt im Winter waren die vereinzelt eingestreuten Bäume kahl und wirkten wie abstrakte Gemälde. Zur Krönung des Bildes kam bei unserer Ankunft ein bunt schillernder Regenbogen hinzu – wenn das kein gutes Omen war!
Wir fuhren hinab in das Tal. Näher gekommen, erkannte man Flachbauten, aber auch Häuser mit Dächern. Wir fragten uns durch zum syrisch-orthodoxen Priester, der uns Kirche und Dorf zeigte. Einige der Häuser waren in die überhängenden Felsen hineingebaut und fügten sich dank der Natursteine aus der Gegend zu einem harmonischen Ganzen.
In diesem Dorf wurde die erste christliche Märtyrerin getötet, die Heilige Thekla. Der Priester zeigte uns einen Fluchtweg der frühen Christen, eine schmale Öffnung im Felsen, durch die ein kleiner Bach floss. Folgte man den Windungen, kam man zu mehreren Höhlen, die schon vor zehntausend Jahren Menschen als Unterkunft gedient hatten.
Diese Synthese von Natur und Kultur fesselte und beeindruckte mich. In mein Tagebuch notierte ich: „Umringt von Bergen, bedeckt vom blauen Himmel, die verbleibenden Blätter nur gestört durch die frostige Brise, die von den Bergen weht – ein wunderbares Panorama manifestiert sich dem Beobachter von den Bergesspitzen.“
Nach dem Erhalt eines Transitvisums für Jordanien und einem Ölwechsel am Volkswagen sagten wir am 18. Januar 1958 „Danke! Und Auf Wiedersehen!“ zu den gastfreundlichen Kurups und brachen in Richtung Indien auf. Zunächst fuhren wir jedoch nach Mafraq in Jordanien, zum Ausgangspunkt der Wüstenstraße, entlang der Ölpipeline. Diese Straße war in gutem Zustand und führte über achthundert Kilometer durch die Wüste in den Irak. Abends kamen wir an die Pumpstation H4 und verbrachten hier die Nacht. Am nächsten Morgen ging es weiter, sechshundertundfünfzig Kilometer nach Bagdad.
Am darauf folgenden Morgen kümmerten wir uns um das Wohl des dritten Reisenden – um unseren treuen Volkswagen, der einiges auf der Wüstenstrecke mitmachen musste. Glücklicherweise gab es in Bagdad eine Volkswagenvertretung, die das Auto durchcheckte und kleinere Probleme behob.
Eigenartigerweise lese ich in meinem Tagebuch den Satz: „Bagdad scheint nicht ein sehr großer Ort zu sein.“ Entweder waren wir in einem Vorort gelandet, oder die Ausmaße von Damaskus und Kairo waren noch allzu präsent. In Erinnerung bleibt die Kuppel einer mit emaillierten Kacheln bedeckten Moschee, die Palmen am Straßenrand und die faul dahinfließenden braunen Flüsse Euphrat und Tigris.
Schon am Mittag verließen wir Bagdad in Richtung Osten durch das Flachland Mesopotamiens. Beeindruckend die große Ölraffinerie in Khanqin. Auf iranischem Gebiet angekommen, verbrachten wir die Nacht in einem sehr kalten Hotel in einem Dorf namens Quasr-e Shirin. Wir konnten nur ahnen, um wie viel kälter es weiter oben in den Bergen noch sein würde.
Am nächsten Tag stellten wir fest: Ja, es konnte noch sehr viel kälter werden! Eines der Hinterräder wies einen Platten auf und es dauerte, bis ich das Reserverad montiert und den Gummischlauch in einem kleinen Geschäft am Straßenrand vulkanisiert bekommen hatte. Dann ging es weiter über die hohen Pässe des westlichen Iran.
Wir hatten keine Winterreifen und es wurde dunkel: links der Abgrund, rechts die weiße Wand der Berge. Der Volkswagen rutschte gefährlich umher. An einem der kritischen Pässe konnten wir Schneeketten ausleihen, die nach der Überquerung auf der anderen Seite wieder abgegeben werden mussten. Wir zahlten die beträchtliche Gebühr gerne – ohne Schneeketten hätten wir es niemals geschafft!
Zu den positiven Eindrücken dieses Tages zählen die Inschriften des König Darius in einer Felswand, Teil eines hohen Felsengebirges. Positiv war auch das Gespräch mit zwei Hotelgästen – Herr Adnan Samara aus Bagdad und Herr Mostesar Younessi aus Teheran – beide fuhren mit dem Bus nach Teheran.
Am nächsten Tag folgten wir dem Bus auf einer schneebedeckten und eisigen Straße. Sobald wir die Berge hinter uns gelassen hatten, wurde es nur wenig besser – kein Eis mehr, dafür aber eine schreckliche Straße. Mit der Hilfe eines Einheimischen fanden wir in Teheran das Central Hotel, in dem auch der irakische Bekannte vom Vorabend wohnte. Am nächsten Morgen erschien auch Herr Younessi, ein Journalist. Er zeigte uns den Weg zur amerikanischen Mission: Prompt lud uns Herr Dr. Elder ein, in seinem Haus innerhalb des Areals der Mission zu wohnen.