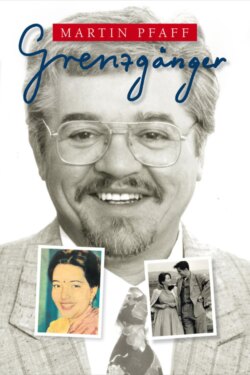Читать книгу Grenzgänger - Martin Pfaff - Страница 8
2. Ungarn: Wehe den Besiegten!
(1939 bis 1947)
ОглавлениеZwei Jahre zuvor: Der 31. Dezember 1944 erschütterte wie ein Paukenschlag mein Leben als Fünfjähriger, er warf einen dunklen Schatten voraus – wohl für den Rest meines Lebens. Dabei war mein Leben auch bis dahin keineswegs idyllisch verlaufen: Zu sehr drangen die Boten des Krieges in unser scheinbar friedliches und verschlafenes donauschwäbisches Dorf.
Als Kleinkind nahm ich diese Bedrohungen nicht in ihrer ganzen Bedeutung wahr. Aber die Anspannung der Erwachsenen habe ich sehr wohl registriert. Außerdem flogen von Zeit zu Zeit Flugzeuge über unser Dorf, ohne es jedoch anzugreifen.
Als mein Vater 1944 nach Fünfkirchen in ein Wehrertüchtigungslager einrückte, wollte er meine Mutter und uns drei – ich war fünf Jahre, mein Bruder Mathias drei und mein jüngster Bruder Anton zwei Jahre alt – nachkommen lassen. Hierfür schickte er einen Pferdewagen, gedeckt mit einer großen Plane, abwechselnd gelenkt von zwei Kutschern. Meine Mutter weigerte sich jedoch, allein mit uns dreien mitzufahren. Jedoch waren ihre Schwägerin und deren zwei Schwestern bereit, mitzukommen. Nur widerwillig schlossen sich meine zwei jungen Kusinen an, Mari (Maria), dreizehn Jahre alt, und Kathi (Katharina), zwölf Jahre alt. „Wir wollten einfach nicht von zu Hause weg. Auch die Großeltern wollten nicht mit!“, würde mir Kathi später berichten.
In Fünfkirchen wurden wir von einer Bekannten aus Tevel aufgenommen, die hierher geheiratet hatte. Obwohl sie selbst nur ein kleines Häuschen besaß, hat sie uns beherbergt. Sie hatte zwei Söhne. Ihr Mann war beim Militär.
Zusammen mit den Kusinen gingen wir Geschwister einmal auf die Suche nach unserem Vater. Als wir ihn endlich auf dem Truppenübungsplatz bei der Kaserne fanden, war er besorgt: „Was wollt ihr hier? Es kann jederzeit einen Luftangriff auf die Kaserne geben! Geht schnell zurück zur Mutter!“
Und in der Tat. Meine Erinnerung an die folgenden Ereignisse ist bis heute lebendig: Als wir auf dem Rückweg sind, heulen die Sirenen auf. Wir wissen, dass es ein Fliegeralarm ist. Zusammen mit anderen Menschen laufen und laufen wir. Schließlich landen wir im Keller der großen Kirche, auch „Bischofskeller“ genannt. Als wir zu unseren Müttern zurückkommen, werden wir kräftig ausgeschimpft und auf die Gefahren des Luftangriffs hingewiesen.
Szenen weiterer Luftangriffe auf Fünfkirchen sitzen tief in meinem Gedächtnis: wie wir beim Heulen der Sirenen die Fenster und Türen des Hauses aufreißen, um eine Beschädigung durch Druckwellen zu verhindern, und uns auf den Boden legen. Und wie wir zusammenzucken, wenn die Bombeneinschläge näher kommen. Oft bilden die Erwachsenen einen Kreis um uns Kinder, im Glauben, uns so im Falle eines Bombenangriffs besser schützen zu können. Dazu Kathi: „Offenbar galt die Vorstellung: Wenn wir sterben, sterben wir zusammen!“
Mein Vater wird an die russische Front versetzt, wie viele andere Donauschwaben aus Ungarn auch. Meine Mutter, wir drei Kinder sowie die anderen Verwandten kehren nach Tevel zurück, von den Großeltern freudig begrüßt.
Bald werden die Meldungen über den Vormarsch der sowjetischen Armee eindringlicher. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis sie Tevel erreichen werden. Die Angst aller – vor allem der Frauen – nimmt zu.
Mein Vater schreibt meiner Mutter, sie solle mit uns Kindern in den Westen gehen, um vor den Russen zu fliehen. Wiederum weigert sich meine Mutter, allein mit drei kleinen Kindern wegzuziehen. Die anderen Verwandten sagen: „Wir gehen nicht mehr mit! Wir bleiben hier!“ Die letzten reisewilligen Teveler fliehen Richtung Högyész-Szakály, zur Eisenbahn. Sie erwischen den letzten Zug, der in Richtung Westen geht. Dann kommt die Nachricht: „Szakály wird von den Russen beschossen! Die Zugverbindung ist unterbrochen!“
Unter den Tevelern, denen die Flucht gerade noch gelang, sind Freunde meines Vaters wie Herr Bless. Diese Freundschaften sollten ein Leben lang halten.
In unserem Dorf werden die Russen jederzeit erwartet: Als sie fast da sind, verstecken wir uns zusammen mit anderen Bewohnern in kellerartigen Höhlen am Dorfrand bei der „Schanze“, einer Befestigung aus der Zeit der Türkenkriege. Zweiundsiebzig Personen finden hier Zuflucht: ältere Männer, Frauen und Kinder. Die Eingänge werden mit Maisstängeln abgedeckt, sodass sie von außen nicht eingesehen werden können. Ich erinnere mich gut an das Weinen der Kleinkinder und die hektischen Bemühungen der Erwachsenen, sie zur Ruhe zu bringen. Beim Vorbeigehen konnten solche Laute wahrgenommen werden.
Mein Bruder Matheis (Mathias) weint und kann nicht beruhigt werden; er vermisst sein Lieblingsspielzeug, das in unserem nahegelegenen Haus in der Eile zurückgelassen worden war. Er bedrängt unsere Mutter, dieses mit ihm zusammen zu holen. Sie verlassen die Höhle. Er weint, bis die ersten Schüsse zu hören sind. Danach ist er stumm, schmiegt sich an unsere Mutter. Sie kehren sofort um. Mein kleiner Bruder Toni ist leichter zu beruhigen: Versteht er noch nicht, worum es geht?
Die heranrückenden Russen verfolgen die letzten deutschen Einheiten, die sich der Hauptstraße entlang zurückziehen. Sie beschießen auch den Schanz-Hügel. Nach dem Krieg werden vier Gräber mit russischen Gefallenen dort gefunden. Diese werden später exhumiert und in ihre Heimat überführt.
Wie es dazu kommt, dass wir schließlich die Höhlen verlassen können, weiß ich nicht. Laut Teveler Heimatbuch werden die Russen vom Schuldirektor mit einer weißen Fahne begrüßt. Die Lage beruhigt sich schnell. Nur ein Gebäude geht in Flammen auf: das „Kastell“, in dem die Russen Waffen gefunden haben. Die Teveler werden zu Schanzarbeiten verpflichtet.
Mein Großvater hat vor dem Eintreffen der Russen die Weinfässer Eimer für Eimer auf den Misthaufen geleert, um Alkoholexzesse zu verhindern. Meine Großmutter mütterlicherseits muss für die russischen Soldaten Gänse und Hühner schlachten und zum Essen zubereiten.
Meine Großmutter väterlicherseits legt sich ins Bett und gibt vor, krank zu sein. Sie versteckt meine Mutter hinter sich unter großen Daunendecken. Vorher hatte sie mithilfe von Kohle ihr Gesicht altern lassen und ihr ein Kopftuch umgebunden, um sie hässlich zu machen. Glücklicherweise war ein Offizier bei uns einquartiert worden und es kam zu keinen Übergriffen auf die Frauen. Er wohnte in der unteren Stube. Meine Kusine Mari erzählte später: „Die Soldaten hatten kaum freien Lauf: Sie wären hart bestraft worden, wenn sie den Dorfbewohnern etwas angetan hätten.“
Dass es dennoch Übergriffe gab, berichtete meine Kusine Kathi: „Meine Mutter, mit euch dreien und uns zwei Kindern, meine Tante mit ihrer kleinen Tochter und meine Großeltern mütterlicherseits versteckten uns in einem Haus in der Helistadt – so hieß dieser Teil Tevels. Dieses Haus war schwer zugänglich, weil es in einer Nebenstraße, einer Art Sackgasse, gelegen war. Auf einmal kamen die Russen auch in diese Straße. Ein Russe kam in das Haus, in dem wir uns auf Strohsäcken am Boden zum Schlafen hingelegt hatten. Meine Mutter lag hinter mir und gab keinen Laut von sich. Als ich den Russen sah, hab ich geschrien. Er wollte auf mich zukommen und mich beruhigen. ‚Ich habe auch Kinder‘, sagte er. Auf einmal kam ein Offizier herein und sie gingen weiter. Ich weiß nicht mehr, wie viele Nächte ich von dem Russen geträumt habe … geträumt und geweint. In dieser Nacht haben sie drei bis vier Häuser weiter eine Frau vergewaltigt. Ja, so etwas hat es schon gegeben. Natürlich!“
Und sie fügte hinzu: „In unserem neu gebauten Stall gab es ein Versteck in einer Ecke am Heuboden. Hier hatten sich die Frauen einen Schlafplatz gemacht. Und wenn es hieß: ‚Die Russen kommen!‘, sind die Frauen nach oben geklettert. Die Leiter wurde wieder weggenommen.
Wir Kinder blieben mit der Großmutter unten. Meine Schwester Mari war körperlich schon sehr früh entwickelt. Einmal stand ein Russe vor ihr und hat sie angeschaut. Aber die Großmutter schrie ihn an: ‚Nichts da! Weg da!‘ Darauf drehte er sich um und verließ den Raum. Und von dem Tag an musste Mari auch mit den jungen Frauen auf den Heuboden. Es war schlimm.“
Neugierig wie Kinder sind, machen wir uns bald daran, die Soldaten zu inspizieren. Sie scherzen mit uns, setzen uns ihre Mützen auf, heben uns sogar auf die Rohre der Panzer. Bald haben wir viel Zutrauen zu ihnen und ahnen nicht, was noch auf uns alle zukommen soll.
Am 31. Dezember 1944 hat die trügerische Ruhe ein Ende. Durch Trommelschlag werden die Frauen der Jahrgänge 1915 bis 1926 und die wenigen verbleibenden Männer der Jahrgänge 1900 bis 1927 ins Gemeindehaus von Tevel einbefohlen.
Meine Mutter – Jahrgang 1920 – macht sich ebenfalls auf den Weg, mit meinem Bruder Toni auf dem Arm, Matheis auf der einen Seite und mit mir auf der anderen Seite. Wir halten uns am Rockzipfel fest und befürchten das Schlimmste. Die grauen Wolken und die Kälte des Dezembertages tragen noch dazu bei. Wir haben Angst.
Beim Gemeindehaus angekommen, finden wir viele Menschen vor, hauptsächlich Frauen, mit ihren Kindern im Schlepptau. Ich verstehe nicht alles: Aber es wird klar, dass die vorgeladenen Frauen und Männer zu einem Arbeitsdienst von vierzehn Tagen zum „Maisbrechen“ in die Báczka geschickt werden sollen. So lautet zumindest die offizielle Version.
Ein russischer Soldat, der gebrochen Deutsch und ein wenig Ungarisch spricht, und einer der Teveler – Herr Eppl – nehmen die Personalien der Frauen und Männer auf. Wir ordnen uns in die Warteschlange ein. Der Soldat blickt auf meine Mutter mit uns drei Kindern. Er räuspert sich, schaut auf sein Protokoll, dann wieder zu unserer Mutter und fragt schließlich:
„Sind Sie schwanger?“
„Nein, ich bin nicht schwanger“, antwortet sie.
„Sind Sie sicher, dass Sie nicht schwanger sind?“
„Nein, ich bin wirklich nicht schwanger!“, schießt meine Mutter entrüstet zurück.
Der Soldat blickt sie schweigend an, schüttelt den Kopf und nimmt ihre Personalien auf. Später erst sollte meine Mutter verstehen, worum es dem Mann tatsächlich ging: Schwangere waren von der Order ausgenommen. Dies war aber der Bevölkerung nicht mitgeteilt worden. Angesichts der drei kleinen Kinder hat der Soldat wohl Mitleid empfunden. Er wollte verhindern, dass er unsere Mutter, drei kleine Kinder zurücklassend, zum Arbeitsdienst schicken musste, ohne dabei seine Befehle zu verletzen und sich strafbar zu machen! Solch verschlungene Gedankengänge waren den geradlinigen Donauschwaben fremd und passten insbesondere nicht zu unserer Mutter, die zeitlebens ihre Gedanken geradeheraus sagte, ohne sich allzu sehr um die Konsequenzen zu kümmern.
Die Situation war noch nicht endgültig geklärt, wie mir meine Kusine Kathi Jahre später erzählte: „Ein anderer Soldat, der die Szene beobachtet hatte, mischte sich ein: ‚Diese Frau muss nicht zum Arbeitsdienst!‘ Doch daraufhin haben einige Teveler Frauen zu den Russen gesagt: ‚Die muss mit! Ihr Mann war der Anführer der Volksbündler im Dorf!‘ Damit meinten sie die Organisation der Deutschen in Ungarn, die große Sympathien für Nazideutschland hatten.“
Ihre Beschuldigungen besiegelten das unmittelbare Schicksal meiner Mutter: Sie musste mit zum Arbeitsdienst in der Fremde. Mir gefiel die Situation überhaupt nicht.
„Mutter, geh bitte nicht weg!“
„Ich muss weg, aber es ist ja nicht für sehr lange!“
„Wie lange?“
„Die Soldaten und der Dorfschreiber sagen: für zwei Wochen.“
„Aber das ist doch sehr lange!“
„Ich kann es nicht ändern!“
„Warum musst du weg?“
„Angeblich sollen wir Deutschen bestraft werden, durch Arbeitsdienst beim Abernten der Felder in der Báczka. Das ist wegen des Kriegs im letzten Herbst versäumt worden, so heißt es.“
„Mutter, wofür sollst du bestraft werden?“
„Wir sollen bestraft werden, weil wir Deutsche sind!“
„Ist das etwas Schlimmes?“
„Nein, aber das verstehst du noch nicht.“
„Warum nicht?“
„Weil du noch zu klein bist!“
Am nächsten Tag wurden über zweihundert Personen in Ochsenwagen – mit Gepäck und Verpflegung für vierzehn Tage – in die nahe gelegene Kleinstadt Szekszárd ins Sammellager für das Komitat gebracht. Am 9. Januar 1945 ging es in Viehwaggons ins Arbeitslager Arbyum in der Ukraine: Statt der vierzehn Tage sollten es fünf Jahre werden.
Die Arbeit in Kohlegruben unter Tage – wie bei meiner Mutter – oder bei Bauarbeiten oder in Kolchosen war schwer, die Verpflegung und Unterkunft mangelhaft. Ein Drittel der Frauen und Männer schafften es nicht zurück: Sie liegen heute noch in fremder Erde begraben.
Was in den Köpfen und Herzen der Menschen vorging, als sie den Betrug bemerkten, ist mir nicht bekannt: Meine Mutter erzählte später bereitwillig vom Leben im Arbeitslager, sprach aber kaum über ihre Gefühle während des Transports. Es bedarf keiner großen Fantasie, diese zu erraten.
Meine weitere Erinnerung bleibt verschwommen. Nach dem Abschied von meiner Mutter überkam mich eine panische Angst und eine unendliche Traurigkeit: Ich ahnte, ohne es tatsächlich zu wissen, dass die Mutter sehr lange weg sein würde. Woher diese dunkle Vorahnung kam, weiß ich nicht. Im Leben habe ich einige Male solche Vorahnungen gehabt – für Gutes und für Schlechtes.
Ob ich diesen Tag jemals vergessen werde? Die Unsicherheit, die Angst, einen geliebten Menschen – das Zentrum meiner Welt – zu verlieren, werden sie mich mein ganzes Leben lang begleiten? Ich verspürte eine große emotionale Leere, eine Traurigkeit, die nicht enden wollte.
Ich frage mich heute, wie es meinen Brüdern ergangen ist, waren sie doch deutlich jünger und konnten den Verlust der Mutter noch weniger verkraften. Oder haben sie das alles gar nicht so richtig mitbekommen?
In meiner Verzweiflung rannte ich in den Garten, kroch tief in einen Heuschober hinein. Als ob ich mich vor der grausamen Welt verstecken wollte, Schutz und Geborgenheit suchend. Ich schlief ein und kam erst am Mittag des nächsten Tages heraus, zur großen Erleichterung meiner fassungslosen Großeltern: Sie hatten überall nach mir gesucht und das Schlimmste befürchtet.
Für meine Großeltern war durch die Verschleppung meiner Mutter eine Welt zusammengebrochen: Hier standen sie mit drei kleinen Kindern, ohne deren Mutter und ohne deren Vater, der sich noch bei der Armee weiter im Westen befand. Nichts hatte sie auf eine solche Tragödie vorbereitet. Und sie waren sich keiner Handlung bewusst, die eine solche Ungerechtigkeit rechtfertigen würde.
Die Stimmung in Tevel war verändert, die Gesichter der Menschen gezeichnet. Die Augen der Alten blickten verzweifelt aus bleichen Gesichtern. In einer Gemeinschaft, in der fast nur noch Alte und Kinder übrig bleiben, gehen Wärme und Hoffnung verloren. Es war sehr still, totenstill im Ort.
Es sollte jedoch noch schlimmer kommen. Die Russen sammelten Kühe und Ochsen ein, wohl als Essensreserve, und ließen sie hinter der vorrückenden Armee hertreiben. Eines Tages kam wieder eine kleine Herde mit Treibern zu unserem Hof. Auch wir mussten eine Kuh abgeben. Mein Großvater wurde gezwungen, sich als Viehtreiber anzuschließen, bis in die Gegend von Baja. Von dort ließ man ihn zu Fuß nach Hause gehen – im kalten Januar bei ca. zwanzig Grad minus.
Zu Hause war die Situation kritisch geworden: Meine Großmutter, die einzige Erwachsene, lag krank im Bett, mit drei Kindern im Haus. Da hieß es immer für meine zwölfjährige Kusine: „Mari! Aufstehen! Geh zu Kleene Mathese (unser schwäbischer Hausname), Kinder wecken und anziehen, Feuer machen, Wasser beim Ziehbrunnen schöpfen!“ Im tiefen Schnee war ein Pfad geschaufelt, auf dem die Kühe und Ochsen zur Tränke am Brunnen gelangen konnten. Mari erzählte später: „Ich habe geschöpft, geschöpft. Den Schöpfer immer wieder hoch und runter, bis die Kühe genug gesoffen hatten. Und vis-à-vis bei den Drehers (so der Hausname): Ein noch kleineres Kind hatte dieselbe Pflicht wahrzunehmen! Es war eine harte Zeit. Wir Kinder mussten uns wie Erwachsene verhalten. Meine Großmutter hat die Kühe gemolken. Aber für die Milch gab es keinen Absatz, weil die Organisation des Milchvereins zusammengebrochen war und wir hatten die von den Hühnern gelegten Eier.“ So entstand die perverse Situation der Übergangszeit – eine Zeit großer seelischer Not gekoppelt mit einem Überschuss an Lebensmitteln. Dies sollte sich sehr bald ändern.
Die Alten und die wenigen verbliebenen Jüngeren organisierten sich neu: die Arbeit in den Stallungen, auf den Äckern, die Sorge um Haus, Hof, Vieh und um die Kinder. Sie mobilisierten Kräfte, die sie früher nicht mal bei sich geahnt hätten. Denn es ging um das Überleben von Kindern, Familie und Gemeinschaft.
In der Geschichte unserer Vorfahren gab es mehrfach große Entbehrungen und individuelles Leid. Aber wohl kaum etwas Vergleichbares.
Wie war es überhaupt zur Ansiedlung meiner deutschen Vorfahren in Ungarn gekommen?
Mich haben zeitlebens Ahnentafeln nie interessiert, ganz im Gegensatz zu meinem Vater: Er leitete seine Identität viel mehr aus der Vorgeschichte unserer Familie ab. Ich dagegen war an Taten interessiert, durch die ich meine Identität selbst zu definieren trachtete. „Ich bin, was ich tue!“, entspricht eher meinem Credo als: „Ich bin der Nachfahre von so und so!“
Der Stammbaum der Familie Pfaff ist seit 1713 dokumentiert, in Urkunden, Kirchenbüchern und Ähnlichem nachgewiesen. Mein Vorfahre Andreas Pfaff war nachweislich im Jahr 1713 aus Littenweiler (in den Pfarrbüchern damals als Leutenwyller bezeichnet) bei Freiburg im Schwarzwald zusammen mit Frau und Kindern nach Ungarn ausgewandert. Wie andere Donauschwaben fuhren sie auf großen Flößen (später „Ulmer Schachteln“ genannt) die Donau hinunter. Die Anlegestellen des Floßes, die Vereinbarungen mit dem Grundherrn Graf Döry über die Grundausstattung des Gebiets des späteren Orts Tevel sind bekannt.
Weniger klar sind die Beweggründe der Auswanderer: Überbevölkerung, Folgen der Kriege, Hoffnung auf ein besseres Leben in der neuen Heimat, oder ein bisschen von allem? Sie wussten, dass sie nicht in ein Paradies auf Erden ziehen würden. Weite Landstriche waren im Zuge der Türkenkriege zerstört worden, das Land verödet, eine Infrastruktur kaum vorhanden.
Die Zusagen des ungarischen Grundherrn Döry erwiesen sich als Illusion: Das für die Feldarbeit versprochene Vieh wurde nie geliefert. Die bäuerliche Arbeit auf den Feldern musste per Hand erledigt werden. Sogar die zugesagten Häuser fehlten: Die ersten Einwanderer mussten in Erdlöchern wohnen, bis sie einfache Häuser bauten. Allerdings besaßen sie Privilegien und Freiheiten: Die ersten drei Jahre waren steuerfrei. Und sie waren keine Leibeigenen, konnten also weiterziehen, wenn sie wollten. Viele taten dies. Andere kehrten enttäuscht, teils auch krank von Entbehrungen und Not, in die südwestdeutsche Heimat zurück. Ein vielfach verwendetes Zitat fasst diese Zeit in bemerkenswert gebündelter Form zusammen: „Die Ersten fanden den Tod, die Zweiten die Not, erst die Dritten das Brot.“
Zweieinhalb Jahrhunderte später waren aus den steinigen Äckern so etwas wie „blühende Landschaften“ geworden. Wer sich diese mit den Augen des heutigen Betrachters vorstellen will, sollte sich die Landschaften der Amish oder der Pennsylvania Dutch unweit von Philadelphia, Pennsylvania, in Erinnerung rufen. Dort leben einfache, in der Religion verwurzelte Menschen, fleißig und genügsam, ehrlich bis zur Peinlichkeit.
Die Häuser in Tevel bestanden aus einem Wohnteil, im rechten Winkel dazu Stall, Scheune und ein Misthaufen. Als Teil des Wohngebäudes ein überdeckter Gang. Ein Brunnen. Alles war schmuck, sauber angeordnet und durch einen Zaun nebst großem Tor von der Straße abgegrenzt. An der äußeren, straßenseitigen Ecke unseres Hauses (s’Kleene Mathese) befand sich eine Ecce-Homo-Statue aus Stein, ein gefesselter Christus mit weitem Umhang.
Hervorgehoben, da auf Hügeln stehend, die Kirche, die Schanz sowie Weingärten auf den Hügeln am Rande des Dorfes. Dazu viele Bäume, meist von mittlerer Größe, auch einige hochgewachsene Pappeln.
Neben den Bauernhäusern gab es etliche kleinere Gebäude der „Kleinhäusler“. Neben dem katholischen Friedhof auch ein Judenfriedhof. Ein Dorf wie viele andere, die von Schwaben gegründet und aufgebaut worden waren.
Unsere Vertreibung aus Tevel erfolgte in mehreren Etappen. Der 25. April 1945 ist mir lebhaft in Erinnerung: An diesem Tag, weniger als vier Monate nach der Verschleppung meiner Mutter, erklingt die Trommel des Kleinrichters, eines nachgeordneten Gemeindeangestellten. Aus dem Haus geeilt, hören wir seine Botschaft: „Alle Dorfbewohner müssen bis halb zehn in der Wiese zum Schlagbruch mit kleinem Gepäck erscheinen. Das Dorf ist umstellt. Wer fliehen will, wird erschossen! Die Häuser sollen unverschlossen bleiben!“
Auf der Wiese angekommen, werden Männer, Frauen und Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt: Volksbündler auf der einen Seite, Mitglieder der Treuebewegung auf der anderen. Erstere kommen ins Ghetto in Lengyel. Letztere dürfen in ihre Häuser zurückkehren.
Eine Frau protestiert heftig. Als sie an ihrem Haus vorbeiziehen, ist es schon verwüstet: Die Möbel sind im Hof verstreut, teils demoliert, teils verschmutzt.
So wurden meine Großeltern und wir drei Kinder aus unserem Haus vertrieben. Wir durften nur das Allernotwendigste mitnehmen – das Vieh, Futter, die letzte Ernte und alle Vorräte mussten zurückgelassen werden.
Mit Ochsenwagen wurden wir nach Lengyel ins Schloss des Grafen Apponyi gebracht. Es war von einem Park mit riesigen Bäumen umgeben, wie ich sie bis dahin nicht gesehen hatte. Drinnen sah es weniger idyllisch aus: In leeren Räumen war Stroh aufgehäuft, als Grundlage für die Schlafstellen von Tausenden Menschen. Liegeplatz neben Liegeplatz, die Familien zusammen. Von den Donauschwaben wurde dieses Lager als Ghetto bezeichnet. Und ein Ghetto war es – nur diesmal für Schwaben.
Das Gebäude hatte als russisches Lazarett gedient, bevor die Deutschen einquartiert wurden. „Das Stroh war zertreten und verschmutzt. Da haben wir dann alle darauf schlafen müssen. Und unten haben sie eine Latrine ausgehoben. Und da mussten wir draufgehen“, erzählte mir Mari viele Jahre später.
Nicht alle akzeptierten die unwürdigen Bedingungen widerspruchslos. Eine Frau aus Tevel, die Leni Bas, protestierte lautstark. Sie wurde mit Wasser übergossen und in die „Federkammer“ gesteckt. Die herumfliegenden Federn kamen in Augen und Haare, sie war mit Flaum bedeckt. Dann holten die Wärter die Frau heraus und bespritzten sie wieder mit Wasser. Zudem musste sie vor den zusammengetrommelten Lagerinsassen tanzen. „Schaut, wie es denen geht, die sich gegen uns auflehnen!“, so die Botschaft der Wärter.
Doch damit nicht genug: Im oberen Zimmer hatten die Russen ihre Notdurft verrichtet: „Die Mädchen mussten hinaufgehen und diese mit ihren Händen zusammenrechen!“, so Mari. „Dann wurden alle wieder auf den Hof getrieben. Die Mitglieder der Familien wurden für unterschiedliche Arbeitseinsätze getrennt. Die Alten und die Kinder blieben zunächst in Lengyel.“ Die älteren Männer mussten auf den Ländereien des Guts arbeiten.
Mein zweijähriger Bruder Toni holte sich im verunreinigten Stroh eine Infektion. Dazu Mari: „Er bekam ein großes Geschwür hinter dem Ohr. Dieses öffnete sich, und es floss Eiter herunter. Aber wir hatten keinen Verband, nur ein Taschentuch. Dabei hatten wir Mühe, dieses zu waschen. Später hat mein Vater Blätter gesammelt und unter die Wunden gehalten, damit der Eiter nicht den Hals hinunterlief.“
Nach einiger Zeit wurde uns freigestellt zu gehen, wohin wir wollten – nur nicht zurück in unsere Häuser. Diese waren mittlerweile von Ungarisch sprechenden Szeklern – von den Schwaben „Czángo“ genannt – in Besitz genommen worden.
Dazu erzählte mir Kathi Jahre später: „Als wir von Lengyel zurückkamen, hatten wir nichts zum Anziehen außer den Kleidern am Leib. Deshalb entschloss sich meine Großmutter, die sehr gut Ungarisch sprechen konnte, mit mir zu Hegilis (Hausname ihrer Familie und meiner Mutter vor ihrer Heirat) zu gehen: Wir wollten einige der zurückgelassenen Kleider holen. Sie bat den Czángo, der in unserem Haus eingezogen war, Kleider mitnehmen zu dürfen.
Der ist mit der Mistgabel in der Hand hinter uns hergerannt. Mit der Mistgabel hat er uns verjagt!“
Als Mitglied der Treuebewegung hatte mein Onkel sein Haus behalten dürfen und wir fanden bei ihm Unterschlupf. Das Haus lag drei Kilometer außerhalb Tevels. Seine Frau war wie meine Mutter zum Arbeitsdienst in die Sowjetunion verschleppt worden. Seine beiden Söhne Steffi (Stephan) und Johann und ich gingen zu Fuß von der Czárda – so wurde sein Hof genannt – ab Herbst 1945 in die Volksschule in Tevel, drei Kilometer hin, drei Kilometer zurück. Öffentliche Verkehrsmittel gab es nicht.
Während der strengen Winter 1945/46 und 1946/47 fanden meine Großeltern mit uns drei Schülern Unterschlupf unweit des Schulgebäudes. Wir wohnten zu fünft in einem kleinen Zimmer. Auf dem Holzofen wurde gekocht und das Zimmer beheizt. Viel Platz blieb nicht.
Hier zeigte sich, wie stark meine Großmutter war: Sie war klein und von zierlicher Gestalt, mit dunklen Haaren und großen dunklen Augen. Doch im Gegensatz zum Großvater, der von den Entwicklungen überfordert und fast hilflos erschien, wusste sie, wie wir unter diesen Umständen weiterleben konnten. Wenn sich mein Großvater gegenüber uns herumtollenden Kindern nicht mehr zu helfen wusste, griff er manchmal zum Riemen. Großmutter aber war intelligent und hilfreich bei unseren schulischen Aufgaben.
Meine Kusine Mari erzählte: „Sie war kräftemäßig für die Landwirtschaft nicht geeignet, aber beim Spinnen, Stricken und Nähen sehr geschickt und flink!“
Während wir auf der Czárda waren, im April 1945, hörten wir: „Die Czángo kommen! Nehmt euch in Acht!“ Niemand wusste, ob sie die Deutschen als Freiwild betrachten würden. Deshalb flohen die Frauen und Mädchen, zusammen mit uns Kindern, in den nahen Wald. Nach drei Tagen kehrten wir jedoch auf die Czárda zurück.
Die Czángo waren einfache, meist arme Leute. Viele waren Holzfäller oder Schäfer in Moldawien gewesen. Für sie bedeutete die Zuweisung von Bauernhöfen mit Ländereien eine erhebliche Verbesserung ihrer Lebensgrundlage, allerdings um den Preis der Vertreibung der Donauschwaben.
Mein Großvater mütterlicherseits rief denen, die seinen Hof okkupierten, im Zorn zu: „Wartet nur, es wird noch anders kommen!“ Sie sahen dies als massive Drohung an. Am Abend riefen sie die Polizei und bewirteten sie mit Alkohol, um sie aggressiver zu machen. Mein Großvater war von einem Gemeindeangestellten, dem Klee-Richter (kleiner Richter), gewarnt worden: Er übernachtete auf dem Heuboden seines Nachbarn. In angetrunkenem Zustand erschienen nun die Polizisten mitten in der Nacht vor dem Haus meines Onkels: Alle Bewohner mussten in Nachthemden im Hof antreten. Mein Großvater war offensichtlich nicht unter ihnen. Auch die intensive Suche im Haus durch die Polizisten half nichts.
Da kam die Drohung: „Sagt uns, wo der Propst-Großvater ist, oder wir erschießen euch!“ Alle schwiegen. Deshalb konzentrierten sie ihre Aufmerksamkeit auf meine Großmutter. Auch sie sagte ihnen nichts. Daraufhin nahmen sie sie mit ins Polizeirevier, schlugen sie wiederholt. Mit dem Gewehrkolben in der Hand musste sie in die Knie gehen, wieder aufstehen, in die Knie gehen, rauf, runter …
Am nächsten Morgen wurde sie nach Bonyhád zum Gericht gebracht. Ihre Beine waren stark angeschwollen. Als sie wieder zurückkam, konnte sie nicht mehr richtig schlafen. Aber ihren Mann hat sie niemals verraten.
Unter diesen Umständen konnte mein Großvater nicht länger in Tevel bleiben – früher oder später hätte die Polizei ihn gefunden. Also floh er nach Àgád, eine ungarische Gemeinde, in der er als Kind Ungarisch gelernt hatte. Dort fand er eine alte Frau, die ihn von damals kannte. Sie nahm ihn auf und gab ihm Arbeit als Knecht.
In der Zwischenzeit kam sein Sohn Martin, der Bruder meiner Mutter, vom Militärdienst zurück. Er fand Arbeit in einer Mühle unweit der Czárda, wo seine Frau als Köchin arbeitete. Ihre eine Tochter, meine Kusine Mari, kam mit dreizehn Jahren als Dienstmädchen nach Szekszárd, die andere Tochter, meine Kusine Kathi, arbeitete mit ihren zwölf Jahren als Kindermädchen bei einer Familie, sechzig Kilometer entfernt von ihren Eltern. Meine Großmutter mütterlicherseits fand mit meinem kleinen Bruder Toni eine kleine Wohnung in der Mühle.
Mari blickte später auf diese Zeit zurück: „In den ungarischen Dörfern waren die Deutschen durchaus gut angesehen, vor allem als billige Arbeitskräfte. Außer Unterkunft und Essen gab es für uns Jugendliche nicht viel: Zusammen mit einer Teveler Freundin kaufte ich uns von unserem Monatslohn ein Kilogramm Weintrauben.“
Aus heutiger Sicht würde ich sagen: Sowohl die Donauschwaben als auch die Szekler waren Opfer und nicht Täter. Die Aussiedlungen hätten die Schwaben niemals freiwillig gewählt. Und die zugesiedelten Szekler wären wohl lieber in ihrer alten Heimat geblieben.
Die Leidensgeschichte unserer Familie war noch lange nicht zu Ende: Anfang 1947 wurde mein Onkel Mathias, zusammen mit der restlichen Familie, aus seinem Haus vertrieben. Wir kamen auf den Maierhof, ein Gutshof im nahe gelegenen Ort Högyész, in sehr viel ärmlichere Verhältnisse als bisher. Der Maierhof war eine typische Puszta – ein Gehöft für Landwirtschaft oder Viehzucht.
Zusammen mit meinem Bruder Matheis schlief ich in einem Bett. Als Unterlage diente Stroh. Bei Tageslicht konnten wir regelmäßig beobachten, wie Mäuse herumhuschten, wohl auf der Suche nach Nahrung.
Wir Kinder wurden zum Arbeiten eingesetzt: Wir hatten die Schafe zu hüten, gingen also regelmäßig auf die Weiden in der Umgebung von Högyész. Es waren auch einige größere Buben dabei. Eines Tages hörte ich das erbärmliche Geheul eines Hundes. Näher gekommen sah ich, dass die größeren Buben mit dicken Stöcken auf einen abgemagerten Hund einschlugen. Bei jedem Schlag stieß er ein markerschütterndes Jaulen aus. Blut floss von seinem Kopf und Nacken.
„Lasst den Hund in Ruhe! Er hat euch doch nichts getan!“, rief ich ihnen zu. „Du hast keine Ahnung – er ist räudig, und wenn er uns beißt, bekommen wir die Tollwut!“, war ihre Antwort. Ich lief davon, mein Gesicht nass von Tränen.
Auch später im Leben folgte ich instinktiv meinen Gefühlen, wenn es darum ging, den Schwächeren gegen den Stärkeren zu verteidigen. Erst in der Schule, dann im Internat, wo ich gezielte Strategien entwickelte, wie wir Schwächeren uns gegen die Stärkeren und Älteren durchsetzen konnten. Weglaufen wollte ich jedenfalls nie wieder – das hatte ich mir fest vorgenommen.
Ein anderer Vorfall hätte für mich böse Folgen haben können.
Eines Tages sah ich im Gras am Wegesrand ein metallenes Objekt, einer Konservendose ähnlich. „Hurra, damit können wir nach der Schule Fußball spielen!“, sagte ich zu Steffi und Johann und versteckte das Objekt in einem kleinen Busch, damit es bis zur Heimkehr aus der Schule keine anderen Liebhaber finden würde.
Am Heimweg fand ich die „Dose“ wieder und schickte mich an, damit zu spielen.
Ich lief einige Meter von meinen beiden Kusins weg, holte aus und warf das Objekt 20 Meter weit voraus, inmitten des Hohlweges.
Zunächst wurde ich wie von einer großen Faust brutal getroffen und rückwärts zu Boden geschleudert. Ganz benommen richtete ich mich auf: Im Weg klaffte ein beachtliches Loch. Ich blutete im Gesicht – am Augenlid – und am Bauch. Mir war schwindlig. Hätte mich der Splitter einige Millimeter tiefer getroffen, hätte ich wohl das Sehvermögen auf einem Auge verloren. Jahrzehnte später hat eine MRT-Untersuchung gezeigt, dass ein Metallsplitter bis heute in meiner Hirnrinde feststeckt.
Bei der Dose handelte es sich um eine ungarische Handgranate. Deren Form kannten wir nicht, im Gegensatz zu den deutschen Handgranaten, die neben dem Gehäuse auch einen Stiel zum Werfen hatten.
Auf dem weiteren Weg kamen wir zu einem Teich. Ich ging barfuß hinein, um mir das Blut vom Gesicht und vom Hemd zu waschen. Auf einmal drehte sich alles um mich herum. Mein Kusin Steffi führte mich aus dem Wasser heraus.
Ein weiterer Vorfall erschütterte mich noch viel mehr und traf mich bis ins Innerste: Mein Vater war mit seiner Einheit im Rheinland in amerikanische Gefangenschaft geraten.
Im August 1945 konnte er fliehen und arbeitete in einer Gärtnerei bei Köln. Im Frühjahr des folgenden Jahres machte er sich zusammen mit drei anderen Männern auf den Weg nach Hause. Einer dieser Männer kam aus dem grenznahen Ort Pusztasomorja (auf der österreichischen Seite liegt – wie erwähnt – Andau). Sie überquerten die Grenze zwischen Österreich und Ungarn bei Nacht.
Mein Vater reiste weiter, bis er in der Nähe von Tevel auf meinen Onkel Martin traf. Von ihm erfuhr er von der Verschleppung meiner Mutter nach Russland, von der Vertreibung … Martin warnte meinen Vater: „Die Heimkehrer sind nicht sicher. Die Gendarmen nehmen sie fest und schicken sie ins Arbeitslager nach Russland.“ Mein Onkel wäre verpflichtet gewesen, ihn bei der Polizei zu melden.
Meine Kusine Mari schilderte später seine damalige Situation: „Sie hätten deinen Vater sofort ins Lager gebracht und wie einen Kriegsverbrecher eingesperrt. Man hätte ihn nie in Tevel geduldet, denn es wurde unterstellt, dass er verantwortlich dafür war, dass sich so viele junge Männer 1940 und 1941 zur Waffen-SS gemeldet hatten und später in Russland umkamen. Es gab Gehässigkeiten zwischen den Pro-Deutschland- und Pro-Ungarn-Tevelern, die ja alle deutscher Abstammung waren. Auch deine Mutter hätten die Teveler nicht geduldet, wenn sie nicht nach Russland verschleppt worden wäre und somit auch ein Opfer gewesen wäre!“
Erst nach Einbruch der Dunkelheit sollte mein Vater – so der Rat meines Onkels – sich bei meinen Großeltern melden, damit er nicht gesehen würde.
Dennoch habe ich eine Erinnerung an einen heißen, schwülen Sommerabend. Die Erwachsenen schienen unter großer Anspannung zu stehen. Wir Kinder wussten nicht, warum. Sie schickten uns frühzeitig ins Bett. Ganz ungewohnt sperrten sie die Tür zum gemeinsamen Schlafzimmer zu.
Auf einmal horchte ich auf: War das nicht die Stimme meines Vaters, den ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen oder gehört hatte? Ich rüttelte an der Tür, schlug mit Fäusten dagegen und rief: „Vater! Vater!“ Es fruchtete nichts. Die Tür blieb verschlossen. Schließlich gingen wir vier – Steffi, Johann, Matheis und ich (mein Bruder Toni war bei der Familie meines Onkels) – schlafen.
Am nächsten Morgen verhielten sich die Erwachsenen, als ob nichts gewesen wäre.
Mein Vater kehrte zurück zu seinem Bekannten in Pusztasomorja. Dieser regte an, dass er zwischen Wien und Pusztasomorja als Schmuggler tätig sein könnte, denn in Wien brauchte man Lebensmittel wie Speiseöl, Schinken und Würste. Dies musste von den Bauern im Weinviertel sowie in Ungarn eingetauscht werden. Dadurch hätte er Gelegenheit, von der ungarischen Seite Geld und Lebensmittel an die Familie auf der Czárda zu schicken. Und schließlich könne er auf diese Weise leichter erfahren, ob und wann seine Frau – meine Mutter – aus der russischen Gefangenschaft zurückkehren würde.
Für meinen Vater war dies ein ungewöhnlicher Vorschlag: Er war schon als Kind und Jugendlicher ob seines Wissensdrangs aufgefallen. Unter heutigen Bedingungen hätte er studiert und einen bürgerlichen Beruf ausgeübt.
Doch er entschloss sich, die Schmugglertätigkeit auszuüben – mit bescheidenem Erfolg. Durch diese Tätigkeit lernte er die im 20. Bezirk Wiens lebende Familie Franz und Franziska Logotka kennen. Und zu ihnen holte er mich (kurz vor Ende meines zweiten Schuljahres) nach Wien. Die „Franzi-Tante“ und der „Onkluschka“ wurden zu meinen Ersatzeltern. Bei ihnen fand ich Wärme und Geborgenheit. Zusammen mit ihrer sechzehnjährigen Tochter Traudl und der Oma lebten wir in einer mittelgroßen Wohnung. Meinen Vater sah ich nur, wenn er von seinen Schmuggelgängen zurückkam.
Bei seinem letzten Besuch in Ungarn erfuhr er, was mit den verbliebenen Familienmitgliedern geschehen war:
Anfang 1947 musste auch sein Bruder mit dem Rest der Familie das Haus verlassen. Sie kamen auf den Gutshof nach Högyész. Am 16. März 1948 wurden dann die Teveler, sowohl die Volksbündler als auch die Mitglieder der Treuebewegung, in Szakály-Högyész in Viehwaggons gesteckt und in die in Ostzone Deutschlands verfrachtet. Sie kamen in Pirna bei Dresden ins Lager.
Wenn ich diese Ereignisse Revue passieren lasse, bewundere ich die Charakterstärke der Teveler und die meines Vaters: Zweifelsohne hatte es viel Mut erfordert, in die Umgebung Tevels, geschweige denn nach Tevel selbst, zurückzukommen. Ich kann diesen Mut nur bewundern.
Manchmal frage ich mich, ob das Verhalten der Russen und der Ungarn gegenüber den Donauschwaben das Maß dessen nicht weit überschritt, was man unter zivilisierten Völkern erwarten darf. Zweifelsohne hatten die Gräueltaten der Nazis während des Krieges den Hass auf alle Deutschen geschürt: Dafür mussten wohl die Deutschen büßen, derer man habhaft werden konnte – Flüchtlinge und Vertriebene, darunter auch die Donauschwaben. Obwohl die Donauschwaben seit Jahrhunderten in Ungarn angesiedelt waren. Sie waren ungarische Staatsbürger, leisteten Militärdienst und erfüllten ihre staatsbürgerlichen Pflichten. Woher kam also die Legitimation, sie aus ihren Häusern zu vertreiben und ins ferne Deutschland zu schicken? Hatten die Donauschwaben dazu beigetragen, weil sie sich nicht völlig in die ungarische Gesellschaft integrieren ließen?