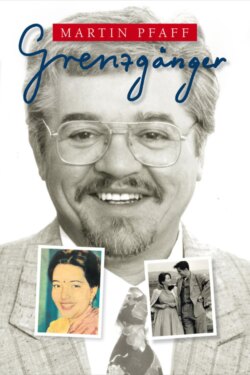Читать книгу Grenzgänger - Martin Pfaff - Страница 11
4.2. Von Teheran nach Lahore:
Die verschlungenen Pfade der Bürokratie
ОглавлениеZu diesem Zeitpunkt – am 23. Januar 1958 – hatten wir eine klare Vorstellung von unseren weiteren Reiseplänen. Es kamen zwei Routen in Betracht: Die nördliche Route führt über die iranische Stadt Mashad am nordöstlichen Zipfel Irans, dann weiter über die afghanischen Städte Herat und Kabul zum berühmten Khaiberpass und nach Pakistan. Von dort über Peshawar und Lahore nach Indien. Die zweite Route lief über den südöstlichen Zipfel Irans via Isfahan, Yazd, Kerman, Bam und Zahedan in das pakistanische Belutschistan (Nok Kundi, Quetta) und dann weiter nach Nordosten über Lahore nach Indien. Die erste Route – so erfuhren wir von allen Befragten – wäre für uns im Winter unpassierbar, wegen des beträchtlichen Schneefalls. Also blieb nur die südliche Route über Belutschistan. Für beide Routen würden wir Visa benötigen: für Afghanistan und Pakistan für die Nord- und nur für Pakistan für die Südroute. Nicht einmal im Traum kam uns der Gedanke, dass wir fast drei Monate – bis zum 15. April – brauchen würden, um die Grenze nach Pakistan zu überqueren.
Die Schwierigkeiten hatten mit Fathers Nationalität zu tun. Angesichts der politischen Spannungen wollte man keinen indischen Staatsbürger durch die Region Quetta reisen lassen: „Quetta ist von strategischer militärischer Bedeutung für Pakistan. Visumantrag abgelehnt.“ So lautete die Auskunft des Referenten in der pakistanischen Botschaft in Teheran.
Father wäre nicht der Mann gewesen, der er war, wenn er bei dieser Hürde resigniert hätte. Er versuchte einflussreiche Menschen dazu zu bringen, für ihn zu intervenieren: In Teheran den pakistanischen Botschafter, auch den indischen Botschafter, in Isfahan – wohin wir als nächstes fuhren – den Anglikanischen Bischof Thompson (Church Mission Society, C.M.S.), um über seine Organisation in Karachi den Chef der zuständigen Behörde zu beeinflussen. Am 19. Februar erhielten wir ein Telegramm aus Karachi: „Permit erst nach zehn Tagen möglich.“ Hurra, endlich ein Lichtblick! Am 5. März dann die Ernüchterung: „Abrahams Permit abgelehnt.“
Also doch über die Nordroute, über Afghanistan, nach Pakistan und Indien. Aber die Pakistanische Botschaft weigerte sich, ein Visum für Father mit der Route über den Khaiberpass zu erteilen! Die Hiobsbotschaft: „Sie müssten Karachi konsultieren. Und das würde mehr als drei Wochen Zeit erfordern!“
Fathers Hoffnung war die Indische Botschaft, insbesondere ein christlicher Diplomat namens Axel Khan. Dieser empfahl als Ausweg die Seereise von Khorramshahr nach Bombay. Er rief mehrere Reedereien an, um günstige Passagen zu erhalten – teure konnten wir uns nicht leisten. Father befürchtete, dass er nach Ankunft im Hafen von Bombay einen sehr hohen Einfuhrzoll für das Auto zahlen müsste, wofür ebenfalls das Geld nicht reichte.
Also wurde ein Brief an den Chief Controller of Imports and Exports mit Bitte um Einfuhrerlaubnis geschrieben. Begründung: Der Wagen und sein Inhalt würden für die karitative Arbeit zur Gründung und Organisation einer Blindenschule benötigt. Ein weiteres Schreiben ging an Herrn M. O. Mathai, einen Christen aus Kerala, der Special Assistant to the Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, war, mit Bitte um Unterstützung zum Erhalt der Einfuhrgenehmigung. Weitere Telegramme nach Pakistan folgten.
Unsere Aufenthaltsgenehmigung für den Iran lief kurz vor der geplanten Abreise aus. Um von den Polizeistellen eine Verlängerung zu bekommen, musste jeder von uns sieben Fotos abliefern und vier Formulare ausfüllen – den Heiligen Bürokratius mag’s freuen, uns frustrierte es. Sollten wir nach so vielen positiven Wendungen unserer Reise hier scheitern, weil uns eine politisch-bürokratische Gummiwand immer wieder abprallen ließ?
Am 27. März gingen wir wieder einmal zur Indischen Botschaft, um unsere Post abzuholen. Und das Wunder geschah: Wir erfuhren von Botschaftsangehörigen, dass das erforderliche Visum für Father von den pakistanischen Behörden genehmigt worden sei – durch den Einfluss des Indischen Botschafters, seine Schreiben nach Neu-Delhi, Karachi und durch den Pakistanischen Botschafter in Teheran. Die Pakistanische Botschaft stellte das Visum aus, ohne eine Visumgebühr und die Telegrammgebühren von fünfundzwanzig Dollar in Rechnung zu stellen, zu denen sie uns vorher verpflichtet hatte!
Die zwei Monate Verzögerung gaben uns Gelegenheit, Zeugnisse der stolzen Geschichte Persiens zu sehen: In Isfahan besichtigten wir den Meidan i Schah, die Masjid i Shah (Moschee des Shahs), seine Residenz (Aali Quapu), die Moschee des Sheich Lutfollah und den großen Basar, der angeblich zwanzig Kilometer lang war. Auf dem großen Platz fanden früher Polospiele statt – unter den Augen des Shah, der in seiner Residenz einen „Logenplatz“ innehatte.
Wir besuchten auch den Fluss Zayandeh Rud – den „lebenden Fluss“ mit seinen herrlichen Brücken aus der Zeit des Großen Shah. Auf der anderen Seite Julfa, das armenische Viertel.
Damals schon zählte ich Isfahan neben Florenz zu meinen Lieblingsstädten – nicht nur wegen des Flusses und der Brücken, sondern auch wegen der Synthese von Natur und Kultur. Bei meiner Italienreise hatte ich am 27. Juli 1955, also fast drei Jahre zuvor, über Florenz eine Postkarte nach Hause geschrieben: „Florenz ist herrlich! Kunst! Die schönste Stadt der Welt!“ Fortan sollte ich Isfahan zusammen mit Florenz in die gleiche Kategorie von Städten einordnen.
Father nutzte die Gelegenheit, die christlichen Kirchen und deren Vertreter kennenzulernen, Bischof Thompson von der (anglikanischen) Church Mission Society und deren Schulen einschließlich einer Blindenschule.
Wir besuchten auch die Blindenschule für Knaben, die von Herrn Lörner und Frau Wilhelm geleitet wurde. Gegründet hatte diese Institution Pastor Christoffel, ein unermüdlicher Arbeiter zum Wohle der Waisen und Blinden im Mittleren Osten. Wie wir erfuhren, war er trotz vielfältiger Schwierigkeiten fünfzig Jahre lang tätig gewesen.
Father Abraham war als Prediger gefragt, beispielsweise in Julfa. Und ich zeigte unsere Farbdias aus dem Heiligen Land.
Großartig war auch die Fahrt nach und der Aufenthalt in Shiraz, der Stadt der Rosen: Die Straße von Isfahan nach Shiraz erstreckte sich Hunderte von Kilometern durch das wüstenartige Hochland, begrenzt durch schneebedeckte Bergrücken. Mehrfach mussten wir den Medus-Fluss überqueren, obwohl es keine Brücken gab! Ich habe noch ein Diabild mit unserem getreuen Volkswagen, am Ufer stehend, während zwei große Lastwagen diesen mühsam durchqueren. Ich erläuterte Father die Lage: entweder umdrehen – oder durch! Mit all den Risiken, die damit verbunden waren, falls das Auto mitten im Fluss „absaufen“ würde. Zunächst würden wir selbst ans rettende Ufer waten müssen, dann würden wir auf einen Lastwagen warten müssen, der unseren Wagen aus dem Fluss herauszog. Und was dann? Woher die Gewissheit, dass der Wagen dann wieder anspringen würde?
Ich entschloss mich dennoch durchzufahren – im Vertrauen darauf, dass durch die hoch oben platzierten Lufteintrittsrillen im Heck des Autos nur begrenzte Mengen Wasser in den Motorraum eindringen würden und dass die Motorabdeckhaube dicht am Fahrzeugkörper aufsaß. Father stimmte zu.
Ersten Gang einlegen und mit hoher Tourenzahl die Böschung hinunter ins Nass. Ein Schub Wasser ging über die Windschutzscheibe hinweg, und ich hoffte, dass es nicht in die Lufteintrittsschlitze dringen würde. Dann waren wir drinnen, die Scheibenwischer an, das Wasser stand bis zum Unterrand der Scheiben der Wagentüren. Gerüttelt, geschüttelt, dann schoben wir uns nach einer schier endlos scheinenden Zeit auf der Gegenseite die Böschung hinauf! Ich stieß einen Schrei der Erleichterung aus, und Father beendete wohl die Gebete, die uns bei der Durchquerung des Flusses begleitet hatten.
In Shiraz wurden wir von Reverend Sharp, dem CMS-Missionar, in seinem attraktiven Haus begrüßt. Er hatte eine sehenswerte Kirche in der Stadt gebaut. Zu seinen Hobbys zählte die Geschichtsforschung auf der Grundlage der Inschriften in den Ruinen der Königsstädte. Seine Erkenntnisse vermittelte er in Büchern über die großartige Vergangenheit des Iran. Wir hätten uns keinen fachkundigeren Führer durch „den schönsten Juwel des Iran“ wünschen können als Reverend Sharp.
Der Höhepunkt war für mich zweifelsohne die über achtzig Kilometer lange Fahrt zurück nach Persepolis, zu den Palästen von Darius dem Großen: großartig die in die Felsen gemeißelten Gräber, darunter die von Artaxerxes II. und III. In einiger Entfernung von Persepolis findet man in Naqsh-e Rustam vier Gräber in die fünfzig Meter hohen Felswände gehauen: von Darius II. und Darius dem Großen sowie von Xerxes. Ihre Gräber hatten dieselbe unfreundliche Beachtung durch Grabräuber erlitten, wie dies bei vielen ägyptischen Pharaonen auch der Fall gewesen war.
Unterhalb der Gräber, schon fast auf ebener Erde, hatten die Sausanischen Monarchen ihre Spuren in Form von sieben Reliefs hinterlassen. Das berühmteste von ihnen zeigt den Triumph des persischen Herrschers Shapur I. über den römischen Kaiser Valerian: Letzterer kniet zu Füßen des persischen Königs, als Zeichen der Unterwerfung.
Auf der Rückreise von Shiraz nach Isfahan besuchten wird dann – endlich! – Pasargadae, die Residenz von Cyrus dem Großen. Sie liegt 1890 Meter über dem Niveau des Persischen Golfes, 43 Kilometer Luftlinie – 80 Straßenkilometer – von Persepolis entfernt. Die Straße folgte dem Pulvar-Fluss, dem antiken Medus. Zu den Höhepunkten unserer Besichtigungen zählten der Palast der Säulen, in dem Cyrus seine Audienzen abhielt, der private Palast und die Apadana sowie die Ruinen eines Turmes, die vom Grabmal des Kambyses übrig geblieben sind. Das vom Volksmund als „Grabmal der Mutter Salomons“ bezeichnete Gebäude ist wohl das Grab von Cyrus dem Großen: eine Struktur aus Stein, ohne Fenster im eigentlichen Grabraum, in dem der Leichnam von Cyrus einmal in einem goldenen Sarkophag ruhte, neben den Grabbeigaben, wie sie von Aristoteles beschrieben wurden.
Nach dem Abschied von unseren Freunden – diese schlossen mittlerweile auch Father Dionysios aus Julfa ein – ging es am Montag, 7. April, weiter nach Yazd, eine Stadt mit zoroastrischer Tradition. Die Anhänger dieser alten Religion werden manchmal auch „Sonnen- und Feueranbeter“ genannt, denn Sonne und Feuer betrachten sie als Symbole für Reinheit und Göttlichkeit.
Die Ursprünge der Lehre Zarathustras sind in der Vorgeschichte zu finden. Seine Geburt wird auf ca. 1000 v. Chr. datiert. Nach Nietzsche war Zarathustra (altgriechisch Zoroaster genannt) der erste, der im Kampf zwischen Gut und Böse das zentrale Element der Dinge sah. Demnach findet in der Welt ein epischer Kampf zwischen dem „guten“ Schöpfergott Ahura Mazda und seinem „bösen“ Widersacher Ahriman statt. Am Ende siegt Ahura Mazda, nachdem ein Jüngstes Gericht stattgefunden hat. Die Toten werden auferstehen; die Guten landen im Paradies, die Bösen in der Hölle.
Für mich brachte die Befassung mit der Lehre des Zarathustra so etwas wie eine kleine Erleuchtung: Zu offensichtlich waren die Parallelen zwischen den jüdischen und christlichen Konzepten von Gott und Teufel, dem Guten und dem Bösen und dem Glauben an das Ende der Welt. Selbst das Konzept des Messias war in den Vorstellungen der Anhänger Zarathustras enthalten! Allerdings glaubten diese, dass es drei Messiasse geben werde und dass der Kampf zwischen Gut und Böse zwölftausend Jahre dauern werde. Angesichts dieser Parallelen wunderte es mich nicht, dass einige Historiker und Wissenschaftler überzeugt waren und sind, viele dieser Vorstellungen seien in die jüdische, christliche und islamische Religion eingegangen. Selbst der Dualismus zwischen Ahura Mazda und Ahriman wurde in einer höheren Einheit aufgelöst, indem man sie später auf die Zeit, das Licht oder den Raum zurückführte. So kann man auch in dieser Religion einen schlichten Monotheismus sehen.
Noch verblüffender war für mich, dass die Lehre des Zarathustra eine Frage beantwortete, die ich im Stift Heiligenkreuz nicht befriedigend klären konnte: Warum lässt der liebende Gott das viele Leid in dieser Welt zu, wo er es doch leicht verhindern könnte? Nach der religiösen Auffassung der Anhänger Zarathustras hat der Mensch die Freiheit, sich zwischen Gut und Böse zu entscheiden, ist also ein aktiver Teilnehmer am epischen Kampf unserer Zeit. Ihrer Meinung nach ist er sogar dazu verpflichtet, dies durch gute Gedanken, gute Worte und gute Taten zu tun und die Wahrheit – nicht Lug und Trug – hochzuhalten. Wenn also Gott, so sagte ich mir im Lichte der Lehre Zarathustras, dem Menschen diese Freiheit gegeben hat, wie kann er dann im Einzelfall und direkt in die Prozesse eingreifen, die durch freie Entscheidungen von vielen Menschen entstanden sind? Ganz glücklich war ich mit dieser Erkenntnis allerdings nicht und ich haderte weiter mit der Ungerechtigkeit und Sinnlosigkeit der Welt.
In Yazd gab es noch Feuertempel mit dem immer brennenden Feuer und „Türme des Schweigens“ auf hohen Bergspitzen, wo die Leichname der Gläubigen den Vögeln zum Verzehr ausgesetzt werden. Durch die Invasion der muslimischen Araber im 7. Jahrhundert wurden viele Anhänger dieser Religion verfolgt und getötet. Andere flohen nach Indien, wo sie es als „Parsis“ – Perser – meist zu Wohlstand gebracht haben, vor allem in Bombay. Ich sollte später mehrfach Gelegenheit haben, mich mit heutigen Parsen – darunter auch entfernte Verwandte – über die Bedeutung ihrer Religion in der heutigen Welt zu unterhalten. Sie sehen in ihrer Religion eine lebensbejahende Konzeption und halten nichts von Selbstkasteiung oder Abstinenz. Das von vielen Hindus und Christen praktizierte Fasten halten sie gar für eine Sünde.
Bei unserem Eintreffen im Iran im Januar hatte grimmige Kälte geherrscht. Drei Monate später und Hunderte von Kilometern weiter südlich war es heiß geworden. Bedingt durch die Hochlage des Iran und das trockene Wüstenklima konnten wir die Hitze meistens gut aushalten, zumal es in der Nacht deutlich abkühlte. Dies sollte sich ändern, je weiter wir in den Süden kamen.
Auf dem Weg nach Kirman überquerten wir die Sandwüste in der Nähe von Kabusar Khan. In Kirman besuchten wir den österreichischen Arzt Dr. Hermann Oberecker. Die kleine christliche Gemeinde Kirmans hieß uns freundlich willkommen.
Am 9. April feierten die Muslime den Tag von Alis Verwundung mit Meditation und lautem Wehklagen. Ich wusste natürlich, auch von Father, etwas über die Geschichte des Islam: dass die Schiiten im Iran und auch im Irak die Mehrheit stellten, dass sie aber weltweit nur etwa zehn Prozent der Muslime ausmachten, womit der überwiegende Teil der Muslime aus Sunniten bestand.
Über meine persönlichen Erfahrungen mit den Sitten und Gebräuchen der Schiiten in Kirman schrieb ich nach Hause: „In einem Gebäude war eine größere Zahl von Muslimen versammelt. Wir waren gegenüber, in einem CMS-Missionsgebäude, untergebracht (die Mission ist aufgegeben, kein Erfolg). Der Torhüter, ein alter Schlingel, hat Father Abraham als pakistanischen Mullah (einen islamischen Geistlichen!) ausgegeben und vorgestellt. Alle in Schleier gehüllten Frauengestalten sind ehrerbietig zur Seite getreten und wir wurden durch die Mitte ins Haus geführt, wo die Männer im Türkensitz am Boden saßen. Etwa zweihundert. Uns wurde ein Ehrenplatz angewiesen, das heißt in einer teppichbelegten Ecke, die für Ehrengäste reserviert war. Nun marschierten verschiedene Mullahs zur Rednertribüne. Nach der Lesung eines Kapitels aus dem Koran begannen sie ihren Sermon über die Verwundung Alis, bis ihre Rede in Schluchzen erstickte. Nun fingen alle Frauen laut zu klagen und weinen an, und die Männer ächzten und stöhnten. Nachdem wir dies einige Zeit mitgemacht hatten, machten wir uns aus dem Staube, bevor die werten Muslime Father Abraham zu einer Ehrenrede einladen konnten! (Jeder Mullah sollte Arabisch können!) Oder bevor sie herausfinden konnten, dass wir Christen waren. (Gnade uns Gott!) Dieser alte Gauner von einem Missionstorhüter hätte uns bald zu unangenehmen Erinnerungen verholfen!“
Was ich in meinem jugendlichen Überschwang als Abenteuer darstellte, kann aus heutiger Sicht auch anders interpretiert werden: Vielleicht wusste die schiitische Gemeinde sehr wohl, dass wir Christen waren, und sie hießen uns aus Höflichkeit und Toleranz willkommen. Später hatte ich mehrfach Gelegenheit, in anderen Teilen der Welt islamischen Gottesdiensten beizuwohnen, mit vollem Wissen der Gemeinde.
Vor Bam wurden wir von unseren persischen Bekannten, aber auch von internationalen Besuchern, nachdrücklich gewarnt: Es sei ein Räubernest, vor dem wir uns hüten sollten! Dies konnte uns nicht abhalten, dorthin zu fahren, führte doch die Strecke nach Pakistan über Belutschistan genau durch diese kleine Stadt.
Bam lag nun vor uns: Was tun? Wenn man der Polizei auch nicht trauen konnte, blieben nicht allzu viele Optionen übrig. Wir fragten uns durch nach dem örtlichen Lehrer. Herr Sadjady beriet uns nicht nur, er lud uns als seine Gäste zu sich in sein komfortables Heim ein. Im Gespräch stellte sich im Lauf des Abends heraus, dass er früher ein Schüler einer CMS-Schule in Kirman gewesen war.
Nach Bam kam der schwierigste Teil unserer Reise, die Strecke nach Zahidan. Wir mussten die berüchtigte Dascht-e Lut durchqueren, eine Salz- und Sandwüste. Schon Alexander der Große hatte hier verheerende Erfahrungen bei seiner Rückkehr von Indien gesammelt: Ein großer Teil seiner Soldaten kam bei dem Rückzug ums Leben.
Nicht umsonst wird diese Wüste „Tal des Todes“ genannt, so die Übersetzung ihres Namens. Bald fand ich heraus, dass die sicherste Art des Fahrens aus einer Art Gleiten bestand: Die Geschwindigkeit im Sand durfte weder zu groß sein, um Auffahrunfälle bei den Sanddünen zu vermeiden, noch zu gering, um nicht stecken zu bleiben. Ich griff auf meine Erfahrungen als Pulverschneefahrer zurück – nur waren die Skier besser geeignet für den Schnee als unsere Reifen für die Sandwüste.
Die Hitze lähmte Haupt und Glieder. Das Hirn schaltet dabei am liebsten ab, soweit dies während des Konzentration fordernden Fahrens über Pisten und neben Dünen möglich ist. Ein Glutofen, der sich Kilometer für Kilometer erstreckt. Dazu der Sand, der früher oder später durch die Ritzen des Autos dringt, in die Kleider, ins Gesicht, ja sogar in Augen und Ohren. Der Schweiß stand nicht nur mir auf der Stirn.
Nach einer Kurve tauchte ein Lastwagen auf. Er hatte sich festgefahren und steckte tief im Sand. Bevor ich überhaupt entscheiden konnte, stehen zu bleiben, um zu helfen, dabei aber zu riskieren, dass ich nicht wieder loskommen würde, war es schon geschehen: Wir saßen ebenfalls fest! Da half kein Hin- und Herschaukeln, kein Versuch, im zweiten oder gar im dritten Gang loszukommen.
Also blieb nur, mit den Händen den Sand so weit wie möglich im Bereich der Räder wegzuschaufeln. In meiner jugendlichen Unerfahrenheit hatte ich nicht einmal eine Schaufel dabei, auch keine Matten – beides wäre für Schnee und Sand ratsam gewesen. Aber unser Auto war sowieso schon überladen. Ein stolz auf seinem Kamel vorbeireitender Beduine, das Gewehr neben seinem Fuß festgemacht, würdigte uns keines Blickes, als ich versuchte, seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Doch der Fahrer des Lastwagens kam mit einer Schaufel herüber und half, die Antriebsräder frei zu machen bis zum härteren Untergrund, und eine Rampe vor den Vorderrädern zu bauen.
Wir dankten ihm. Dann fuhr ich behutsam – im zweiten Gang – los. Weiter ging‘s auf festerem Sandboden den Bergen entgegen. Welch schöne Wüstenlandschaft mit einer breiten Palette an Farben – als hätte ein Künstler sich mit einem riesigen Pinsel ausgetobt! Kein Wunder, dass viele Menschen – ich gehöre auch zu ihnen – dem eigenartigen Charme der Wüste verfallen sind! Unerträglich waren nur die brütende Hitze und der aufgewirbelte Sand.
Am 15. April überquerten wir die Grenze nach Pakistan – mit unseren Visa kein Problem. Heute frage ich mich natürlich, ob es nicht auch viel leichter hätte gehen können. Doch auf diese Weise lernte ich den Iran viel besser kennen. Und auch intensiver: Wir trafen ein Menge interessanter Menschen. Schade, dass ich sie nie wieder gesprochen habe. Aber der Traum von Isfahan und Shiraz lebt in mir weiter. Vielleicht eines Tages …
Bei Mirjah verließen wir den Iran, nachdem wir ein Wadi durchquert hatten. Auf der pakistanischen Seite ging es weiter auf einer guten Straße durch die trockene und sehr heiße Wüste Belutschistans. Bei Nok Kundi wurden unsere Pässe kontrolliert, und wir mussten die Zollformalitäten erledigen. Zehn Meilen vor Dalbandin begann eine Asphaltstraße, dafür aber gerieten wir kurz vor Dalbandin in einen Sandsturm. Müde und verstaubt erreichten wir ein Rasthaus mit Bad und Toilette. Unter Bad ist ein großer Eimer mit Wasser zu verstehen, aus dem man mit einer kleinen Kelle Wasser über sich gießt. Kein Luxushotel hätte den Genuss überbieten können, den ich verspürte, als das lauwarme Wasser mir den Staub aus Haaren und Gesicht wusch. Auch den Begriff Toilette muss ich relativieren: Es handelte sich um eine schlichte Variante des mediterranen Klos. Aber das waren wir schon hinlänglich gewohnt.
Auch über den Süden des Iran und über Belutschistan hatten wir schaurige Geschichten gehört: beispielsweise, dass der U.S.-amerikanische Konsul zusammen mit Begleitern auf einem Jagdausflug spurlos verschwunden war.
An diesem Abend sah ich vor dem Schlafengehen durch die Ritze des Fensters eine Gestalt, die um unseren Wagen schlich und sich auf meinen Zuruf hin buchstäblich aus dem Staub machte. Dies trug nicht gerade zu meinem Seelenfrieden bei! Ich muss sehr unruhig geschlafen haben. Plötzlich wachte ich auf und hörte, wie eine dunkle Gestalt aus dem einfachen Bad ins Zimmer schlich. Ich tastete nach der gefüllten Wasserflasche, fasste sie und wollte mich auf den Eindringling stürzen, der plötzlich rief: „Martin, was ist los?“ Fast hätte ich Father Abraham höchst unfreundlich behandelt!
Nach Dalbandin ging es durch gebirgige Stammesgebiete. Diese wurden schon damals als gefährlich eingestuft, vor allem für Reisende in der Nachtzeit.
In Quetta wiederholten sich bekannte Muster: Father predigte im Bible Study Circle zum Thema „Das Evangelium nach Johannes“. Wir wurden vom obersten Richter, Herrn Ihaq Rahim Baksh, zum Abendessen eingeladen. Das Charisma von Father Abraham war so groß, dass auch Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften auf ihn zugingen.
Während der Fahrt über Belutschistan zum Indus wandelte sich das Wüstenklima zum subtropischen Klima des Industals: Die Vegetation wurde üppig, und mich beeindruckte, wie vielfältig die blühenden Büsche und Bäume waren, wie gewaltig das Konzert der Vögel am Morgen und wiederum am Abend, wenn die Nacht schnell herabsank. Und wie betörend der Duft der Blüten und Pflanzen, gerade nach Einbruch der Dunkelheit! Davon hatte ich schon in Österreich gelesen und geträumt: Rudyard Kipling ließ grüßen. Zwischen Sibi und Jacobabad, die als „heißeste Flecken des Subkontinents“ galten, gerieten wir erneut in einen ausgewachsenen Sandsturm. Ich sah, wie die Kamele einer Karawane sich mit dem Kopf gegen den Wind hinlegten. „Von Kamelen lernen heißt in der Wüste überleben lernen“, dachte ich und stellte unseren Volkswagen daneben, mit dem Bug zum Sturm. Der heiße Strahl fühlte sich an wie der glühende Atem eines Wüstendrachen! Feinstaub rieselte in die Kabine des Volkswagens, auf unsere Gesichter und Kleidung, obwohl wir Tücher vor das Gesicht banden. Nach einiger Zeit war der Spuk vorbei.
In der Mittagszeit erreichten wir Qazi Ahmedabad, eine Stadt voller Leben. Die Menschen trugen ihre schönsten Kleider, die Geschäfte waren farbenprächtig geschmückt: Man beging das muslimische Fest „Id“.
Wir erkundigten uns bei einem Mann am Straßenrand nach einem Restaurant, in dem wir essen könnten. Er sagte: „Bitte warten Sie hier eine Minute“, und verschwand. Fast wäre ich schon weitergefahren, doch Father sagte: „Bleib stehen. Er wird wiederkommen!“ In der Tat kam er wieder – mit einem Tablett voller Speisen: „Bitte essen Sie mit mir. Seien Sie meine Gäste am heutigen Festtag!“
Nach dem Essen dankten wir. Ich fotografierte den namenlosen Fremden, der über Länder und Religionen hinweg das Gemeinsame in uns sah und jene Gastfreundschaft zeigte, die ihm seine Religion gebot.
Am Dienstag, 24. April, erreichten wir Karachi. Zwölf Jahre zuvor war der Ort eine kleine Fischerstadt gewesen. Bei unserem Besuch fasste er schon fast zwei Millionen Einwohner.
Zweifelsohne ist schon Niarchos, der Admiral Alexanders des Großen, in dieser Region gewesen: „Alexandrou Limen“ – der Hafen des Alexander – ist entweder identisch mit dem heutigen Karachi, oder er lag nicht weit davon entfernt; die Details konnte ich nicht erfahren. Jedenfalls hatten wir in Sukkur am Indus wieder die historische Route Alexanders erreicht: Nach seinem Sieg im Fünfstromland des Indus („Punjab“) ließ er eine Flotte bauen und segelte den Fluss abwärts nach Süden, während ein Teil des Heeres am Flussufer entlangzog. Es wird berichtet, dass er von der Flussmündung aufs offene Meer hinausfuhr und sich damit zumindest symbolisch seinen Traum vom Erreichen des östlichen Meeres erfüllte. In Wirklichkeit war er wohl deprimiert, hatte doch sein Heer ihm endgültig die Gefolgschaft verweigert, als es um den Zug weiter nach Osten, durch die dichter besiedelten Gebiete der nordindischen Ebene ging. Während Niarchos und die Flotte an der Küste entlang zurück zum Zweistromland segelte, war Alexander mit einem großen Heer von Gwadar aus über Pura und Alexandria von Carmania (das heutige Kerman?) zurück nach Persepolis gezogen. Durch Hitze, Durst und Krankheit starben Zehntausende seiner Soldaten auf dem Weg. Wenig später starb auch Alexander, wohl an den Folgen eines Malariaanfalls. Über andere Todesursachen, einschließlich Vergiftung, wird bis heute spekuliert.
Nach mehr als einer Woche Aufenthalt verließen wir Karachi am Freitag, 2. Mai. Über Hyderabad ging es nach Sukkur, wo Father in der örtlichen Kirche predigte und wir unsere Freunde Padree Sahib und Herrn Isaacs trafen. Herr Isaacs arrangierte ein Quartier für uns in der Freimaurerloge, von der örtlichen Bevölkerung „Bhud Khana“ – „Haus des Teufels“ – genannt. Die unterirdischen Räume waren wohl die kühlsten im aufgeheizten Gebiet von Sind, in dem Sukkur liegt: Belutschistan im Westen, die große Indische Wüste im Osten, heizten gerade zu dieser Jahreszeit kräftig ein. Und damit es so richtig unangenehm wurde, lieferte der Indus ein hohes Maß an Luftfeuchtigkeit – ein Dampfbad!
Für mich sollte sich das Haus des Teufels als Segen erweisen: Während der Feier eines Kirchenjubiläums am 6. Mai befiel mich ein hohes Fieber. Am nächsten Tag begann ein Martyrium. Fieber, Erbrechen, Fieber, Erbrechen … Weder Nahrung noch Wasser blieb in meinem Magen. Meine Krankheit wurde als ein schwerer Fall von Malaria diagnostiziert. Es war rührend, wie sich Father trotz seines Handicaps um mich kümmerte, unterstützt von der Mutter unseres Bekannten Isaacs, dessen Dienern und dem örtlichen Arzt.
Es wurde einfach nicht besser. Ich war abgemagert, bleich, schwach und deprimiert, als die Missionsärztin Frau Dr. Terry mir drei Injektionen mit Qui-ninhydrochlorid verabreichte. Endlich – am Sonntag, dem 18. Mai – wurde ich wieder gesund. Meine Gedanken gingen nach Österreich, wo meine Familie den Muttertag feierte. Ich wusste, dass Mutter gerade an diesem Tag besonders an mich denken würde, war aber froh, dass sie keine Ahnung hatte, wie mies es mir ergangen war! Dies hätte die Befürchtungen bestätigt, mit denen sie meine Abreise aus Österreich begleitet hatte.
An meine Mutter schrieb ich: „Jetzt bin ich schon fast wieder ganz der Alte. Am Muttertag ist mir viel besser geworden. Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht, liebe Mutter. Ich habe gefühlt, dass ich in einer erbärmlichen Stadt am Indus war, wo ich doch gerne bei meinen Lieben zu Hause gewesen wäre. Doch eines: Father Abraham ist ständig aktiv, einmal macht er dieses Getränk, bald jenes, dann wäscht er mich. Es sorgt sich wirklich um mich, er versucht Mutter, Vater und Bruder zu sein. Also, jetzt bin ich schon fast gänzlich o. k. (nicht k. o.!!!). Macht euch keine Sorgen um mich.“
Auf der Weiterfahrt besuchten wir Harrappa, die Ruinen der jahrtausendealten Industal-Zivilisation. Zusammen mit Mohenjo Daro ist Harrappa beredtes Zeugnis einer vergangenen Hochkultur: Bäder, gepflegte Straßen, Wasserleitungen, Kanalanlagen für Toiletten und Abwasser, ein Fort auf einem Hügel. All das gab es in Harrappa bereits zweieinhalb Jahrtausende vor Christi Geburt! Diese Zeugnisse der menschlichen Entwicklung reihen sich ein in die Schar der Flusstal-Zivilisationen: das Alte Ägypten am Nil, die Kultur am Euphrat und Tigris und die Chinesische Zivilisation am Hoangho-Fluss. Das örtliche Museum zeigte Artefakte vom Zweistromland und auch vom Hoangho als Belege für die Kontakte, die schon damals zwischen den Zivilisationen bestanden haben müssen. Ein weiterer Höhepunkt unserer Expedition in die Kulturgeschichte der Menschheit!
Schließlich erreichten wir sehr spät abends Lahore, ein Ort mit großer Geschichte und beeindruckenden Kulturdenkmälern. Die nächsten Tage bemühten wir uns beim Deputy High Commissioner für Indien in Pakistan um eine Einfuhrgenehmigung und Befreiung von der Zollgebühr für Auto und Ausrüstung. Aber dies ging nur über Neu-Delhi und die Indische Bundesregierung, wohin er schrieb. Also wieder warten. Aus dem Iran waren wir ja schon daran gewöhnt, es war aber dennoch nicht leichter zu ertragen.
Am Sonntag, 8. Juni, gingen wir zum Gottesdienst in die anglikanische Kirche. Wir besuchten den Erzdiakon, der Father prompt einlud, im folgenden Gottesdienst zu predigen. Im Anschluss lernten wir die Kinder von Herrn Joshua-Fazluddin, dem Stellvertretenden Justizminister der pakistanischen Provinz Punjab, kennen. Frau Dr. Joshua, seine Frau, eine Ärztin, kam aus Travancore, der Heimat von Father Abraham. Sie luden uns für den folgenden Sonntag zum Abendessen ein.
Schon beim Eintreffen in der anglikanischen Kirche war mir eine junge Frau aufgefallen: Inmitten der bunten Vielfalt der weiblichen Kleidung stach sie hervor wie eine Lichtgestalt: im weißen Punjabi-Kleid – dem Salvar Kamiz – mit einem schönen ovalen Gesicht, umringt von dunklen Haaren und mit leuchtenden dunklen Augen. Sie strahlte geradezu von innen heraus. Später sollte ich erfahren, dass sie Jane war, die älteste Tochter der Joshuas.
Eine Woche später folgten wir der Einladung der Joshuas, als ihre Gäste bei ihnen zu wohnen. Wir nahmen diese Einladung gerne an. Wie wir lernten, war Herr Joshua der einzige Christ in der Regierung der Provinz Punjab. Er war ein Experte in Punjabi, der Sprache der Provinz, und hatte mehrere Bücher in dieser seiner Muttersprache geschrieben. Frau Dr. Joshua unterrichtete in einer Medical School zur Ausbildung von Krankenschwestern. Ihre älteste Tochter Jane, dreiundzwanzig Jahre alt, wollte ihre Ausbildung als Ärztin („M.B.B.S.“) innerhalb eines Jahres abschließen. Die zweite Tochter Mariamm (Spitzname: „Riffeth“) studierte Mathematik am College. Der älteste Sohn „Raju“ studierte mit dem Ziel Bachelor of Arts (B.A.). Sein sechzehnjähriger Bruder „Sam“, sehr klug für sein Alter, studierte für seinen Bachelor of Arts in Volkswirtschaftslehre. Dann kam der vierzehnjährige „Kaka“, Schüler in der Secondary School (Gymnasium). Seine Schwester „Baby“ besuchte die Klosterschule für Mädchen. „Sonny“ Emanuel war der Jüngste, voller Streiche den ganzen Tag: Er besuchte den YMCA-Kindergarten.
Diese Familie sollte unser Zuhause für die nächsten Wochen werden. In Erinnerung geblieben sind mir vor allem die Diskussionen beim Mittagstisch und beim Abendessen. Wir tauschten uns aus über das Leben in Europa und in Pakistan, über die Rolle der Jugend, ihre Freiheiten und Sorgen. Offenbar machten vor allem Jane und Mariamm einen großen Eindruck auf mich. Am besten greife ich auf den Eintrag in meinem Tagebuch zurück: „Ich war sehr beeindruckt von der lieblichen Würde von Jane und Mariamm. Ich weiß nicht, ob ich zwei wie sie in unserer Stadt Baden finden könnte. Jane wird eine erstklassige Ärztin im kommenden Jahr. Und als Tochter eines Stellvertretenden Ministers könnte sie ein leichtes Leben führen. Aber sie – und Mariamm – arbeiten zu Hause, waschen ihre eigenen Kleider und helfen mit, das Essen für die Familie vorzubereiten. Ich bin sicher, dass ihre zukünftigen Männer sehr glücklich mit ihnen sein werden.“
Der Motor unseres Volkswagens machte mir Kummer. Ein örtlicher Mechaniker hatte ihn ausgebaut. Seine Diagnose: Die Kolbenringe hatten ihre Elastizität verloren und die Ventile mussten nachgeschliffen werden. Die Suche nach Kolbenringen brachte in Lahore keinen Erfolg. Sie mussten von Mian Brothers aus Karachi angeliefert werden.
Zudem waren die Einfuhrerlaubnis und die Zollbefreiung noch immer nicht in Lahore eingetroffen. Der High Commissioner schickte mehrere Telegramme nach Delhi. Die stereotype Antwort, wiederholt gegeben: „Case considered“ – „Ihr Fall ist in Überprüfung!“ Zudem sollte das Büro des High Commissioners am 10. Juli 1958 wegen der eingefrorenen Beziehungen zwischen Indien und Pakistan geschlossen werden – eine Hiobsbotschaft für uns. Dann konnte sich niemand mehr um unser Anliegen kümmern und wir standen verloren da: Den Wagen würden wir so nicht nach Indien mitnehmen können.
In dieser Situation empfahl mir der Stellvertretende High Commissioner: „Fahren Sie selbst nach Delhi, um die Papiere vom Revenue Board zu erhalten. Als österreichischer Staatsbürger haben Sie keine Probleme, die Grenze zu überschreiten und wieder nach Pakistan zurückzukommen – im Gegensatz zu Father Abraham. Er kann natürlich jederzeit nach Indien, in sein Heimatland, einreisen. Aber er wird kein weiteres Visum für Pakistan erhalten!“
Father stimmte diesem Vorschlag sofort zu. Offensichtlich traute er mir, dem Neunzehnjährigen, mehr zu, als ich mir selbst zugetraut hatte. Mit Behörden hatte ich allenfalls eher deprimierende Erfahrungen während der Reise selbst gemacht. Ich willigte aber sofort ein: Es wird schon gelingen, wenn man fest daran glaubt, sagte ich mir. Der Stellvertretende High Commissioner gab mir einen Brief als Einführung beim Sekretär des Revenue Board und ein weiteres Schreiben „To whom it may concern!“. Father Abraham wiederum diktierte einen Brief an Herrn Lal Advani, den Assistant Educational Officer im Bildungsministerium: Lal Advani war selbst blind. Des Weiteren ein Schreiben an Herrn M.O. Mathai, Special Assistant to the Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru.
Ich fuhr mit dem Zug zunächst nach Amritsar. Um 15 Uhr verließ der Zug Amritsar, um am nächsten Morgen in Delhi anzukommen. Die ganze Nacht schlief ich auf einer Bank. Später sollte ich in indischen Zügen noch oft auf Bänken oder auf den Gepäckablagen über den Sitzen schlafen. Und dies in der dritten Klasse – ein Erlebnis fürs Leben. Von der Geburt bis zum Tod spielte sich fast alles im Zug ab. Neben Handgepäck brachten die Reisenden auch Tiere mit. Man kann sich dieses bunte Treiben kaum vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat.
Nun zwingt einen niemand, in Waggons dritter Klasse zu reisen. Ich sollte später auf langen Strecken auch klimatisierte Waggons der zweiten Klasse kennenlernen. Diese, und erst recht die Wagen der ersten Klasse, brauchen den Vergleich mit europäischen Zügen nicht zu scheuen.
Am Montag, dem 7. Juli 1959, nahm ich eine der berühmten Roller-Rikschas – ein dreirädriges Fahrrad mit überdachtem Rücksitz und Platz für zwei Personen – zur Wohnung von K. T. Varghese. Aus Travancore kommend und Christ, hatte er Father Abraham in Indien begleitet, bevor dieser das Land in Richtung USA zum Studium verlassen hatte. Er hatte im Holy Family Hospital gearbeitet, seinen Job jedoch im Februar 1958 verloren. Seither hatte er keinen „richtigen Job“, wie er sagte, arbeitete aber im Ashoka Hotel. Er teilte sich mit drei anderen jungen Männern eine Unterkunft.
Varghese zeigte mir das Holy Family Hospital, ein großes, imposantes Gebäude. Schon am Nachmittag fuhren wir zum Bildungsministerium beim Connaught Circus, um Herrn Lal Advani zu treffen. Er erinnerte sich sehr gut an Father Abraham. Er beauftragte seinen Mitarbeiter Herrn Bhan, für uns einen Termin beim Revenue Board zu machen – für den 9. Juli um 11 Uhr. Herr Bhan hatte in Erfahrung gebracht, dass unser Antrag schon einmal abgelehnt worden war. Er zeigte wenig Optimismus über unsere Chancen für einen positiven Bescheid. Dennoch sandte ich am Abend ein Telegramm an Father: „Met Pappachen: Contacted Advani. Revenue Board appointment fixed. Greetings, Martin.“ Gleichzeitig schickte ich ihm einen umfangreichen Bericht per Aerogramm.
Am 9. Juli war das Interview bei Herrn Rangaswamy, Sekretär des Central Board of Revenue, einem Südinder. Er war mit unserem Fall bestens vertraut, hegte aber wenig Hoffnung für eine Zollbefreiung: „Sie müssen die Einfuhrgenehmigung vom Chief Controller of Imports bekommen!“ Der zuständige Beamte stand nicht zur Verfügung, aber der Reception Officer wollte unseren Antrag suchen. Nach einiger Zeit fand er ihn auch.
Und siehe da: Die Einfuhrgenehmigung für Father Abrahams Auto war bereits vor einiger Zeit per Luftpost an die Indische Botschaft in Teheran geschickt worden. „Aber es wurde kein Antrag für die anderen Ausrüstungsgegenstände eingereicht. Diese brauchen Sie aber“, sagte der Beamte.
Also zurück zu Herrn Rangaswamy, um herauszufinden, ob unsere entsprechenden Anträge in einer anderen Abteilung des Central Revenue Board gelandet waren. Er wiederum schickte mich zurück zum Büro des Chief Controller of Imports. Also noch eine Runde.
In meiner Enttäuschung wollte ich ein Telegramm nach Teheran schicken, um unsere Einfuhrbescheinigung umzuleiten. Dann aber intervenierte Fortuna, die Göttin des Glücks: Ich erhielt ein Interview mit dem Personal Secretary des CCO. Er zeigte Interesse und rief Lt. Col. Dharampal Singh an, einen früheren Offizier, der jetzt offensichtlich für Einfuhren zuständig war. Herr Singh stellte mir einige Fragen, denen ich entnahm, dass er sich tatsächlich für unseren Fall interessierte. Ergebnis: „Herr Pfaff, schreiben Sie einen neuen Antrag für die Ausrüstungsgegenstände zur Verwendung in der Blindenschule, die Father Abraham und Sie gründen wollen! Ich werde Ihnen hierfür Importgenehmigungen besorgen. Und für die Einfuhrgenehmigung für das Auto bekommen Sie von mir ein Duplikat. Kommen Sie morgen wieder. Dann ist alles zum Abholen bereit!“ Ich war sehr glücklich, sagte mir aber: Es bleibt eine harte Nuss! Die Entscheidung des Central Board of Revenue über unseren Antrag auf Zollbefreiung sollte morgen fallen. Ich musste mir eingestehen, dass ich nicht sehr optimistisch war.
Zunächst jedoch zurück zu Herrn Lal Advani, um ihn über die neueren Entwicklungen zu informieren. Danach holten wir das Duplikat ab: „Die anderen Genehmigungen werden erst morgen oder übermorgen fertig. Kommen Sie bitte wieder!“
Dann das entscheidende Gespräch mit Herrn Rangaswamy: „Herr Pfaff, das Central Board of Revenue hat Ihren Fall in Erwägung gezogen! Es tut mir aber leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass eine Zollbefreiung abgelehnt wurde!“
„Was kann ich tun, um einen positiven Bescheid zu bekommen?“
„Herr Pfaff, zwei Mitglieder des Central Board of Revenue waren mit Ihrem Antrag befasst. Und sie haben ihn abgelehnt. Es bleiben Ihnen zwei Optionen: Entweder Sie bezahlen den Zoll selbst – oder eine indische Blindenschule, das Bildungsministerium oder eine wohltätige Organisation übernehmen das Auto und zahlen den fälligen Zoll.“
„Herr Rangaswamy, wurde die Möglichkeit eines reduzierten Zollbetrages ebenfalls erwogen?“
„Ja, aber auch diese Alternative wurde abgelehnt. Sorry!“
„Und wäre es möglich“, fragte ich weiter, „das Auto nur temporär nach Indien einzuführen? Falls Father Abraham in dieser Zeit keine Zollbefreiung erhalten würde, könnten wir den Wagen wieder exportieren.“
„Herr Pfaff, die weitere Möglichkeit besteht darin, sechstausend Rupien beim Zollamt in Amritsar zu deponieren und ins Land einzureisen. Falls Sie den Wagen innerhalb von drei Monaten wieder aus dem Land bringen, sollten Ihnen sieben Achtel des deponierten Betrages rückerstattet werden!“
Mir war klar, dass wir 750 Rupien verlieren würden, falls die Zollbefreiung weiterhin abgelehnt würde: „Danke, Herr Rangaswamy, Sie werden verstehen, dass ich über diese Option mit Father Abraham Rücksprache halten muss! Ich werde Sie über das Ergebnis informieren.“
Zurück zu Herrn Lal Advani: „Herr Pfaff, Herr Dr. Bhan wird um einen Termin beim Bildungsministerium für Sie ansuchen, damit Sie Ihr Anliegen selbst vortragen können!“
Mir wurde klar, dass Dr. Bhan nicht an den Erfolg dieser Initiative glaubte. Auch Herr Lal Advani kam zum selben Ergebnis: „Versuchen Sie selbst einen Termin für ein Gespräch im Bildungsministerium zu bekommen!“ Und Dr. Bhan fügte hinzu: „Versuchen Sie doch einen Wohltäter zu finden, der bereit ist, den Zoll für Sie zu zahlen! Danach können Sie noch immer beim Bildungsministerium in Kerala einen Zuschuss beantragen und damit dem Wohltäter den vorgestreckten Betrag zurückerstatten!“
„Ich danke Ihnen, ich werde es mit Father Abraham besprechen!“, sagte ich artig, wohl wissend, dass er auch nicht weiter wusste.
Herr Lal Advani sagte dann: „Ich kann noch einen Weg vorschlagen, nämlich über einen der Sekretäre des Premierministers Pandit Jawaharlal Nehru. Sind Sie damit einverstanden?“
„Natürlich, ich bin Ihnen sogar dankbar für dieses Angebot!“
Leider gelang es ihm aber nicht, einen dieser Sekretäre zu erreichen. Da die Bürozeit zu Ende ging, verließ er sein Büro. Ich gab mich dennoch nicht geschlagen: Von einem Nachbarbüro aus versuchte ich wieder und wieder, Herrn M. O. Mathai zu erreichen. Schließlich kam er ans Telefon. Ich bat ihn um eine Gelegenheit, ihm das Schreiben des Stellvertretenden High Commissioners in Pakistan persönlich überreichen zu dürfen. „Kommen Sie am 11. Juli um 9 Uhr 30 in das Büro des Premierministers!“
Eine Stunde verbrachte ich an diesem 11. Juli bei Herrn M. O. Mathai, dem Special Assistant to the Prime Minister. Er stellte mir eine Reihe von Fragen über Fathers Pläne zur Gründung einer Blindenschule in Südindien und meine Bemühungen in Delhi. Und er schmunzelte, als ich ihm von meinen Wanderungen zwischen den diversen Behörden erzählte: „Herr Pfaff, Sie müssen wissen, dass es keinen Präzedenzfall gibt für einen positiven Bescheid zu Ihrem Anliegen. Wenn man Ihnen eine Zollbefreiung für Auto und Ausrüstung gäbe, müsste diese allen anderen Bildungseinrichtungen ebenfalls gewährt werden.“ Dann erzählte er mir, dass er unseren ersten Brief erhalten und dem Premierminister vorgelegt habe. „Dies hat zur Gewährung der Einfuhrerlaubnis geführt. Bezüglich der Zollbefreiung werde ich Ihren Fall wiederum dem Premierminister vorlegen. Kommen Sie bitte morgen wieder. Dann kann ich Ihnen hierzu einen Bescheid geben.“
Dann besuchte ich das Tourist Office: Ich sollte die Erlaubnis für die Einreise nach Kaschmir von Herrn T. S. Sahni vom Verteidigungsministerium bekommen.
Zurück beim Innenministerium: Herr Damodaran wollte mir kein Wiedereinreisevisum nach Indien bei einem längeren Aufenthalt in Pakistan geben. Er befahl seinem Assistenten, meine Akte herbeizuschaffen. In ihr befanden sich all meine Anträge für Visa, einschließlich des Antrags auf Verlängerung um ein Jahr. „Herr Pfaff, wir haben Ihnen schon eine Verlängerung um ein Jahr genehmigt und die Regierung von Kerala informiert, Ihnen eine solche Verlängerung nach Ihrer Ankunft in Kerala zu gewähren.“
Dann machte ich einen erneuten Vorstoß um ein indisches Wiedereinreisevisum bei einem längeren Aufenthalt in Pakistan: „Father Abraham muss an einem dieser Tage in Lahore ins Krankenhaus. Und es könnte länger als vierzehn Tage dauern, bevor er wieder reisen kann!“ Da erteilte er schließlich seine Zustimmung zur Verlängerung bei einem Aufenthalt in Pakistan von bis zu einem Monat.
Am Samstag, 12. Juli, kam es zum entscheidenden Besuch bei Herrn M. O. Mathai: „Der Premierminister hat Ihre Petition gesehen und ein Empfehlungsschreiben an das Central Board of Revenue geschickt. Falls dieses erneut seine Zustimmung zur Zollbefreiung verweigert, gibt es keine weitere Möglichkeit für Anträge!“ Und Herr Mathai fügte hinzu: „Das nächste Mal soll Father Abraham durch die korrekten Kanäle gehen, wenn er wieder aus dem Ausland zurückkehrt, wo er verschiedene Einfuhrgüter gesammelt hat! Der Premier Minister hat andere Sorgen!“ Ich stimmte allen Aussagen zu und dankte ihm für seine Bemühungen. Ich bat ihn auch, dem Premier für seine Unterstützung zu danken: „Herr Mathai, darf ich dem Premierminister persönlich danken?“
„Im Augenblick geht das nicht. Aber kommen Sie morgen früh zu seiner Residenz!“ Dies tat ich allerdings nicht, denn ich war zur Einsicht gekommen, dass der Mann wahrlich andere Sorgen haben musste, als meine Dankesworte persönlich entgegenzunehmen! Außerdem wollte ich schnellstmöglich nach Lahore zurück. Jahre später sollte ich dem Premierminister persönlich ein Geschenk übergeben: einen von den blinden Kindern der Schule gefertigten Teller.
Unterwegs in der Stadt sah ich in der Nähe des Roten Forts die Statue eines modernen indischen Helden: Netaji Subhas Chandra Bose, Kämpfer für Indiens Freiheit. Weder wusste ich damals genau, wer er war, noch was er alles im Freiheitskampf gegen die Engländer getan hatte. Und schon gar keine Ahnung hatte ich, dass ich wenige Jahre später seine einzige Tochter heiraten würde.
Am Montag, 14. Juli, war der „Tag des Wunders“: Nach einem Telefongespräch mit Herrn Barman ging ich um 16 Uhr in sein Büro. Statt einer formellen Begrüßung seine freudestrahlend vorgetragenen Worte: „Ihre Zollbefreiungen sind genehmigt worden. Ich gratuliere!“ Dann fügte er hinzu: „Bei seiner Ankunft in Indien muss Father Abraham eine schriftliche Verpflichtung eingehen, dass er bald eine Blindenschule eröffnen will und dass das Auto und die Ausrüstungsgegenstände für die Arbeit der Schule verwendet werden!“
Ich dankte ihm aus ganzen Herzen für seinen Rat. Mit einem Hochgefühl eilte ich zum nächsten Postamt und schickte folgendes Telegramm an Father: „Hamdulillah. Mission successfully finished. Reaching Wednesday. Martin.“ („Gott sei gelobt. Die Mission erfolgreich beendet. Komme am Mittwoch. Martin.”)
In mein Tagebuch schrieb ich: „Der Mann, der uns erst in die Lage brachte, die Ausnahmegenehmigungen zu erhalten, ist Pandit Nehru, der Premierminister: Er schrieb das Empfehlungsschreiben an das Central Board of Revenue. Nachdem Father und ich von Lahore zurückkehren, will ich versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen.“
Freunde begleiteten mich zum Bahnhof. Der Zug kam mit einer zweistündigen Verspätung von Bombay (Mumbai) – schwere Monsunregen hatten zu Verzögerungen geführt. Erst nach Mitternacht ging es von Delhi los. Ich schlief den Schlaf des Gerechten – oder zumindest des Glücklichen! – auf der harten Holzbank in einem Waggon der zweiten Klasse.
Vom Bahnhof Lahore machte ich mich auf den Weg zum Haus der Joshuas. Alle waren hoch erfreut. Am glücklichsten jedoch schien der kleine Sonny über das mitgebrachte Geschenk. Und am meisten erstaunt über den erfolgreichen Abschluss meiner Reise war Herr Joshua: Als erfahrener Minister kannte er die bürokratischen Hürden am besten. Dass der Premierminister Indiens persönlich interveniert hatte – bei der Einfuhrgenehmigung und auch bei der Zollbefreiung –, beeindruckte ihn besonders. Die anerkennenden Blicke von Jane, Mariamm, John und Sam gefielen mir natürlich am besten. Später erfuhren wir vom Chef der Zollbehörde in Amritsar: „Noch nie gab es einen Fall wie Ihren! Das Indische Rote Kreuz zum Beispiel hatte Zollbefreiung für Gerätschaften beantragt, die in einem Lepra-Asyl verwendet werden sollten. Abgelehnt! Sie können sich glücklich schätzen!“ Das waren wir auch.
Später berichtete ich meinen Eltern und Brüdern: „In meinem letzten Schreiben habe ich euch über das wundersame Eingreifen des indischen Premiers Nehru in unsere Sorgen und Nöte berichtet, gleichsam als deus ex machina … Father Abraham hat eine Einfuhrgenehmigung erhalten, obwohl Indien alle Importe gestoppt hat, und eine Zollermäßigung von 6000 Rupien für den VW und 1000 Rupien für die anderen Geräte (Blindenschreibmaschine, Blindengrammofon, Tonbandgerät und Radio), also insgesamt Ö.S. 41.000! Keine Kleinigkeit. Und ich bin auch ein wenig stolz, denn ich bin für mehr als eine Woche von einem Regierungsbüro ins andere gerast, von einem Ministerium zum anderen. Am Ende hatte ich diese Genehmigungen in Händen, auf die wir monatelang vergeblich gewartet hatten.“
Zu den Höhepunkten unseres eineinhalbmonatigen Aufenthalts als Gäste der Joshuas zählten die Mittag- und Abendessen: Gesprochen wurde dabei nicht nur über die Tagesereignisse, sondern über Gott und die Welt.
Immer öfter führte dies zu Dialogen quer über den Tisch hinweg, zwischen Jane und mir: Wir sprachen über Religion, Geschichte und das Leben im Westen. Oder über Ausländer, die in Pakistan tätig waren. Einmal streifte das Gespräch Europäer, die Frauen aus Pakistan geheiratet hatten: „Ich glaube nicht“, sagte ich, „dass dies gut gehen kann, sind doch die kulturellen Hintergründe viel zu groß!“
Jane widersprach heftig: „Es hängt von den beiden ab, ob sie trotz der Unterschiede ihr Leben meistern wollen – wenn ja, dann kann es sicher auch sehr gut gehen!“ Wir sprachen und sprachen und sprachen. Und die anderen hörten uns aufmerksam zu.
Father Abraham schien die Entwicklung nicht zu gefallen. Am 19. Juli 1958 schrieb ich in mein Tagebuch: „Am Abend hatte ich Streit mit Father, der versucht hatte, zwischen Jane und mich zu kommen, als wir uns unterhielten.“ Und am 22. Juli 1958: „Jane hatte Streit mit Father. Sie protestierte gegen die Art, in der Father über die Gefühle, die [Jane und ich] einander entgegenbrachten, zu Mariamm gesprochen hatte. Mariamm hatte alles ihrer Mutter erzählt!“
Mir war bewusst, dass meine Gefühle für Jane immer aufgewühlter wurden. Aber ich wusste nicht, was daraus folgen sollte: Hier war ich, neunzehn Jahre alt, ohne mit dem Studium begonnen zu haben, ohne gesicherte Existenz. Jane war dreiundzwanzig Jahre alt, ein Jahr vor dem Erlangen ihres Doktordiploms. Welche Zukunft konnten wir haben? Ich war viel zu scheu, um mit Jane darüber zu sprechen. Aber ich war zutiefst unglücklich, weil der Tag der Weiterreise unmittelbar bevorstand. Was sollte ich also tun? Meine Antwort an mich selbst: „Du kannst gar nichts tun, außer dich so zu verhalten, dass du Jane nicht in eine peinliche Lage bringst! Und dass du dich so ehrenvoll gegenüber Janes Eltern verhältst, wie sie es als Gastgeber verdienen. Also – nicht einmal ein Gespräch über deine Gefühle für sie!“
Daran hielt ich mich, obwohl es mich zu zerreißen drohte. Eingeschlossen im Badezimmer, rollten Tränen der Ohnmacht meine Wangen herab.
Die einzige Handlung, die ich mir gestattete: Ich bat Jane in den Garten, um ein Foto von ihr zu machen. Sie willigte sofort ein. Bei diesem Anlass sagte sie mir: „In einem Jahr werde ich mein Medizinstudium beenden. Dann komme ich nach Südindien, um meine Verwandten zu besuchen.“ Wollte sie mir damit etwas sagen? Ich sollte weder Jane noch die anderen Mitglieder der Familie Joshua jemals vergessen.
Sechsundvierzig Jahre später fand ich über den Botschafter Pakistans in Berlin die Adresse der Joshua-Kinder heraus. Meine Überraschung war groß, als er mir beim Abendessen, zu dem er mich mit einigen anderen deutschen Parlamentariern eingeladen hatte, über die Joshuas erzählte: „Aber ja! Ich kenne vor allem Sam Joshua – er war Botschafter Pakistans! Sein Bruder John war Offizier bei der pakistanischen Armee. Ich schicke Ihnen die Adresse, sobald ich sie ausfindig gemacht habe!“ Meine Überraschung wurde noch größer, als ich erfuhr, dass die Joshua-Kinder ausgewandert waren: Sam nach Kanada und die anderen in die USA. Jane hatte Vivian, den Sohn des Erzdiakons, geheiratet. Sie waren beide als Ärzte über Kanada in die Vereinigten Staaten ausgewandert und arbeiteten in Grand Rapids im Staate Michigan – also nicht weit von Lansing und Detroit entfernt, wo meine Frau Anita und ich an den Universitäten unterrichten sollten. Wir besuchten sie in ihrem neuen Domizil.
Meine Spannung war groß, als wir vor ihrem schönen Haus mit dem gepflegten Garten in Grand Rapids standen: Hätte ich sie nach all den Jahren auf der Straße wiedererkannt? Die ehrliche Antwort lautete: „Nein!“ Im Haus warteten Mitglieder der Joshua-Familie und zahlreiche Gäste, auch Inder, die wohl mehr an Anita als an mir interessiert waren. Nach einer anfänglichen Scheu tauschten wir Erinnerungen aus, vor allem Vivian und ich. Ich hatte Abzüge von Fotos mitgebracht, die ich damals in Pakistan gemacht hatte. Ich setzte mich auf das Polster am Kaminsims. Jane gesellte sich zu mir. Unsere Augen lachten sich an, in Erinnerung an die Tage in Lahore.
Am liebsten hätte ich gesagt: „Ich habe dich nie vergessen!“ Jane lächelte nur ironisch und sagte nach einiger Zeit: „Wir haben das Gästezimmer für dich und deine Frau vorbereitet. Ihr hättet nicht ins Motel gehen sollen. Warum habt ihr das getan?“
„Weil ich zu scheu war, nach so vielen Jahren“, würgte ich heraus.
Sie lachte: „Komm, ich zeige dir das Gästezimmer im ersten Stock! Dann weißt du, wo ihr das nächste Mal wohnen werdet!“ Sie stand auf und begann – trotz ihrer Knieprobleme –, entschlossen die Treppe hinaufzusteigen. Ich rief Anita zu: „Komm, Jane will uns das Gästezimmer zeigen!“ Und ich wartete, bis Anita sich zu mir gesellte. Dann folgten wir ihr gemeinsam. Weder hatte ich Jane vergessen, noch war ich ganz locker in ihrer Anwesenheit. Ob sie mir nach all den Jahren gleichgültig geworden war? Mein Verhalten schien das nicht zu belegen.
Aber zurück nach Lahore: Am Donnerstag, 24. Juli 1958, war es so weit, Father Abraham und ich verabschiedeten uns von den Joshuas. Bei ihnen fühlte ich mich ganz zu Hause, fast wie bei meiner eigenen Familie. Ich hatte Tränen in den Augen, als wir unser Auto bestiegen und aus dem Tor hinausfuhren.
Die pakistanischen Behörden machten an der Grenze keinerlei Schwierigkeiten, Herr Joshua hatte den verantwortlichen Offizier vorab telefonisch informiert. Auf der indischen Seite begleitete uns ein Zollbeamter von der Grenzstation bis zu den Zollbehörden in Amritsar. Father musste eine schriftliche Zusage unterschreiben, dass das Auto plus Ausrüstungsgegenstände für die zu gründende Blindenschule verwendet werden würden. Zudem durfte das Auto zumindest für die nächsten drei Jahre nicht verkauft werden.
Aus heutiger Sicht frage ich mich: „Wäre ein Vorgehen ähnlicher Art in Deutschland wie in Indien denkbar?“ Wohl kaum! Erstens wäre ich über die Zollbehörde, höchstens über das zuständige Ministerium, nicht hinausgekommen. Und unsere Schreiben hätten den Bundeskanzler nicht erreicht. Und wenn doch, hätte er keine Ausnahme von den Regeln machen können. Die schwerfällige pakistanische und indische Bürokratie wurde offensichtlich durch ein Maß an Menschlichkeit ergänzt, das die vielfältigen Hemmnisse moderierte. Unsere lange Odyssee führte zum vorläufigen Höhepunkt: Nach monatelangem Warten in Iran und in Pakistan waren wir gemeinsam in Indien angekommen.
Ich hatte viel gelernt über fremde Länder und alte Kulturen. Auch über die verschlungenen Pfade der Bürokratie. Aber von Father Abraham lernte ich noch viel mehr: ein sehr viel besseres Englisch und Wissen über die Strukturen der organisierten Religionen, über Eigenheiten von Regierungen, über Bürokratie und wie man mit ihr zurechtkommen kann. Über Indien und seine Sitten und Gebräuche. Über die Art, wie man in der Gesellschaft agieren konnte. Über die Kunst der Rede und die Macht der Worte.
Dies alles war wie ein „Praktikum des Lebens‘“, weil ich vieles lernte, was mir in meinem Elternhaus, im Kloster oder im Gymnasium gar nicht vermittelt werden konnte. Und der Lehrer saß fast die ganze Zeit neben mir und beantwortete geduldig meine Fragen. Er tat dies wohl nicht ungern, denn so verstrich die Zeit während der langen Autofahrten auch für ihn viel schneller.
Dennoch meldeten sich die Fragen wieder, die ich bei meiner Abreise aus Österreich meinem Schutzgeist gestellt hatte. Und ich setzte meinen Dialog mit ihm fort: „Genius, habe ich nicht im vergangenen Jahr viele beeindruckende Erlebnisse gehabt? Etliche Abenteuer gut überstanden? Viel über Land und Leute gelernt? Hätte meine Maturafahrt großartiger sein können?“
Seine Antwort: „Ja, sicher trifft dies alles zu. Noch mehr jedoch haben die Herausforderungen der Reise dir eine Gelegenheit geliefert, deine eigenen Kräfte zu testen und deine Ängste zu überwinden. Das alles ist schön und gut. Aber es beantwortet nicht die Fragen, auf die du bei dieser Reise eine Antwort suchen und finden wolltest! Muss ich dich an diese erinnern?“
„Nein, nein! Du hast ja recht! Aber ich habe bereits wichtige Erkenntnisse gewonnen: Zum Beispiel, dass es neben dem Christentum, dessen Spuren ich in vielen Formen in Griechenland, aber auch in der Türkei, sogar in Syrien und Ägypten, sehen konnte, auch andere bedeutende Religionen gibt. So hat mich der Islam sehr beeindruckt, weil er gerade für einen denkenden Menschen viele positive Antworten liefert. Oder auch die Lehre Zarathustras über die Verantwortung jedes einzelnen Menschen im Kampf gegen das Böse in der Welt. In beiden Religionen habe ich verblüffende Parallelen zur christlichen Botschaft feststellen können!“
„Weißt du nun eine Antwort auf deine zentrale Frage: Welche Religion schafft den besten Menschen?“
„Nein, Genius, dafür habe ich noch keine abschließende Antwort gefunden! Allerdings habe ich in den islamisch geprägten Ländern Menschen getroffen, deren Verhalten jedem Christen zur Ehre gereichen würde. Und unter den Hindus, die ich auf der Reise traf, solche, für die dies genauso zutreffen würde.“
„Ist deine Suche damit beendet?“
„Aber nein! Ich habe die bedeutendsten Religionen Indiens noch gar nicht näher kennengelernt! Gib mir mehr Zeit!“
„Gut! Ich melde mich wieder! Verlass dich darauf!“