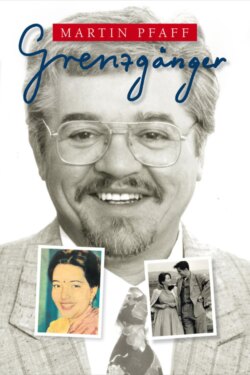Читать книгу Grenzgänger - Martin Pfaff - Страница 7
1. Die erste Grenze: Ausbruch und Aufbruch
ОглавлениеDer Wind spielt mit den Wolken wie ein Kätzchen mit Wollknäueln. Bald schiebt er sie weiter, bald reißt er Öffnungen auf, durch die der Mond das Feld vor uns beleuchtet wie eine Bühne: Die Maispflanzen werfen dunkle Schatten auf den Acker, wechselnde Muster. Einmal fahl, einmal hell beleuchtet. Dann wieder wird es dunkel. Es ist kühl.
„Du musst ganz still sein: kein Reden, kein Husten, keinen Laut! Die Grenzwachen können jederzeit kommen!“ Mein Vater flüstert mir eindringlich zu. Wenn der Mond wieder sein Licht auf das Maisfeld wirft, kann ich die Anspannung in seinem Gesicht sehen. Sie überträgt sich auf mich.
Durch die dichten Maispflanzen können wir den Weg vor uns gerade noch sehen: zwei hellere Bänder, von den Kufen der Ochsenkarren geformt, dazwischen Gras. „Hier kommen die Grenzer auf ihrer Patrouille regelmäßig vorbei. Manchmal sogar mit Hunden. Aber das ist eher selten. Denn sie erwarten nicht, dass sich jemand über diese Grenze traut!“ Auch wenn ich es meinem Vater nicht zeigen will: Ich habe Angst.
Wir liegen jetzt schon bald eine halbe Stunde auf dem Ackerboden. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Neben dem Rascheln des Windes in den Maisblättern dringt der Geruch der Erde in mein Bewusstsein.
Meine Gedanken schweifen zurück zu den Ereignissen der letzten Tage: Wie mein Vater aus Wien „schwarz“ über die Grenze nach Ungarn kam, um mich – den Siebenjährigen – von unserem Heimatort Tevel gegen Ende meines zweiten Schuljahrs abzuholen. Ich sollte in Wien zur Schule gehen.
Schon vorher, auf dem Weg zur Grenze, waren mein Vater und ich nur knapp einer brenzligen Situation entkommen: In Budapest mussten wir einen Zwischenstopp einlegen. Nach der Kindheitserfahrung in unserem Dorf und im nahe gelegenen Fünfkirchen war Budapest eine überwältigende Erfahrung. Ein Höhepunkt war der Zoo mit seinen exotischen Tieren: So etwas hatte ich noch nie gesehen! Beim Verlassen des Zoos flüsterte mir mein Vater plötzlich eindringlich auf Ungarisch zu: „Red auf Ungarisch weiter! Kein Wort Deutsch!“ Bald war mir klar, warum: Die Polizei kontrollierte die Papiere der Passanten sporadisch. Die einen winkten sie durch, die andern wurden sorgfältig überprüft.
Ich plauderte laut auf Ungarisch, das ich damals fließend sprechen konnte, vor mich hin, über die Tiere und wie niedlich die kleinen Löwenbabys waren. Die Polizisten warfen nur einen kurzen Blick auf uns beide und ließen uns passieren. Ein Glück, dass unsere Volksschule nach Ende des Krieges nur noch in ungarischer Sprache unterrichtete, sodass wir sie recht gut beherrschten. Und dass der strenge Lehrer ein drakonisches Regime führte. Denn wir liebten den Ungarischunterricht nicht. Viel lieber hätten wir auf Deutsch gelernt. Zu Hause bei den Großeltern und im Haus meines Onkels wurde weiterhin ein schwäbischer Dialekt gesprochen, wie schon von vielen Generationen von Einwanderern aus dem deutschen Sprachraum zuvor. Unsere Eltern redeten wir Kinder mit „Vater“ und „Mutter“ an.
Während des Zweiten Weltkriegs gab es Unterricht in deutscher sowie in ungarischer Sprache. Zudem wurde auch gemischter „Deutsch-plus-Ungarisch“-Unterricht gehalten: Der „Probst-Lehrer“ auf Ungarisch, der „Stängli-Lehrer“ gemischt und der „Galosch-Lehrer“ wie die „Olga-Lehrerin“ auf Deutsch. Dieses Arrangement war wohl der damaligen politischen Situation geschuldet.
Die Worte meines Vaters beenden meine Gedankenreise jäh. „Gleich kommen sie!“, flüstert er mir zu. Tatsächlich kann ich Wortfetzen und dazwischen Lachen hören. Bald sind zwei Gestalten in Uniform im Mondlicht zu erkennen. Sie unterhalten sich angeregt, ihre Zigaretten glimmen. Sie kommen auf uns zu. Dann entfernen sie sich. Bald ist nichts mehr von ihnen zu hören.
„Wir müssen noch ein paar Minuten warten, damit sie uns nicht sehen oder hören, wenn wir die Grenze überschreiten.“ Nach einiger Zeit stehen wir auf. Ich strecke meine steifen Glieder, klopfe die trockene Erde von den Kleidern ab und blicke angespannt auf meinen Vater.
„Jetzt geht‘s los! Nicht auf trockene Blätter steigen!“ Als wir den Weg erreichen, blickt mein Vater besorgt nach links und rechts und gibt das Zeichen zum Weitergehen.
Auf der anderen Seite des Weges beginnt ein weiteres Maisfeld. Wie ich später erfahren werde, ist dies eine der Stellen in dem Raum zwischen Pusztasomorja und dem österreichischen Andau, an denen es noch keine Grenzzäune gibt, die ein unerlaubtes Überqueren der Grenze erschweren.
Wir schleichen uns einige hundert Meter weiter durch die Felder. Endlich hellt sich die Miene meines Vaters auf: „Wir haben es geschafft! Wir sind über die Grenze gekommen! Heute Abend sind wir in Wien!“
Mir fällt ein Stein vom Herzen. Meine aufgestaute Neugier drängt sich aber jetzt erst recht heraus: „Vater, warum gibt es diese Grenze? Warum können wir nicht einfach hingehen, wohin wir wollen?“
„Martin, Grenzen hat es immer schon gegeben. Sie zeigen an, wo ein Land aufhört und ein anderes beginnt. Es ist wie bei den Äckern zu Hause: Jeder Bauer muss doch wissen, was ihm gehört und worüber er entscheiden kann, und was dem anderen gehört!“
„Ja, aber da geht es doch nur um Äcker! Menschen dürfen doch auch die Grenzen von einem Acker zum anderen überschreiten und auf den Feldwegen dorthin gehen, wohin sie wollen.“
Er lächelt: „Ja, aber bei Landesgrenzen ist es etwas anderes. Manche Länder – wie hier Ungarn – wollen nicht, dass ihre Einwohner mir nichts, dir nichts in ein anderes Land gehen können.“
„Warum nicht?“
„Weil sie Angst haben, dass die Menschen nicht zurückkommen. Dann haben sie niemanden, der hier arbeiten und leben will.“
„Vater, machen das alle Länder so?“
„Nein, Martin, manche Länder erlauben ihren Bürgern, frei dorthin zu reisen, wohin sie wollen.“
„Ja, aber haben die denn keine Angst, dass die Leute dann nicht wiederkommen?“
„Nein, manche sind klüger. Sie wissen: Wenn die Menschen immer frei aus- und wieder einreisen können, haben sie keinen Grund, ganz wegzugehen …“
Den Gang über diese „erste“ Grenze erlebte ich noch passiv, in Anpassung an die Entscheidungen meines Vaters: Er – nicht ich – wollte, dass ich in Wien zur Schule gehen sollte. Mir selbst überlassen, wäre ich wohl zu dem Entschluss gekommen, in der vertrauten, tristen Umgebung zu bleiben: Trotz allem war Tevel meine erste Heimat. Hier lebten meine Großeltern, meine Brüder, meine Verwandten. Der Weg nach Wien erschien mir als Weg in die Fremde.
Nicht bewusst war mir, dem Siebenjährigen, dass ich meine Außenwelt in dem donauschwäbischen Dorf damals auch als Fremdheit empfand. Das dumpfe Gefühl des Unglücklichseins war zum Dauerzustand geworden. Das Leben erschien mir grau in grau gezeichnet.
Diese Einstellung wurde durch Ereignisse hervorgerufen, über die ich – schon gar nicht als Kind – keinerlei Kontrolle ausüben konnte.