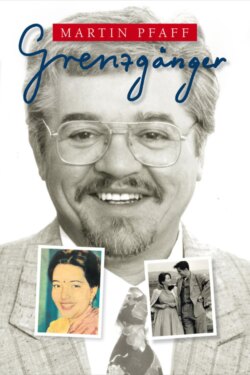Читать книгу Grenzgänger - Martin Pfaff - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Österreich: Die Suche nach dem Selbst
(1947 bis 1957)
ОглавлениеHeute weiß ich, dass Wien zu den schönsten Städten Europas zählt, doch meine Eindrücke vom Wien des Jahres 1947 waren deprimierend. In Budapest war ich ganz aufgeregt gewesen, mit meinem so lange entbehrten Vater die attraktiven Seiten der Stadt zu erleben – den Blick von der Fischerbastei, das Parlament, die Kettenbrücke, den Zoo …
In Wien kamen wir dagegen in den 20. Bezirk, der zur russischen Besatzungszone zählte, in die Karl-Meißl-Straße, eine Zugangsstraße zum Augarten. Bei dessen Eingang befand sich eine dunkelgraue Verteidigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Fassaden der Häuser waren über Jahre vernachlässigt worden, es gab Bombenruinen und Lücken.
Mein Vater war meist längere Zeit abwesend, was meine Stimmung gewaltig drückte. Wien sah ich grau in grau, ähnlich wie die osteuropäischen Hauptstädte, die ich im späteren Leben während der Zeit der kommunistischen Herrschaft besuchte. In Tevel, später auf der Czárda und in Högyész, hatten wir Kinder neben den Pflichtaufgaben viel Freiheit genossen: Wir streiften umher, suchten Taubennester oder verfolgten das Treiben der Vögel.
Im Wien der Nachkriegszeit war an solche Freiheiten für einen Siebenjährigen nicht zu denken – dafür fehlte mir die Erfahrung mit der Großstadt, und dafür machten sich die Erwachsenen viel zu große Sorgen.
Franzi-Tante und Onkluschka hätten liebevoller und aufmerksamer nicht sein können. Franzi-Tante nahm mich zum Einkaufen und zu Besuchen bei Freunden mit. Ihre Familie stammte aus Kärnten, und ihre dunklen Haare, die dunklen Augen und die fein gezeichneten Gesichtszüge ließen ein römisches Erbe vermuten. Ihre kleine, zierliche Gestalt verstärkte diesen Eindruck.
Onkluschka – den Spitznamen gab ich ihm in Anlehnung an seine tschechische Abstammung – war hochgewachsen, mit einem lachenden, freundlichen Gesicht und einer hohen „Denkerstirn“. Er spielte Gitarre und sang dazu. Er war ein guter Zeichner und hat mich inspiriert, Interesse am Zeichnen und Malen sowie an der bildenden Kunst zu entwickeln.
Franzi-Tante und Onkluschka nahmen mich mit auf einen Demonstrationszug, der über den Ring verlief, vorbei am Parlament, am Wiener Rathaus, am Burgtheater … Meine Aufmerksamkeit galt den vielen roten Fahnen: „Onkluschka, wofür stehen die Buchstaben SPÖ auf den Fahnen?“
„Sie stehen für Sozialistische Partei Österreichs – abgekürzt SPÖ!“
„Wofür ist eine solche Partei gut?“
„Die SPÖ ist eine politische Partei, die aus der Arbeiterbewegung hervorgegangen ist. Deshalb hieß sie bis 1934 Sozialdemokratische Arbeiterpartei: Sie will die Ziele dieser Bewegung mit politischen Mitteln durchsetzen. Und sie hat dabei schon vieles erreicht.“
„Welche Ziele?“, fragte ich weiter.
„Die SPÖ will die Gegensätze zwischen Klassen, zwischen Arm und Reich überwinden. Sie will die Arbeit zwischen Männern und Frauen gerecht verteilen. Und sie will auch für eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen kämpfen. Und dabei will sie, dass die Menschen frei leben können!“
Eines Tages fragte ich nach der Bedeutung des 1. Mai und nach dem Wiener Bürgermeister. Onkluschka erzählte mir von der Arbeiterbewegung, dem Kampf gegen die Nazis und von der politischen Entwicklung Österreichs nach dem Krieg. „Eines Tages“, sagte er, „kannst du Bürgermeister von Wien werden – wenn du das nur wirklich willst und dafür zu arbeiten bereit bist!“ Ehrlich gesagt hatte ich kein Interesse daran, Bürgermeister von Wien zu werden. Aber die politischen Umwälzungen, von denen unsere Familie auf so dramatische Weise betroffen war, und die laufenden Ereignisse in Wien hatten mein Interesse geweckt.
Onkluschka wies mir den Weg zur Lektüre der Bücher von Karl May: Sie führten meine Gedanken hin zu fernen Ländern und Abenteuern. Winnetou und Old Shatterhand wurden meine Helden.
Mit der Oma hatte ich relativ wenig Kontakt. Dafür verstand ich mich sehr gut mit Traudl. Sie sollte meine – des Siebenjährigen – „erste Liebe“ sein. Eines Abends sagte ich zu ihr: „Wenn ich groß bin, hole ich dich in meinen Wigwam als meine Squaw!“ Traudl muss es wohl amüsiert haben, sie lächelte nur. Dafür wurde ich rasend vor Eifersucht, wenn ihre Verehrer aufkreuzten, um sie ins Kino einzuladen.
Ein besonderer Glücksfall für mein späteres Leben war ein junger Student. Da ich zwei Klassen Volksschule in ungarischer Sprache absolviert hatte und mein Vater mich in Wien in die 3. Klasse aufnehmen ließ, hatte ich Probleme mit dem Lesen und Schreiben auf Hochdeutsch. Mein schwäbischer Dialekt half mir zwar beim Verstehen, aber das war auch schon alles. Der Student erteilte mir Nachhilfestunden. Dabei ging es nicht nur um Deutsch und Rechnen, sondern auch um andere Fächer. Er beantwortete meine endlosen Fragen nach diesem oder jenem Gegenstand mit Geduld und großer Empathie. Dadurch konnte er mein Interesse am Lernen wecken, das in Ungarn sehr verkümmert war.
Als am Ende des Schuljahres die Zeugnisse verteilt wurden, war ich der beste Schüler meiner Klasse.
Die schulischen Erfolge setzten sich in der 4. Klasse fort. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass ich die Aufnahmeprüfung ins Internat der Schulbrüder in Strebersdorf nördlich von Wien ohne viel Mühe schaffte. Aus diesem „Elite-Gymnasium mit Internat“ waren viele Führungskräfte für Staat und Wirtschaft hervorgegangen. Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich diesen Weg weitergegangen wäre.
Bevor die 1. Klasse Gymnasium begann, hatte mein Vater seine Schmugglertätigkeit beendet. Der Eiserne Vorhang war immer engmaschiger geworden. Es war nicht ungefährlich, bei Nacht durch die Felder zu kriechen oder den mittlerweile tatsächlich vorhandenen Grenzzaun zu überwinden. Einmal wurde mein Vater an der Grenze gefangen genommen, verhört und verprügelt, dann aber wieder freigelassen. Danach wollte er den illegalen Grenzübertritt nicht mehr riskieren.
Er fand Arbeit als Holzfäller in den Wäldern des Stifts Heiligenkreuz, einer Zisterzienserabtei im Herzen des Wienerwalds. Er mietete ein Zimmer in Alland nahe bei Heiligenkreuz. Es war deshalb naheliegend, mich lieber ins Internat des Stiftes Heiligenkreuz zu schicken. Das Stift hatte ein Gymnasium mit vier Klassen und ein angeschlossenes Internat. Unterrichtet wurde durch die Patres des Stifts, geprüft wurde am Ende des jeweiligen Schuljahres durch angereiste Professoren des öffentlichen Gymnasiums Baden bei Wien. So wurde ich ein Zisterzienserschüler.
„Ora et labora!“ - Bete und arbeite! Getreu ihrem Motto strebten die Zisterzienser eine Synthese von Beten und Handeln an. Die Entwicklungsgeschichte Europas, insbesondere auch Österreichs, ist wesentlich durch die zivilisatorische Tätigkeit der Zisterzienser geprägt: die Rodung der Wälder für den Ackerbau und die Pflege des Handwerks. Es verwundert nicht, dass das Stift Heiligenkreuz seit seiner Gründung im Jahr 1133 zu den Besitzern großer Ländereien zählte: Auch heute noch ist das Stift der zweitgrößte kirchliche Grundbesitzer Österreichs. „Armut“ war kein Merkmal des Ordens oder des Stifts Heiligenkreuz.
Meine Jahre im Zisterzienserkloster haben es mir – bei all dem Positiven – eher erschwert, vorgegebene Grenzen zu überwinden. Hierfür musste ich eine persönliche „Revolte“ in Fragen der Religion durchführen. Aber dazu später mehr.
Man kann nicht im Stift Heiligenkreuz leben, ohne von der Aura und dem Ambiente dieses Klosters geprägt zu werden, ohne Augen und Gefühle für die Kunst zu öffnen und ohne für den Rest des Lebens offen zu sein für Fragen der Spiritualität und der Religion.
Wenn man das Stift durch einen der Torbögen betritt, öffnet sich der Blick auf einen großen Hof. Ein weiterer Torbogen führt in den eigentlichen Innenhof mit Zugang zur wunderschönen Stiftskirche, zur Pforte, dem Tor zum Kreuzgang und den Räumen der Patres. Dominiert wird der Hof durch eine Dreifaltigkeitssäule, die Pestsäule, sowie durch große Platanen, die einen runden Brunnen umgeben. Auf zwei Seiten des Hofes verlaufen Wandelgänge, in einer Ecke befindet sich der Zugang zu den Klassenzimmern und zum Studierzimmer. Die Schlafsäle liegen im oberen Stockwerk, über eine Treppe erreichbar, ebenso die Räume mit Bildern und Skulpturen der italienischen Künstler Giuliani und Altomonte.
Die Kirche beeindruckt durch ihre Gegensätze: Hier ein romanisches Langhaus und Querhaus, dort ein hochgotischer Hallenchor. Und dazu die gut erhaltenen Buntglasfenster, durch die bei Sonnenaufgang farbige Muster auf Altar und Kirchenboden gezeichnet werden.
Der Tagesablauf war streng geregelt: sehr zeitig aufstehen, Messe, Frühstück, dann Besuch der Schulstunden, Mittagessen, Studium (das hieß auch: Hausaufgaben erledigen). Am liebsten war uns die freie Zeit, in der wir in einem Hinterhof Fußball spielen konnten. Oder die magischen Augenblicke, wenn uns – im abgedunkelten Raum – Pater Severin Grill Geistergeschichten erzählte.
Kurz vor Weihnachten 1949 wurde ich durch einen unerwarteten Besuch meines Vaters im Stift Heiligenkreuz überrascht. Die Erinnerung an das folgende Erlebnis hat sich tief in mein Gedächtnis eingegraben: Unter dem Vorwand, die Franzi-Tante sei krank, nimmt mich Vater mit nach Wien. In der Karl-Meißl-Straße schickt er mich in einen Laden, um eine Tafel Schokolade für die Tante zu kaufen. Er geht allein voraus.
Ich klingle an der Tür zur Wohnung der Logotkas. Sie wird geöffnet. Vor mir steht eine unbekannte junge Frau: dunkles Haar, dunkle Augen, blass und krank aussehend. Wir blicken uns überrascht an. Ist das nicht … das kann doch nicht …? Mir stockt der Atem. Bevor ich den Gedanken weiterverfolgen kann, schreit sie plötzlich: „Mein Gott! Das ist ja mein Kind!“ An den Augen hat sie mich erkannt. Dann kommen ihr die Tränen. Sie kommt auf mich zu und umarmt mich.
Ich stehe steif da, wie versteinert. Außer Überraschung verspüre ich keine Gefühle – weder Freude, noch Trauer, rein gar nichts. Meine Mutter ist wieder da, aber sie ist eine Fremde geworden. Meine Gefühle gehören der Franzi-Tante als meiner neuen Mutter. Ich kann lange nicht reden.
Schließlich stammle ich: „Ich habe dich mir ganz anders vorgestellt!“ Später sollte ich meine Mutter wieder lieben lernen: Kaum ein Mensch stand mir emotional so nahe – außer meiner Frau und unseren Kindern. Damals jedoch war meine Mutter zutiefst gekränkt und traurig. Jetzt endlich war sie aus Russland zurückgekehrt, hatte nur knapp eine schwere Krankheit überstanden. Sie wollte Liebe geben, und ihr Kind hat diese Liebe nicht angenommen – es wusste nicht, wie!
Mein Vater hat es bereut, dass er meine Mutter und mich ohne jegliche Vorbereitung zusammengeführt hatte. Es sollte eine freudige Überraschung werden, doch die ging gründlich daneben. „Es war von mir sicher keine gute Idee, beide ahnungslos einander gegenüberzustellen“, schrieb er später in seiner Familiengeschichte.
Die Erzählungen meiner Mutter belasteten mich sehr. Nach einiger Zeit konnte ich dies emotional nicht mehr verkraften: „Mutter, bitte erzähl ein anderes Mal weiter! Deine Erzählungen machen mich sehr traurig oder sehr zornig!“
Die Familie findet wieder zusammen
Im Lauf der Jahre erzählte meine Mutter über Ereignisse aus der Zeit der Verschleppung: über die harschen Bedingungen im Lager, über den Hunger, über die schwere Arbeit.
Die Russen machten einige Deutsche, die Russisch verstanden, zu „Adjutanten“ der russischen Lagerleitung, um die tägliche Arbeit einzuteilen, zu koordinieren und zu überwachen. Diese Deutschen hatten über den praktischen Ablauf große Macht: Sie teilten die Menschen in Arbeitsbataillone ein, übersetzten die Anordnungen der Lagerleitung ins Deutsche und interpretierten sie im Lichte ihrer eigenen Interessen.
Einer dieser „Unterkommandanten“ blieb bei den Frauen in schlechter Erinnerung: Irgendwie war es ihm gelungen, seine eigene Frau, wohl aus gesundheitlichen Gründen, nach Hause zurückschicken zu lassen. Fortan betrachtete er die Frauen des Lagers als Freiwild. Er bot ihnen an, sie in leichtere Arbeitsgruppen einzuteilen, wenn sie ihm sexuelle Gefälligkeiten entgegenbrachten. Er hatte einen Blick auf meine Mutter geworfen, aber dabei auf Granit gebissen. Da wurde sie dem Arbeitsbataillon zugeteilt, das die schwerste Arbeit in den Kohlengruben verrichten musste. Dies konnte ihren Stolz nicht brechen, wohl aber ihre Gesundheit nachhaltig beeinflussen.
Die harten Bedingungen des Lagers kosteten fast jeder dritten Gefangenen das Leben.
Im Juli 1950 ging mein Vater schwarz über die Zonengrenze in die DDR, um auch meine beiden Brüder Mathias und Toni sowie seine Eltern nach Österreich zu holen. Sie wurden an der Grenze gefasst: Meine Brüder und meinen Vater ließen sie ziehen, die Großeltern jedoch nicht. Sie mussten zurück in die DDR.
Im März 1953 begann mein Vater beim Stift Heiligenkreuz als Pecher (Harzgewinnung) zu arbeiten. Wir erhielten eine Dienstwohnung im Hajek-Haus im schönen Helenental, unweit von Baden bei Wien. Hier gründeten meine Eltern eine Geflügelfarm. Als diese expandierte, siedelten sie nach Pfaffstätten um, wo meine Eltern ein großes Areal kauften und neue Gebäude und Stallungen bauten.
Meine beiden Brüder besuchten ebenfalls das Gymnasium im Stift Heiligenkreuz. Nach der 4. Klasse wollten sie aber nicht länger in die Schule gehen, sondern im gewachsenen Betrieb der Eltern mitarbeiten.
Mein Vater und vor allem auch meine Mutter haben Enormes geleistet. Obwohl meine Mutter im Lauf der Jahre vier Herzinfarkte und eine komplizierte Gallen- und Venenoperation überstehen musste, arbeitete sie bis zur Erschöpfung, teilte die tägliche Arbeit für die Arbeiter ein, sorgte dafür, dass der Haushalt funktionierte und … und … und. Unsere Eltern waren ein echtes Vorbild für uns Kinder, obwohl wir dies in jungen Jahren vielleicht nicht immer ausreichend gewürdigt haben. Sie gaben uns Bespiele für Motivation, Fleiß und Opferbereitschaft.
Zurück zu meinen Erfahrungen im Stift Heiligenkreuz: Die älteren Schüler – dreizehn und vierzehn Jahre – versuchten uns Neuzugänge – zehn Jahre – zu persönlichen „Sklaven“ zu machen. Sie forderten, dass wir ihre Schuhe putzen und ähnliche Dienstleistungen erbringen sollten. Wenn einer von uns nicht parierte, drohten Prügel. Sie waren dabei nicht zimperlich.
Ich war damals nicht sehr sportlich, doch ich weigerte mich, diesem Druck nachzugeben und schloss mich mit zwei weiteren Schülern zusammen: „Wenn er wieder droht, einen von uns zu verprügeln, müssen die beiden anderen je einen seiner Füße umklammern, sodass er sich nicht mehr bewegen kann! Der Dritte greift ihn von vorne an!“ Gesagt, getan: Fortan ließen uns die „Bullies“ in Ruhe!
Abt Karl Braunstorfer wurde von allen verehrt: Er war asketisch und hager und strahlte eine nach innen gewandte Geistigkeit aus. Er war unser Lateinlehrer. Viel später – im Jahr 2002 – wurde vom Konventkapitel des Stifts Heiligenkreuz ein Antrag auf Beginn eines Verfahrens zur Seligsprechung gestellt und von Kardinal Christoph Schönborn am 15. November 2008 eröffnet.
Pater Prior Elred Pexar, von runder Gestalt, unterrichtete Mathematik. Der Liebling vieler Schüler war Pater Hermann Watzl, der Geschichtslehrer. Unser Zeichen- und Mallehrer war kein Priester sondern ein Laie, Herr Gargela. Zu meinem fünfzigsten Geburtstag machte er mir ein überraschendes Geschenk: Eine Karikatur von ihm, die ich mit dreizehn Jahren gezeichnet hatte. Er hatte sie all die Jahre aufbewahrt.
Auch ich habe einige meiner Arbeiten von damals aufbewahrt: Den Linolschnitt eines Propheten aus dem Alten Testament, den ich anhand einer Skulptur im Chorgestühl gezeichnet hatte. Einen Holzteller mit einem eingebrannten Bild des Stifts Heiligenkreuz. Bleistiftporträts meiner Mutter und meines Vaters. Auch die Illustration für das Logbuch der Pfadfinderpatrouille „Die Uhus“ ist darunter, der ich in Heiligenkreuz angehörte. Mein Interesse an künstlerischer Tätigkeit war groß.
Der Präfekt war Pater Berthold May, sehr fair, aber auch streng. Er arbeitete mit starken Anreizen: Angesichts meiner schulischen Leistungen und der Geschwindigkeit, mit der ich meine Hausaufgaben erledigte, bekam ich frei, während die anderen noch arbeiten oder lernen mussten. So konnte ich einen Karl-May-Band nach dem anderen verschlingen oder im Stiftshof spazieren gehen. Später kamen weitere Privilegien hinzu: Ich durfte ohne Aufsicht die alte Klosterbibliothek nutzen, eine großartige Sammlung von kirchlichen und weltlichen Büchern.
Ab 1950 übernahm Pater Adolf Niemetz die Aufgaben des Präfekten, ab 1952 Pater Alberich Strommer. Ich fragte Pater Hadmar Borowan, ob ich ihm bei den Führungen in der Altomonte- und Giuliani-Ausstellung zur Hand gehen könnte, beispielsweise beim Verkauf der Eintrittskarten an touristische Besucher. Er willigte sofort ein.
Eines Tages sagt er: „Martin, du hast lange genug zugehört. Von heute an machst du die Führungen selbst, verkaufst Eintrittskarten und rechnest einmal pro Woche mit mir ab. Hier ist der Schlüssel!“ Ich war sprachlos ob dieses Vertrauensbeweises. Die Trinkgelder der Besucher waren mir sehr willkommen. Ich kaufte davon meine erste Kamera.
In Erinnerung geblieben sind auch die Patres Paulus Niemetz, Gerhard Hradil und Niwad Hradil und Pater Albert Urban, der Chemie unterrichtete.
Pater Alberich Strommer machte Notizen über mich, die er mir bei einem späteren Besuch zeigte. „Martin Pfaff hat große, fragende Augen. Und oft bleibt ihm vor Staunen der Mund offen. Dann lacht alles! Aber er scheint sehr begabt zu sein!“, schrieb er. Später notierte er: „Martin Pfaff ist vermutlich der intelligenteste, Wenninger vermutlich der fleißigste Schüler … Der [Erst-]Genannte macht von sich reden.“ Und im Mai 1953: „Zum Vielleser Martin Pfaff, der die Bücher nur so verschlingt, sage ich: Timeo virum unis libris – Fürchte den Kenner (nur) eines Buches!“
Meine Neugier, das Fragen nach neuen Erkenntnissen und das Staunen über die Antworten liefern wohl einen Schlüssel zum Verständnis meiner intellektuellen Reise durchs Leben: Ich wurde zum Grenzgänger, weil ich jenseits der etablierten Grenzen entdeckenswerte Erkenntnisse vermutete, über das Neue erstaunt war. Hinzu kam allerdings, dass ich sehr bald das Interesse an dem Entdeckten verlor, weil mich neue Herausforderungen mehr reizten als die Vorstellung, bereits „beackertes Land“ zu pflegen. Dies sollte beispielsweise dazu führen, dass ich als Wissenschaftler das Schreiben von Textbüchern über etabliertes Wissen ablehnte. Zum Bearbeiten von Dingen, die ich schon verstanden hatte, fehlte mir die Geduld. Dafür hatte ich aber keinerlei Scheu, mich in neue Gebiete einzuarbeiten, für die ich keine systematische Ausbildung erfahren hatte. Und gar keinen Zweifel hatte ich, dass ich neuen Herausforderungen gewachsen sein würde. Doch ein Autodidakt bin ich wohl zeitlebens geblieben.
Manchmal wurde meine Neugier übermächtig. Einmal bedrängte ich meinen Lehrer immer wieder mit Fragen. Da ich nicht sofort eine Antwort bekam, stürmte ich durch die Bankreihen nach vorne, pflanzte mich vor dem Lehrer auf und verlange eine Antwort. „Jetzt!“ Dies führte zu einer disziplinarischen Maßnahme und ich wurde zum Abt geschickt. Dieser saß an seinem Schreibtisch und fragte, was passiert sei. Ich erzählte es. Er lächelte: „Sei in Zukunft ein wenig geduldiger.“
Das Stift Heiligenkreuz wurde eine Heimat für mich. Später sollte ich Pater Hermann bitten, unsere Trauung in der Stiftskirche zu vollziehen, und den Abt Karl Braunstorfer, uns danach seinen Segen für unser Eheleben zu geben.
Der Tagesablauf der Patres wurde durch das Chorgebet definiert: Um 5 Uhr 15 die Vigilien (40 Minuten), um 6 Uhr die Laudes (20 Minuten) und an Werktagen um 6 Uhr 25 die Konventmesse (45 Minuten). Weitere Stationen im Tagesablauf sind um 12 Uhr Terz und Sext (15 Minuten), um 12 Uhr 55 Totengedenken und Non (15 Minuten), um 18 Uhr 50 die Feierliche Vesper (25 Minuten) und um 19 Uhr 50 Komplet Salve Regina (20 Minuten).
Wir Klosterschüler nahmen an einigen dieser Chorgebete teil, insbesondere aber an der täglichen Konventmesse. Eine besondere Ehre war es, als Ministrant an der Feierlichen Konventmesse an Feiertagen teilzunehmen und das Messbuch oder den Stab des Abts tragen zu dürfen. Beide Ehren würden mir des Öfteren zuteil.
Ich war einer der Heiligenkreuzer Sängerknaben. Wir sangen zusammen mit den Patres den Gregorianischen Choral, in der ersten Reihe des schönen Chorgestühls stehend, also vor den Patres. Auch deshalb freute ich mich besonders, als Jahre später die CD „Chant – Music for Paradise“ mit Gregorianischen Gesängen der Zisterziensermönche des Stifts Heiligenkreuz zu einem Bestseller avancierte. Und ich war sehr bewegt, als Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch im Stift Heiligenkreuz den Satz sagte: „Wenn wir immer zum Singen, Preisen, Loben und Anbeten Gottes zusammentreffen, wird ein Stück Himmel auf der Erde präsent.“
Tatsächlich bedeutet der geregelte Tagesablauf eine Stütze für viele Menschen, ein Korsett, das Halt und Geborgenheit vermittelt. Allerdings bevorzuge ich auch heute noch die Freiheit, meine Werte und Interpretationen selbst zu wählen.
Ich war von zu Hause durchaus an autoritäre Erziehungsmethoden gewöhnt. Aber außer von meinem – durch die Wirren der Nachkriegszeit überforderten – Großvater hatte ich keine Bekanntschaft mit der Rute oder dem Riemen gemacht. Ich sah es damals nicht als abwegig an, wenn einige der Patres körperliche Strafen anwandten. Über einige Schläge mit der Rute oder eine Ohrfeige gingen diese körperlichen Strafen ohnehin nicht hinaus.
Ich selbst hatte in den vier Jahren meines Aufenthalts in der Oblatenschule des Stifts Heiligenkreuz nur zweimal Erfahrungen mit solchen „Erziehungsmethoden“ gemacht. Einmal, als ich einen Mitschüler verfolgte, der aus dem Innenhof des Klosters durch den Torbogen hinaus in den Vorhof lief, was uns ohne Aufsicht der Patres verboten war. Das Schicksal ereilte mich nach der Rückkehr in der Form von Pater Albert: Mit einer gewaltigen Ohrfeige streckte er mich nieder.
Der zweite Anlass betraf mein ungeduldiges Zwischenrufen in der Geschichtsstunde. Sichtlich entnervt forderte Pater Hermann Watzl: „Pfaff, folge mir in das Turnzimmer!“ Dort musste ich mich über den Turnbock legen. Nach dem ersten Schlag mit der Rute packte mich eine maßlose Wut: Ich rutschte vom Bock herunter und protestierte lautstark gegen die Züchtigung. Sie hatte meinen Stolz verletzt. Alles, was ich in der Lehrstunde wissen wollte, war eine Antwort auf eine mich bewegende Frage! Pater Hermann war wohl überrascht über meine heftige Reaktion. Er stellte seine Züchtigung sofort ein und gab mir zwei Schilling: „Geh und kauf dir Zuckerln! Und sei nicht so vorlaut in der Zukunft während des Unterrichts!“ Er blieb weiterhin mein Lieblingslehrer.
Zu Recht wird sexueller Missbrauch von Schülern durch katholische Priester aufs Schärfste kritisiert. Ich kann bezeugen, dass mir in den vier Jahren im Stift und später im Neukloster in Wiener Neustadt kein Fall dieser Art bekannt wurde. Dergleichen wäre in der engmaschigen Gemeinschaft nicht verborgen geblieben. Allerdings bereitete mir die überstrikte Sexualmoral der Kirche erhebliche Probleme. Wenn schon sexuelle Fantasien während der Pubertät als Sünde angesehen werden, die es zu beichten gilt und für die Buße erforderlich ist, schafft dies erhebliche psychische Belastungen für einen jungen Menschen. Noch heute sehe ich das als eine Form der Gehirnwäsche, der psychologischen Knechtschaft. Die geforderte Reue über Gedanken oder Taten, die keinen anderen Menschen betreffen, und damit verbundene Empfehlungen wie beispielsweise zum Fasten sind einer freien Entfaltung der Persönlichkeit nicht unbedingt förderlich.
Gerne nahmen wir an Übungen als Pfadfinder teil, die von Pater Adalbert initiiert und geleitet wurden. Dabei lernten wir zehn Körperübungen kennen, die nach dem Begründer der Pfadfinderbewegung, Lord Baden-Powell, täglich zu absolvieren sind. Mich hatte die Weisung Baden-Powells überzeugt. Nach dem Aufstehen begann ich im Vorraum des großen Schlafsaals und später im Freien mit den Übungen. Anfangs wurde ich von den Mitschülern belächelt, dann schlossen sich einige an, und am Ende machten alle mit. Nach und nach entwickelte ich mehr Interesse am Fußballspielen und am Sport allgemein. Ein guter Sportler beeindruckt seine Mitschüler mehr als ein guter Schüler!
Diese Entwicklung beobachtete Pater Werner Klüger, der lange als Missionar in China tätig gewesen war. Eines Tages rief er mich zu sich:
„Du weißt, dass ich jahrelang in China ein Salesianer-Internat geleitet habe. Ich will dir von einem Jungen erzählen, der mich beeindruckte. Er wurde von allen Mitschülern wegen seiner schulischen und sportlichen Leistungen respektiert und galt als natürlicher Anführer. Seine Autorität war so groß, dass er selbst einen Schüler züchtigen konnte, der größer und stärker war als er selbst. Ich bin überzeugt, dass du hier im Stift Heiligenkreuz bei deinen Mitschülern eine solche Rolle spielen kannst und dass du in deinem Leben etwas Außergewöhnliches leisten kannst, wenn du dies nur willst!“
Ich war erstaunt und skeptisch: Erstens glaubte ich nicht, dass ich einen Mitschüler ungestraft züchtigen konnte oder gar wollte. Und zweitens hatte ich mich bisher nie in der Rolle einer Autorität gesehen. Aber Großes wollte ich eigentlich schon leisten. Deshalb blieb etwas von Pater Werners Worten bei mir hängen. Die Frage nach dem richtigen Vorbild und Leitbild für mein Leben beschäftigte mich sehr.
Während des Mittagessens las immer einer von uns Schülern aus einem Buch vor. Ich erinnere mich gut, dass ich einmal große Teile eines Buches über Pater Damian De Veuster und seine missionarische Arbeit auf Molokai, Hawaii, für die Leprakranken vorlas. Sein selbstloses Leben hinterließ einen tiefen Eindruck bei mir. Ich fragte mich: Kann man Erfolg nur nach öffentlich anerkannten Leistungen definieren? Und zählen Handlungen, die nicht nur der Befriedigung des eigenen Ego dienen, mehr, weil sie das Wohlergehen anderer verbessern? Was ist ein produktives Leben: Muss es neben Erfolg und Leistungen für andere auch persönliches Glück beinhalten?
Aus dem schüchternen, introvertierten Volksschüler wurde in den ersten vier Jahren des Gymnasiums ein selbstbewusster und selbstsicher handelnder Junge: Wenn andere eine solche Meinung über mein Potenzial haben, ist vielleicht etwas daran, sagte ich mir. Habe ich eine Lebensaufgabe, eine Bestimmung über das Alltägliche hinaus? Aus meiner heutigen Perspektive würde ich folgern, dass durch schulischen und sportlichen Erfolg ein Wandel in meinem Selbstbild entstanden war. Ich merkte, dass ich meine Phasen der Traurigkeit und Lustlosigkeit durch entschlossenes Handeln und durch Hingabe an ein Zukunftsprojekt beenden konnte. Dass daraus eine Art Euphorie und Lust am Handeln entstehen konnte. Dass ich aus der inneren Defensive in die Offensive kommen konnte. Und dass ich die damit verbundene Aktivität und Anerkennung genoss.
Am Anfang meiner Zeit als Schüler im Stift Heiligenkreuz hatte ich ein ambivalentes Verhältnis zur Religion. Einerseits war ich beeinflusst durch die frühkindlichen Erfahrungen in Tevel: regelmäßiger Kirchenbesuch, Gebet vor dem Essen und Schlafengehen, das Beispiel meiner Mutter und meiner Großeltern. Andererseits hatten die zwei Jahre bei den Logotkas eher zu einer kritischen Dis-tanz geführt: Onkluschka und Franzi-Tante waren entweder Agnostiker, wenn nicht gar Atheisten. Jedenfalls misstrauten sie der Organisation der Kirche und ihren Vertretern. Und sie äußerten sich sehr kritisch über die Rolle der Kirche während der Zeit der Hitler-Regierung. Zudem waren sie bekennende Sozialisten.
Im Lauf der Eingewöhnung in Heiligenkreuz öffnete ich mich zunehmend gegenüber der Lehre der Kirche: Nach einem Jahr versuchte ich sogar, mich emotional mit den Postulaten des katholischen Glaubens zu identifizieren.
Jeden Morgen wohnten wir der Messe in der Stiftskirche bei. Von den Sitzreihen seitlich des Hauptaltars hatten wir einen hervorragenden Blick auf das liturgische Geschehen. Oft strömten von den hohen Fenstern mit ihren Glasmalereien die Sonnenstrahlen herab und zeichneten bunte Muster auf den Boden. Immer mehr versuchte ich während der Messe zu meditieren, mich vom laufenden Geschehen gedanklich zu entfernen. Es kam eine Phase, in der ich mich emotional mit dem Opfertod Jesu und der Erlösungsgeschichte befasste: Und plötzlich verspürte ich ein intensives Gefühl der Liebe, ja der Verzückung, eine Identifikation mit dem gekreuzigten Heiland. Ich fühlte mich eins mit Christus, eins mit Gott.
Meine Phase der Identifikation mit der christlichen Botschaft und der mystischen Liebe zum gekreuzigten Heiland war erheblichen Schwankungen unterworfen: Je mehr ich die für mich eklatanten Widersprüche zwischen dem Glauben und der bedrückenden Realität der Welt wahrnahm, umso kritischer stand ich dem Glauben gegenüber. Es stellten sich Fragen über Fragen, über die ich wohl auch für andere sichtbar grübelte.
Eines Tages sprach mich Pater Werner an: „Martin, ich wollte schon länger mit dir reden – über deine Leistungen als Schüler, über dich als Menschen, über deine Probleme.“
„Was gibt es da zu besprechen? Sind Sie mit meinen Leistungen nicht zufrieden? Was sollte ich besser machen?“
„Mit deinen Leistungen als Schüler bis ich mehr als zufrieden. Du bist Klassenbester, deine Lehrer loben dich und deine Mitschüler eifern dir nach. Darüber mache ich mir keine Sorgen.
Aber ich sehe, dass du oft vor dich hin grübelst. Und dass du dabei nicht glücklich zu sein scheinst!“
„Pater Werner, ich werde schon damit fertig …“
„Ich will dir gerne helfen, wenn du mich lässt! Aber ich dränge dir sicher nichts auf.“
„Ich tue mich schwer, über Dinge zu reden, über die ich mir selbst nicht ganz im Klaren bin. So vieles in meinem Leben scheint keinen Sinn zu haben, manches ist gar verwirrend. Ich weiß weder wofür noch wonach ich mein Leben gestalten soll!“
„Was brennt dir denn besonders auf den Nägeln?“
„Manchmal frage ich mich, wer ich bin. Und ich sehe nicht, warum ich auf diese Welt gekommen bin, warum ich überhaupt lebe. Oder was mein Ziel im Leben sein soll!“
„Nun, diese Fragen stellen sich viele Menschen, vor allem im jugendlichen Alter. Welche Frage bedrückt dich am meisten?“
„Welchen Sinn hat das Leben, welchen Sinn hat mein Leben?“
„Lieber Martin, als Christen glauben wir: Gott hat die Welt aus Liebe erschaffen, nicht aus Notwendigkeit. Und Jesus Christus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, hat uns aus Liebe Erlösung gebracht. Der Sinn des menschlichen Lebens besteht also darin, Gott zu dienen, ihn anzubeten und ein Leben voller guter Taten zu leben. Wir Menschen müssen aktiv mitwirken, damit das Reich Gottes kommen kann. Dann werden wir von unseren Sünden erlöst und kommen in den Himmel.“
„Aber vom Reich Gottes sind wir wohl noch sehr weit entfernt! Ich frage mich: Welchen Sinn hatte der Zweite Weltkrieg, die zig Millionen Toten? Die Verschleppung meiner Mutter nach Russland? Die Trennung unserer Familie? Wenn Gott die Welt aus Liebe geschaffen hat und wenn Gott allmächtig ist, warum hat er dies alles zugelassen? Warum hat er meine Gebete nicht erhört und die üblen Dinge in meinem Leben nicht verhindert?“
„Gottes Werke sind unergründlich und für uns Menschen oft nicht nachzuvollziehen. Leid dient auch dazu, unseren Glauben zu prüfen und uns herauszufordern, trotzdem unsere Pflicht als Christen zu tun! Der Theologe Friedrich Bonhoeffer ist im letzten Kriegsjahr, im April 1945, im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet worden. Vor seinem Tod hat er in Kenntnis all der schrecklichen Dinge, die er dort erlebt hat, gesagt: ‚Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will.‘ Daran müssen wir als Christen glauben.“
„Aber warum verhindert er nicht gleich, dass Böses überhaupt erst entsteht, wozu er ja in der Lage wäre?“
„Er tut dies, wie gesagt, um uns zu prüfen!“
„Pater Werner, ich tue mich schwer, dies zu glauben. Ich weiß, wie verzweifelt ich war, als unserer Familie dies alles geschah und sehe bis heute keinen Sinn darin!“
„Die Religion setzt den Glauben voraus. Mit rationalen Argumenten allein können wir weder Gottes Existenz begründen, noch sein Handeln infrage stellen! Du musst einfach glauben. Und du musst beten, dass dir dieser Glaube geschenkt wird durch Gottes Gnade. Dann wirst du alles leichter ertragen und nicht länger an Gott zweifeln. Solche Krisen, wie du sie erlebt hast, bieten auch eine Chance: Sie sind eine Herausforderung, deine Angst zu überwinden, dich in deinem Leben für das Sinnvolle zu engagieren.“
„Ja, aber … was ist das Sinnvolle?“
„Nun, ich bin überzeugt, für dich sind es Aktivitäten, Handlungen, in denen du völlig aufgehen kannst, denen du dich ganz hingeben kannst, in denen du deine besonderen Fähigkeiten ausschöpfen kannst.“
„Ja, aber … Pater Werner, welche Aktivitäten sind das? Was soll ich im Leben machen?“
„Martin, das musst du selbst herausfinden. Ich kann dir aber einen Tipp geben: Den Sinn des Lebens kann man nicht nur im Leisten, sondern im Sein finden! Nicht nur in dem, was man tut oder erreicht, sondern auch darin, welcher Mensch man ist.“
Und er fügte hinzu: „Du weißt ja, dass ich viele Jahre als Missionar in China tätig war. Dort habe ich etwas aus den Lehren Buddhas gelernt. Er sagt: ‚Der Weg ist das Ziel.‘ Im Leben geht es also weniger darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen als vielmehr darum, auf dem Weg zu sein!“
„Ist das alles, was Sie mir raten können?“
„Nein, lieber Martin! Ich habe noch einen zweiten Rat für dich: Du musst durch dein Handeln deinen ureigenen Sinn für dich und dein Leben selbst bestimmen! Diese Freiheit hast du. Und diese Freiheit musst du auch nutzen! Du kannst es am besten tun, wenn du dein Leben einer Aufgabe widmest, die größer ist als du selbst! Und du musst dich auf diese Aufgabe vorbereiten, an dir selbst arbeiten! Dich sozusagen selbst erfinden! Dann wirst du den Sinn deines Lebens am ehesten erkennen!“
„Welche Aufgabe ist das?“
„Du musst dir die Antwort selbst suchen! Aber nachdem ich dich hier im Internat schon einige Zeit beobachtet habe, gebe ich dir eine Hilfestellung: Widme dein Leben solchen Tätigkeiten, die anderen Menschen, die vor allem den Schwächsten unter den Schwachen dienen! Dann wirst du, so paradox es dir vielleicht heute erscheinen mag, den größten Nutzen für dein Leben, die größte Erfüllung in deinem Leben finden!“
Ich fand seine Worte bedenkenswert. Ganz überzeugt war ich nicht. Aber ich grübelte darüber nach.
Jahre später kam mir ein Gedicht von Rainer Maria Rilke vor Augen, das mir damals schon hätte weiterhelfen können, das mir jedenfalls später weiterhalf. Ich zitiere einige Zeilen aus dem Gedicht:
„Was mich bewegt:
Man muss Geduld haben,
gegen das Ungelöste im Herzen,
und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben,
wie verschlossene Stuben,
und wie Bücher,
die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind.
Es handelt sich darum, alles zu leben,
wenn man die Fragen lebt,
lebt man vielleicht allmählich,
ohne es zu merken,
eines fremden Tages
in die Antwort hinein.“
2 (Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter, Frankfurt 2007.)
In der Oblatenschule herrschte ein strenges Auswahlprinzip: Von über dreißig Erstklässlern waren wenige in der 4. Klasse übrig geblieben. Nachdem im Stift Heiligenkreuz nur ein vierklassiges Gymnasium existierte, setzten wir die weiteren vier Jahre bis zur Matura (Abitur) in Wiener Neustadt fort. Die Schüler wohnten in einem von Zisterziensern geleiteten Internat im Neukloster und besuchten das weltliche Gymnasium. Hier merkte ich, dass die Jahre in Heiligenkreuz eine gute Vorbereitung gewesen waren: Das Lernen machte Spaß und fiel mir leicht.
Auch wenn es den Patres nicht gelungen war, mich für den Priesterberuf zu interessieren, wurden Fragen der Religion von mir doch als etwas sehr Wichtiges und Ernstes angesehen. Aber konnte denn alles stimmen, was die Patres uns im Namen der Religion vermitteln wollten? Etwa, dass jede Form der Sexualität vor der Ehe verboten und eine Sünde wäre? Dies passte gar nicht mit meinen Bedürfnissen, Wünschen und Fantasien in der Pubertät zusammen.
Im Alter von sechzehn Jahren hatte ich ein Gespräch mit Pater Paulus, einem der Patres im Neukloster in Wiener Neustadt. Er fragte mich im Lauf eines persönlichen Gesprächs, in dem ich meine Zweifel an manchen Aspekten der christlichen Religion wie der Dreifaltigkeit, der Jungfrauengeburt Jesu und der Auferstehung von den Toten ansprach: „Martin, glaubst du an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde?“
„Ja, Pater Paulus, denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Welt und alles Leben nur durch Zufall entstanden ist. Über den Prozess der natürlichen Auslese, wie sie Darwin propagiert. Es muss also Gott geben, den Schöpfergott, der den Anstoß gab, der dies alles in Bewegung gesetzt hat. Dieser Gott muss aber nicht im Widerspruch stehen zu den Darwinschen Erkenntnissen.“
„Glaubst du auch an einen persönlichen Gott, der sich mit den Handlungen und dem Schicksal einzelner Menschen beschäftigt, der Gebete erhört und Wunder vollbringen kann?“
„Pater Paulus, ich möchte nichts mehr, als an einen solchen Gott zu glauben. Ich bete zu ihm. Und ich bitte ihn um Hilfe, zum Beispiel für die Gesundheit meiner Mutter. Aber dann kommen mir Zweifel: Warum hat dieser gütige, liebende Gott nicht eingegriffen, um meine Mutter vor der Verschleppung nach Russland zu bewahren, als ich zu ihm betete? Oder die Qualen unserer Familie zu verhindern? Warum hat er den Tod von Millionen von unschuldigen jüdischen Männern, Frauen und Kindern in den Gaskammern nicht abgewendet?“
„Ja, das ist sicher schwer oder gar nicht zu verstehen. Jeder, der über diese Fragen nachdenkt, hat manchmal Zweifel. Auch ich. Wie ich aber weiß, hat eure Familie nach den Wirren und schweren Prüfungen wieder zusammengefunden! Ist das nicht ein Zeichen, dass deine, dass eure Gebete erhört wurden?“
„Ich möchte das glauben, tue mich aber sehr schwer dabei. Ich bin ein religiöser Mensch, der an eine höhere Intelligenz, an den Schöpfergott, glaubt, der die Großartigkeit der Natur bewundert, der aber Probleme hat mit dem Bild eines persönlichen Gottes.“
„Lieber Martin, ich kann dir nur raten: Bete um Erleuchtung und Verständnis! Religion fußt auf dem Glauben, nicht auf dem Wissen!“
Ich bemühte mich sehr, seinem Rat zu folgen, aber meine Zweifel konnte ich niemals ganz beiseiteschieben.
Noch viel gravierender, weil für mein weiteres Leben bestimmender, war der von den Patres ernsthaft vertretene Ausspruch „Extra ecclesiam nulla salus.“ Zu Deutsch: „Außerhalb der (katholischen!) Kirche gibt es keine Erlösung.“
Alles in mir revoltierte gegen den Anspruch, dass nur über die katholische Kirche der einzige Weg zur Erlösung führen sollte: Sollten Protestanten ausgeschlossen sein? Oder alle Vertreter anderer Religionen – Juden, Muslime, Buddhisten, Hindus? Beflügelt wurden diese Zweifel durch die Lektüre von Gotthold Ephraim Lessings Stück Nathan der Weise, das eine viel tolerantere Vision über die Daseinsberechtigung unterschiedlicher Religionen vermittelte.
Für mich als Sechzehnjährigen waren dies ganz persönliche, gravierende Fragen. Von den Patres konnte ich keine befriedigende Antwort erhalten. Also begann ich, nach Büchern über andere Religionen Ausschau zu halten. Die Bibliothek des Neuklosters war keine ergiebige Quelle. Irgendwann kam mir die so einfache wie verblüffende Frage und der damit verbundene Weg zur Erkenntnis: Sind die Unterschiede im Dogma und in der Ausübung der Religion nicht zweitrangig oder gar unwichtig? Wichtiger in der menschlichen Gesellschaft ist doch die Frage, wie sich die Menschen zueinander verhalten? Oder auf den Punkt gebracht: Welche Religion schafft den besten Menschen? Diese sollte meine Religion werden! Für einen Zisterzienserzögling Mitte des 20. Jahrhunderts war das ein verwegener Entschluss. Wo konnte ich ein Labor finden, in dem das natürliche Experiment bereits vollzogen, seine Ergebnisse unmittelbar sichtbar sind? Für die Antwort musste ich nicht lange suchen: Indien ist das Land, in dem praktisch alle Religionen nebeneinander existieren. Dort musste ich hin, um die Antwort auf meine Fragen zu finden! Für einen Gymnasiasten ohne Mittel, aus einem Elternhaus, das selbst wirtschaftlich zu kämpfen hatte, war das kurzfristig ein Ding der Unmöglichkeit. Außerdem wollte ich auf jeden Fall das Gymnasium abschließen. Mir war klar, dass ich ohne einen solchen Abschluss und ohne ein Studium keine große Chance hatte, meine Träume zu realisieren.
Zu meinem drängenden Durst auf eine Antwort nach den Lebensfragen kam eine zunehmende Abenteuerlust. Karl May hatte wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bereits mit fünfzehn Jahren war ich zusammen mit meinem Schulfreund Harry Schebach durch Österreich, Südtirol, das nördliche Italien bis nach Palermo getrampt. Wie großartig war Venedig, der zur Realität gewordene Traum einer Stadt in der Lagune! Oder Florenz mit seinen Kunstschätzen! Oder Rom, die Ewige Stadt, mit ihren Boten des Altertums, mit der Vatikanstadt, dem Petersdom …
Von Neapel nahmen wir die Fähre nach Capri. Bei der Überfahrt lernten wir andere Jungen kennen – aus Deutschland, Belgien und Frankreich. Wir beschlossen, ein informelles Ferienlager unweit der berühmten Blauen Grotte zu errichten.
An ruhigen Tagen schwammen wir in die Blaue Grotte hinein. Eines Tages war das Meer unruhig, und die Wellen schlugen an der Felswand empor. Ein Mann versuchte uns davon abzuhalten, an diesem Tag ins Wasser zu gehen. Als wir nicht auf ihn hören wollten, kniete er sich vor einem Kreuz am Rande des Pfades nieder und fing an, für uns zu beten. Nach einiger Zeit kletterten meine Freunde aus dem Wasser, sichtlich mit Mühe, denn die Wellen gingen hoch und nieder.
Nur ich war voller Übermut – vielleicht hatte ich auch zu viel Rotwein getrunken – und blieb noch länger im Wasser. Wenn es die anderen schafften, würde es mir allemal gelingen! Nur legte der Wind sichtlich zu, und die Wellen wurden immer höher. Ich versuchte an Land zu klettern: vergeblich! Die Wellen rissen mich immer wieder zurück. Meine Finger hatte ich mir an den Felsen aufgerissen. Meine Freunde versuchten, herunterzuklettern, um mir zu helfen. Plötzlich gestikulierten sie, winkten mir zu und zeigten aufs offene Wasser. Ein Boot war die Küste entlanggekommen. Die Insassen bemerkten, dass es ein Problem gab. Ich schwamm dem Boot entgegen und wurde an Bord genommen. Es war noch einmal gut gegangen. Mir wurde aber bewusst, dass das Abenteuer auch ein böses Ende hätte nehmen können.
Der Entschluss, nach Indien zu fahren, war gefasst. Wenn ich meine Motive heute selbstkritisch prüfe, ist mir klar: Es ging mir nicht nur um Sinnsuche, um den richtigen Weg durchs Leben. Es war auch die Lust auf Abenteuer und eine Neugier, die mich mein ganzes Leben begleiten würde: Wenn ich bisher die Blaue Blume nicht gefunden hatte, dann musste sie wohl im nächsten Tal, hinter dem nächsten Kap auf mich warten. Also los!
Nachdem ich den Sommer lang durch Italien getrampt war, erschien mir die vom Internat im Neukloster erzwungene Disziplin allzu rigoros und beengend. Ich brauchte mehr Luft zum Atmen, mehr Freiheit, das zu tun, was ich wollte. Außerdem machte ich die erstaunliche Entdeckung, dass Mädchen plötzlich viel interessanter wurden, als sie dies in den Jahren zuvor gewesen waren. Auch aus der Distanz betrachtet, übten sie eine gewaltige Anziehung auf mich aus. Wir Schüler aus dem Neukloster änderten unseren Weg zum Gymnasium, um sicher zu sein, dass wir am Mädchengymnasium vorbeikommen würden. Die Mädchen blickten aus den Fenstern. Und wir taten so, als würde uns dies überhaupt nicht interessieren.
Eines Tages hörte ich zwei der jungen Damen singen: „Zwei Märchenaugen, wie die Sterne so schön …“ Ich dachte mir nichts, bis einer meiner Mitschüler sagte: „Merkst du nicht, die singen über dich!“ Nein, ich hatte ich es nicht gemerkt. Ich blickte zum Fenster hinauf: Sie lächelten und winkten mir zu! Das war mir denkbar peinlich. Von da an wählte ich einen anderen Weg zur Schule.
Zu den mutigsten Taten meines Lebens zählt, dass ich im Alter von sechzehn Jahren mein Herz in die Hand nahm und ein Mädchen ansprach. Sie hatte grüne Augen, rotes Haar und hieß Dina – ich habe sie bis heute nicht vergessen. Wir plauderten und spazierten einige Straßenblöcke entlang und wiederholten dies in den folgenden Tagen. Aber das war auch schon alles. Meine Jahre in einer Knabenschule und im Internat hatten mich nicht darauf vorbereitet, mit Mädchen einen natürlichen Umgang zu pflegen.
Ich bat meine Eltern, die letzten beiden Klassen des Gymnasiums in Baden bei Wien besuchen zu dürfen. Bei den Tanzkursen lernte ich, meine Scheu gegenüber Mädchen zu reduzieren.
An meine Tanzpartnerinnen erinnere ich mich gut. Zu einer fühlte ich mich besonders hingezogen, und wir gingen zu mehreren Bällen – oft bis in die frühen Morgenstunden. Anschließend begleitete ich sie nach Hause. Aber offensichtlich erschien ich ihr zu unreif oder zu wenig wagemutig.
Eine andere war eine echte Schönheit, schwarzes Haar und blaue Augen. Sie hätte mit den meisten Schauspielerinnen mithalten können. Eines Tages, als ich nicht nur ihre Lippen küsste, sagte sie: „Ihr Männer seid doch alle gleich! Ich weiß schon, was du willst!“ Und sie fügte hinzu: „Ich werde mir von meiner älteren Schwester den Ring ausborgen und dich um acht Uhr heute Abend im Kurpark treffen!“ Ich hatte nur eine vage Vorstellung davon, was sie meinte. Also wartete ich, bis sie verspätet eintraf. Allerdings muss ich mich danach so ungeschickt und schüchtern angestellt haben, dass nicht allzu viel Intimität entstand. Im Nachhinein schämte ich mich und war ihr gegenüber noch gehemmter als zuvor.
Ich tanzte leidenschaftlich gern und wurde als passabler bis guter Tänzer angesehen. Aber im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, insbesondere im Bereich der Intimität, war ich gehemmt. Manches Mal fragte ich mich, ob die Erziehung in reinen Knabenschulen, in der Klosterschule, zu tiefe Spuren hinterlassen hatte.
Unbewusst war meine Einstellung zur Sexualität wohl auch durch zwei Kindheitserlebnisse mitgeprägt worden. Das erste Erlebnis hatte ich im Alter von drei oder vier Jahren. Für einige Monate arbeitete ein Mädchen als eine Art Kindermädchen bei uns. Ich erinnere mich, wie sie mich eines Tages unter der Decke ihres Bettes zwischen die Schenkel klemmte und mich zusammendrückte. Ich hatte Angst, erdrückt zu werden oder zu ersticken, und begann zu weinen: „Lass mich los, lass mich los!“ Darauf zog sie mich aufwärts zwischen ihren Beinen hoch. Ich beruhigte mich erst, als ich wieder frische Luft zum Atmen verspürte. Dieses Mädchen blieb nicht lange bei uns, aus welchen Gründen auch immer.
Das zweite Erlebnis war in Wien mit Traudl in meinem achten Lebensjahr. Es begann an einem Sonntagmorgen mit einer Polsterschlacht und einem Ringkampf im Doppelbett ihrer Eltern, die bereits aufgestanden waren und deshalb nicht im Zimmer waren. Ich hielt Traudl schließlich fest, umklammerte sie mit Armen und Beinen und rief: „Ich bin der Sieger! Ich bin der Sieger!“ In diesem Augenblick verspürte ich eine Welle von Lust und süßer Erfüllung, die von meinen Hüften ausging und mich fast lähmte. Was dieses Gefühl tatsächlich bedeutete, wusste ich nicht. Es war jedenfalls ein völlig neuartiges Gefühl. Ähnliche Erfahrungen sollte ich erst wieder in der Pubertät machen.
Die beiden Erlebnisse bestimmten wohl mein unterbewusstes Bild von Sexualität als etwas Beängstigendem, Bedrohlichem, Bedrückendem. Andererseits lockten Lust, Süße und Befriedigung. Später sollte noch die Indoktrination in der Klosterschule hinzukommen: „Sexualität ist etwas Unreines, eine Sünde. Man muss sich dafür schämen!“
Die Geschichte meiner Jugendjahre ist unter anderem ein Reflex der Suche nach Sinn in dieser Hinsicht. Und mein jugendlicher „Ausbruch“ aus der europäischen Gesellschaft ist auch als ein Kampf um die persönliche Freiheit, um einen natürlichen Umgang mit dem anderen Geschlecht zu sehen.
Seit meinem fünfzehnten Lebensjahr musste ich meinem Vater bei der Arbeit im Wald helfen, das war aus wirtschaftlicher Sicht notwendig. Statt der Arbeit als Holzfäller hatte mein Vater – wie schon erwähnt – begonnen, in den Ländereien des Stifts Heiligenkreuz als Pecher zu arbeiten. Durch Anritzen der Kiefernrinde mit einem Hobel wurden Bahnen geschaffen, in denen das Harz in angehängte tönerne Gefäße floss. Diese mussten von Zeit zu Zeit in eine Butte – ein Holzgefäß mit einem langen Stützelement – entleert werden, die unter den Ellenbogen geklemmt werden konnte. Diese wiederum wurden in Holzfässer geleert, die mit hölzernen Schlitten zu Tal befördert wurden.
Das klingt einfach, war es aber nicht: Sobald das Harz in einer Rinne verhärtete, musste die Rinne gereinigt werden. Jährlich musste weiter oben eine weitere Rinne geritzt werden. Bei mehreren Rillen – wir legten höchstens acht bis zehn Rillen an – war eine Leiter nötig, um überhaupt an die neue, zu schaffende Rille heranzukommen. Eine „Zehnerleiter“ war fast drei Meter lang. Sie hatte unterschiedlich lange Füße, damit sie am Steilhang eingesetzt werden konnte. Und Steilhänge gab es mehr als genug im Wiener Wald.
Die am Boden liegenden Nadeln stellten zwar einen Teppich dar, am Hang jedoch rutschte man sehr leicht auf ihnen aus. Um die Risiken zu minimieren, trugen wir lederne Schuhe mit Eisennägeln. Sie gaben den Knöcheln einen gewissen Halt.
Es war schwere körperliche Arbeit: Aufstehen um vier, frühstücken, zu Fuß manches Mal bis zu einer Stunde in die Berge hinaufgehen, den Hobel und die Leiter schleppen, später dann die hölzerne Butte. Am gefährlichsten war der Abtransport der vollen Fässer mit dem Holzschlitten. Wenn dieser am Steilhang außer Kontrolle geraten wäre, wäre er nicht mehr zu halten gewesen, und der Mann vor dem Schlitten hätte überfahren werden können. Es war eine körperliche Ertüchtigung sondergleichen. Ich hatte damals kein Gramm Fett am Bauch.
Eine Szene aus dem Badener Strandbad: Wir stehen zu fünft oder sechst im Kreis und unterhalten uns über Gott und die Welt. Plötzlich merke ich, dass eines der Mädchen lächelt und auf meinen Bauch blickt. „Weshalb lachst du? Was ist los mit meinem Bauch?“ Ihre Antwort: „Nichts. Er sieht nur aus wie ein Waschbrett!“ Solche Komplimente sollte ich in meinem späteren Leben nie wieder bekommen!
In dieser Zeit nahm ich an einem Geländelauf im Badener Kurpark und den darüberliegenden Bergen teil – ohne jegliche Vorbereitung. Aus dem Feld von über zwanzig Läufern belegte ich auf Anhieb den zweiten Platz. Den ersten hatte der um etliche Jahre ältere Langstreckenläufer Senekovic erreicht – er war niederösterreichischer Landesmeister. Mein Vater schien von dieser Leistung mehr beeindruckt zu sein als von meinen schulischen Leistungen als Klassenbester, war er doch selbst äußerst sportlich und fit. Bereits Jahre zuvor hatte er gesagt: „Wenn du mit deiner ganzen Kraft dein Bestes gibst, bin ich – vielleicht – ein wenig mit dir zufrieden!“
Im Anschluss an den Geländelauf gab es eine Gesellschaft: Die Läufer trafen mit anderen Jugendlichen zusammen, zum Essen und Plaudern. Unter den Anwesenden waren zwei Schwestern, die die Veranstaltung betreuten. Ich war aus dem Helenental mit dem Bus angereist. Als ich darauf hinwies, dass ich zu dieser spätnachmittäglichen Stunde keinen Bus mehr nehmen konnte und etliche Kilometer Fußweg vor mir hatte, bot eine der Schwestern – bildhübsch, blond, mit wohlgeformten Proportionen – an, mich mit ihrem Roller nach Hause zu fahren. Ich nahm dieses Angebot sehr gerne an, hatte ich doch vorher schon ausgiebig mit ihr geflirtet.
Kurz bevor wir im Helenental angekommen waren, beugte ich mich nach vorne und küsste sie auf die Schulter. Glücklicherweise schwankte sie nur wenig mit dem Roller, sonst wären wir wohl im Straßengraben gelandet. Als sie mich bei mir zu Hause absetzte, drückte ich ihr einen hastigen Kuss auf die Wange. Dann ging ich schnell zum Tor hinein.
Die nächsten Tage fuhr ich wieder mit meinem Rad Richtung Baden. Und wer kam mir per Roller entgegen? Die junge Dame! Sie hielt sofort an. Auch ich war vom Rad gestiegen: „Was bringt dich ins Helenental?“, fragte ich.
„Ich ... ich ... wollte nur ein wenig spazieren fahren!“
„Ach so!“
Sie blickte mich an. Ich blickte sie an. Dann packte mich wieder eine beklemmende Scheu. Ich sagte stotternd: „Ja … dann ... viel Spaß! Servus!“ Und stieg aufs Rad. Meine Angst vor dem Neuen war wohl größer als die Anziehungskraft dieses attraktiven weiblichen Wesens! Später würde es mir leid tun, dass mir nichts Besseres eingefallen war und dass ich nichts Verwegeneres gesagt hatte. Wer zu furchtsam ist, den bestraft das Leben!
Die Landschaft im Wiener Wald auf beiden Seiten des Helenentals ist großartig: Von einer Talmulde aus, in der das Haus stand, das uns vom Stift zur Verfügung gestellt wurde, geht der Kleespitz steil in die Höhe. Vom Haus aus ging der Blick zu einem Aussichtspunkt auf einem Felsen: Von diesem aus blickte ich oft nach Osten, in Richtung Baden bei Wien, über die folgende Ebene und weiter hinaus. Und ich träumte von Indien, das weit im Südosten liegen musste.
Aber wie sollte ich es schaffen, nach der Matura mit achtzehn Jahren in Richtung Indien aufzubrechen – ohne Geld, ohne dass mir meine Eltern helfen konnten?
Die siebte und achte – also die beiden letzten – Klassen des Gymnasiums fielen mir nicht schwer, dafür hatten die Jahre zuvor die Voraussetzungen geschaffen. Ich begann mein Lernen zu reduzieren und auf die Klassenstunden zu konzentrieren, ohne dabei meinen Status als Klassenbester zu gefährden. Eine Belohnung war sicherlich, dass ich als einziger Schüler des Badener Gymnasiums an der Generalprobe zur für den 5. November 1955 geplanten feierlichen Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper teilnehmen durfte. Gespielt wurde Beethovens Fidelio. Dass die Wahl auf mich fiel, wunderte mich dennoch, denn ich war trotz meiner schulischen Leistungen bei Lehrern und dem Direktor Christl unbeliebt geworden: Ich war offensichtlich zu aufmüpfig und zu schwer zu kontrollieren.
Während des Aufstands der Ungarn gegen die kommunistische Herrschaft im Jahr 1956 hatte ich zu meinen Klassenkameraden gesagt, dass ich nach Ungarn gehen und gegen die Russen kämpfen wollte. Dies war ein lächerlicher Vorschlag, aber man traute es mir offensichtlich zu, genau das zu tun. Direktor Christl bekam Wind davon: Er informierte mich, dass ich im hohen Bogen aus der Schule fliegen würde, wenn ich dieses Unternehmen durchführen würde.
Ein weiterer Anlass brachte mich ins Blickfeld des Direktors. Ich schloss mich der Österreichischen Jugendbewegung (ÖJB) an, eine Jugendorganisation der Österreichischen Volkspartei, und wurde zum Bezirkssekretär für das Österreichische Jungvolk im Bezirk Baden bei Wien ernannt. Und ich war Mitglied im Vorstand der ÖJB in Baden bei Wien. Dadurch hatte ich den Schlüssel und somit den Zugang zum 1. Stock des „Batzenhäusls“ neben dem Badener Stadttheater, wo die Veranstaltungen der ÖJB stattfanden.
Wie aus meiner ÖJB-Mitgliedschaft ersichtlich, dominierte bei mir ein christlich-konservatives Weltbild: Elternhaus und Stift Heiligenkreuz hatten dazu wesentlich beigetragen. Wie bei Familien von Vertriebenen üblich, machte ich „die Russen“ und „die Ungarn“ für die Enteignung und Vertreibung aus Ungarn verantwortlich. Der Gedanke, dass diese sicher ungerechten Handlungen eine Retourkutsche für die von Hitler-Deutschland initiierten Verbrechen waren, kam mir nicht in den Sinn. Die zwei Jahre bei der Familie Logotka zeigten mir zwar, dass es auch eine andere Sichtweise auf das konservative Politikmodell und den damit verbundenen Kapitalismus gab. Aber offensichtlich hatte sich diese bei mir nicht auf Dauer festgesetzt. Über den Holocaust wurde in der Regel nicht gesprochen. Die Vertriebenen sahen sich als Opfer, nicht als Täter.
Doch einige Zweifel waren vorhanden, ob das bestehende kapitalistische Wirtschaftssystem verbunden mit dem christlich-konservativen Weltbild in seiner damaligen Form dem Ideal entsprach. Das kommunistische Gegenmodell hatte zumindest in der Theorie seine positiven Seiten, zeigte doch die kommunistische Ideologie einige bemerkenswerte Parallelen zu christlichen Idealen, von denen Marx zweifelsohne inspiriert worden war.
Langsam erdachte ich einen pragmatischen Test, der auf eigenen Beobachtungen und Erfahrungen basieren sollte. Ich wollte ein Jahr in den USA und ein weiteres Jahr in der Sowjetunion verbringen und mich danach endgültig politisch orientieren.
Zurück zum Batzenhäusl: Mit meinen Schulkameraden besuchte ich den Tanzkurs beim örtlichen Tanzlehrer. Dieser hatte am Sonntagabend eine zusätzliche Übungszeit vorgesehen, in der man gegen Eintrittsgebühr tanzen konnte. Der Rock‘n’Roll hielt gerade seinen Einzug, nur wurde dieser „sündige Tanz“ nicht in der Tanzstunde unterrichtet. Ich gründete einen informellen „Batzenhäusl Schüler Club“ mit dem erklärten Ziel, am Sonntagabend auch Tänze wie Rock‘n’Roll tanzen zu können. Die Initiative war ein voller Erfolg – vielleicht zu sehr. Dem Tanzlehrer gingen die Schüler am Sonntagabend und somit die Einnahmen aus. Er fand schnell heraus, wer dafür verantwortlich war, und ging zu Direktor Christl. Wie ich später erfahren sollte, fragte der Tanzlehrer, ob man „den Pfaff nicht aus der Schule hinausschmeißen könnte“. Der Direktor verneinte dies mit dem Hinweis, dass Pfaff der beste Schüler sei, den man seit geraumer Zeit gehabt hätte.
Dennoch rief er mich zu sich: „Pfaff, ist Ihnen bewusst, dass es ein Privileg ist, dass Sie als Zugereister überhaupt in einem österreichischen Gymnasium lernen dürfen? Sie sollten sich dankbar verhalten und solche Aktivitäten wie Tanzabende ohne Aufsicht von Erwachsenen unterlassen!“
Ob gerechtfertigt oder nicht: Ich empfand seine Worte als höchst ungerecht. Was konnte ich dafür, dass meine Familie aus Ungarn vertrieben worden war? Und warum sollten ÖJB-Veranstaltungen ohne Aufsicht von Erwachsenen möglich sein, aber Tanzabende nicht? Ich ließ mich nicht von meinen Aktivitäten abbringen, hegte nun aber einen Groll gegenüber dem Tanzlehrer und auch gegenüber Direktor Christl. Jahre später erst, anlässlich eines Klassentreffens, gingen wir beide aufeinander zu und ebneten den Weg für einen freundlichen Umgang.
Ein drittes Beispiel: Bedingt durch meine harte körperliche Arbeit, sowie meine Interessen und Pläne kamen mir viele Aktivitäten der Mitschüler kindisch vor. Ich sagte zu ihnen: „Ihr könnt eure Schlachten mit dem Werfen von Apfelbutzen unter euch austragen. Lasst mich bitte dabei in Ruhe!“ Eines Tages traf mich in der Pause ein Apfelbutzen voll ins Gesicht, während ich im Klassenzimmer saß und las. Aufblickend erkannte ich aus dem hämischen Grinsen meines Mitschülers Gerhard Gruber, dass er der Werfer gewesen sein musste. Ich stand auf und gab ihm eine schallende Ohrfeige. Dann ging ich in Richtung meines Platzes zurück. Für mich war die Angelegenheit erledigt, weil angemessen: Ohrfeige gegen Apfelbutzen!
Plötzlich riefen mir einige Mitschüler zu: „Pass auf! Dreh dich um!“ Ich tat dies keinen Augenblick zu früh: Mein Kontrahent stand hinter mir, mit verzerrtem Gesicht, einen Sessel hoch erhoben, im Begriff, mir diesen von hinten über den Kopf zu schlagen. Was dann folgte, ging sehr schnell: Ich ergriff mit der linken Hand den Stuhl und zog ihn herunter, seitlich an mir vorbei. Dann folgte ein kurzer Boxkampf – linker Haken, rechte Gerade. Seine Nase war gebrochen und blutete. Ich hatte keineswegs die Absicht gehabt, ihm die Nase zu zertrümmern.
Dies bestätigte die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ans Jugendschöffengericht: „Nunmehr stellte Pfaff seine Angriffe gegen Gruber ein und begab sich auf seinen Sitzplatz zurück. Gruber folgte ihm jedoch in der Absicht, ihn zur Rede zu stellen. Nunmehr trat … [Wolfgang] Dellisch zwischen die beiden Streitenden und eröffnete ihnen, dass er der Schleuderer des Apfelbutzens gewesen sei. Pfaff riet daraufhin dem Gruber, er möge die von ihm erhaltene Ohrfeige an Dellisch weitergeben. Tatsächlich schlug Gruber zu und traf Dellisch ins Gesicht, wodurch dieser eine Schwellung der Oberlippe davontrug.“
Merkwürdigerweise war kein Hinweis auf den beabsichtigten Angriff Grubers mit dem Sessel von hinten oder auf den defensiven Charakter meiner Antwort zu lesen. Wir wurden beide verwarnt, aber nicht verurteilt. Sonst hätte ich als vorbestraft gegolten – mit erheblichen Konsequenzen für meinen weiteren Lebensweg.
Jedenfalls machte mich dies nicht populärer bei den Lehrern, zumal Grubers Vater Lehrer an unserem Gymnasium war. Bei meinen Schulkollegen aber stiegen meine Aktien gewaltig: Hatte ich vorher noch Akzeptanzprobleme bei einigen, weil ich als Quereinsteiger die etablierte Hierarchie infrage stellte, wurde ich fortan als einer der Anführer akzeptiert. Meinem Kontrahenten gegenüber hegte ich jedenfalls keinerlei Groll. Sicher fühlte er sich in seiner Führungsposition herausgefordert und handelte, wie er glaubte, handeln zu müssen.
Im letzten Jahr meines Gymnasiumbesuches wollte ich möglichst schnell einen Führerschein für Motorrad und Auto erwerben. Die Kosten für die praktische Ausbildung waren erheblich. Ich fragte den Fahrlehrer: „Ab wie viel Personen würden Sie einen Rabatt gewähren?“
Seine Antwort: „Ab zehn Personen kann ich einen ordentlichen Nachlass gewähren!“ Also machte ich mich daran, unter meinen Klassenkameraden und deren Verwandten neun weitere Fahrschüler zu finden. Es gelang!
Mein Ziel, nach der Reifeprüfung nach Indien zu fahren, hatte ich fest im Blick. Wenn mich mein Vater nicht zur Mitarbeit im Wald verpflichtete, verwendete ich fast jede freie Minute, um Geld zu verdienen: Ich gab Nachhilfestunden in Latein, Mathematik, Deutsch und Englisch. Bald sprach sich das herum, und ich brauchte mir über Kunden keine Sorgen zu machen. Mit meinem Vater handelte ich aus, dass ich einen Teil der Erlöse aus unserer gemeinsamen Pechertätigkeit für meine Reisepläne verwenden könnte.
Als Hilfsarbeiter am Bau verdiente ich am meisten. Auf dem Bauplatz herrschten raue Sitten: Flasche um Flasche Bier wurde getrunken, schlüpfrige Witze über Frauen erzählt, und der grobschlächtige Polier glänzte durch Herrschaftsgehabe. Über mich, den Gymnasiasten, machte er sich häufig lustig.
Irgendwann war meine Geduld am Ende. Ich weiß nicht, was genau er gesagt hatte, aber ich packte eine leere Bierflasche, schlug an einem Ziegelstein den Boden ab und marschierte, die Flasche wie ein Messer in der Hand, auf ihn zu. Bevor es zu einer Tätlichkeit kommen konnte – und dazu war ich absolut bereit –, rief er mir zu: „Schon gut! Ich wollte dich nur testen! Ich werde keine Witze mehr über dich machen! Versprochen!“ Und von da an war Ruhe auf dem Bauplatz. Dennoch: Stolz bin ich auf diese Geschichte nicht – es hätte auch alles ganz anders ausgehen können!
Zu behaupten, dass meine Eltern entsetzt waren über meine Absicht, auf dem Landweg nach Indien zu fahren, wäre eine Untertreibung. Es spricht für sie, dass sie mir trotz ihrer Ängste keine Hindernisse in den Weg legten.
Mein Plan war im Prinzip einfach: Ich wollte mir ein Motorrad kaufen, auf dem Landweg nach Indien fahren und dort das Motorrad wieder verkaufen, um Mittel für weitere Unternehmungen zu gewinnen.
Heute weiß ich, wie verwegen der Plan war. Das wurde mir so richtig bewusst, als unsere Tochter Maya beschloss, nach dem Abitur ein Jahr lang durch Thailand, Indien, Neuseeland und Australien zu reisen.
Irgendwo las ich damals, dass zwei junge Männer aus Deutschland schon per Motorrad nach Indien gefahren waren. Also musste meine Reise eine größere Herausforderung werden: Es sollte ein Roller sein! Mein Auge war auf einen KTM Mirabell gefallen. Als ich schließlich das Geld zusammenhatte, fuhr ich am 17. Juli 1957 zur KTM-Fabrik nach Mattighofen, um den Roller mit einer Zusatzausrüstung versehen zu lassen, die ihn wüstentauglicher machen sollte.
Ich erinnere mich noch an die staunenden Blicke der KTM-Vertreter: „Muss es unbedingt ein Roller sein? Wäre nicht ein Motorrad – eine Geländemaschine – besser geeignet?“
Doch ich kaufte den Roller, rüstete ihn für die Fahrt aus: ein besonderer Luftfilter gegen den Wüstenstaub, robuste Reifen, ein stärkerer Gepäckträger, ein Auspuffeinsatz zur Lärmdämmung. Außerdem wollte ich einen Satz notwendiger Ersatzteile mitnehmen, zum Beispiel Sicherungen und Kolbenringe. Zudem kaufte ich Packtaschen, ein Zelt, einen Schlafsack und einen Spirituskocher, Geschirr, eine Plastikflasche für Wasser und eine Zeltbeleuchtung. Darüber hinaus investierte ich in einen Sprachführer für Arabisch, Routenpläne und ein Verzeichnis von Campingplätzen.
Mein Vater gab eine Zollgarantie beim ÖAMTC für mich ab. Ich wurde beim Ergänzungskommando des Österreichischen Bundesheeres in Wien in der Breitenseer Kaserne vorstellig, um meine vorher gegebene Bereitschaft zum freiwilligen Einrücken schon mit achtzehn Jahren zurückzunehmen: Zum Wehrdienst verpflichtet war ich erst mit neunzehn Jahren. Bei der Musterung wurde ich der Infanterie – den Landjägern in Wiener Neustadt – zugeteilt. Einrücken sollte ich am 15. Oktober 1957.
Aber es kam anders als geplant. Vielleicht hielt ein gütiger Schutzengel die Hand über mich? Damals, im Jahr 1957, mussten sich österreichische Staatsbürger für Indien ein Visum in der indischen Gesandtschaft in Wien (erst später wurde es eine Botschaft) ausstellen lassen. Hierfür war die Unterschrift meines Vaters erforderlich, da ich mit achtzehn Jahren noch minderjährig war. Zögerlich leistete mein Vater die Unterschrift auf dem Antragsformular.
Ich reiste am Dienstag, dem 23. Juli 1957, nach Wien, zur indischen Gesandtschaft. „Bitte, warten Sie fünfzehn Minuten! Ihr Visum ist dann fertig.“ Ich nahm auf einem bequemen Stuhl des Wartezimmers Platz. Meine neugierigen Blicke schweiften über die ausgestellten Bilder und Skulpturen aus Indien, die alte Tempel, Monumente und die ewig jungen Berge Indiens darstellten.
„Herr Pfaff, ein indischer Pater hat von Ihnen gehört und möchte gerne mit Ihnen sprechen. Haben Sie etwas dagegen?“, unterbrach der indische Diplomat meine Gedanken.
Ehe ich noch meine Bereitschaft zum Ausdruck bringen konnte, sah ich ihn schon auf mich zukommen: Ein Inder im mittleren Alter, im schwarzen Talar, der ihn als Priester kennzeichnete, von einem Angestellten der Gesandtschaft an der Hand geführt. Ein kaffeebraunes Gesicht mit einem langen schwarzen Vollbart, der ihm eine besondere Würde verlieh. Dunkle Gläser saßen auf einem fein gerundeten Nasenrücken, was ihm ein geheimnisvolles und edles Aussehen gab. Warum wurde er so vorsichtig in den Raum hereingeführt?
„Mein Name ist Father Abraham“, stellte er sich in englischer Sprache vor, mit einer Stimme, die jedermann hätte aufhorchen lassen. Schon beim ersten Treffen fiel mir auf, dass er die Gabe besaß, den Raum mit seiner Persönlichkeit, wie ein Schauspieler auf der Bühne, sofort auszufüllen.
„Martin Pfaff mein Name“, sagte ich aufstehend, etwas mühsam, auf Englisch und schüttelte die dargebotene Hand.
„Ich höre, dass Sie nach Indien fahren wollen“, setzte er fort. „Was wollen Sie dort tun?“
Ich hatte schon von der indischen Offenherzigkeit und regen Anteilnahme am Leben völlig fremder Menschen gehört. „Hauptsächlich will ich Indien sehen … ich habe so viel darüber gelesen. Und dann … ich bin an den indischen Religionen und an indischer Philosophie interessiert …“
„Haben Sie die Absicht, nach Südindien zu gehen?“
„Nein. Ich will nur Nordindien besuchen – Delhi, die Ashrams im Himalaya sowie Kalkutta und Bombay“, erklärte ich.
„Dann versäumen Sie aber viel.“ Sein Begleiter half ihm, in einem der Sessel Platz zu nehmen. Ich setzte mich auch. „Sie dürfen Südindien nicht auslassen! Nicht nur, weil ich aus Südindien komme und meine Heimat in Kerala ist,“ fügte er mit verschmitztem Lächeln hinzu, das alle Anwesenden ansteckte.
„Aber ich habe nicht allzu viel Zeit!“
„Dann muss ich Ihnen ehrlich sagen, dass Sie besser gar nicht nach Indien fahren sollten“, entgegnete er lächelnd. „In kurzer Zeit können Sie nicht viel von Indien sehen, noch weniger Indiens Religionen, seine Philosophie und seine Probleme verstehen!“
„Ich muss mich eben damit zufrieden geben!“
„Sie scheinen mir nicht der Mann zu sein, der sich so leicht zufrieden gibt!“ Wieder ein Lächeln. „Ich habe von dem indischen Diplomaten von Ihrer Hartnäckigkeit gehört, mit der Sie ums Visum ansuchten. Und ich habe von Ihren Ideen gehört.“
Allmählich machte mich der Mann wirklich neugierig. „Darf ich wissen, was Sie hierher nach Wien geführt hat?“
Mittlerweile hatte er ein Zigarettenetui aus der Tasche genommen. Er zündete auf ungewöhnliche Weise seine Zigarette an, indem er Zigarette und Zündholz in einer Hand hielt. Den vorstehenden Zündholzkopf strich er an der Zündholzschachtel entlang und sog an der Zigarette, bis das Feuer vom Zündholzkopf das Zigarettenende entflammt hatte.
„Ich will einige Ärzte konsultieren … Ich bin aus Amerika gekommen, wo ich an der Universität Boston studiert habe. Auf meiner Heimreise Richtung Indien war ich in London und Rom. Wissen Sie, Wien ist wegen seiner Ärzte berühmt.“
Er tastete an dem kleinen Teetischchen an seiner Seite herum, ohne hinzusehen. Seine Hand strich über die polierte Oberfläche, bis sie einen Aschenbecher berührte. Er nahm ihn in seine Hand und legte das Zündholz darauf.
Jäh schoss es mir durch den Kopf. War das möglich? Und dann verstand ich auf einmal sein sonderbares Benehmen. „Entschuldigen Sie, Father Abraham, können Sie nicht sehen?“
„Nein,“ sagte er leise, „ich bin sehbehindert …“
Meine lebhafte Neugier schlug in tiefes Mitleid um.
„Seit wann?“
„Seit fünfzehn Jahren … Die Ärzte sagen, es sei ein Hirntumor. Ich habe mich aber nicht unterkriegen lassen!“
„Ja, das sehe ich. Ich hätte es zuerst nicht geglaubt … Aber sagen Sie, wie konnten Sie an einer Universität studieren?“
Er lachte laut: „Das ist gar nicht so schwer: Erstens haben wir das Braillesystem, die Blindenschrift, und können Aufzeichnungen über die Vorlesungen machen. Zweitens haben wir Magnetofone, mit denen wir Vorlesungen festhalten und zu Hause zurückspielen. Junge Leute lesen uns die vorgeschriebenen Bücher vor.“
„Aber wie schreiben Sie denn die Prüfungen?“
„In Amerika sprach ich die Antworten bei den Prüfungen der Universität Boston auf ein Tonband. Dies wurde dann bewertet. Oder ein Schreiber wird uns zur Verfügung gestellt und wir diktieren die Antworten …“
„Ich bin beeindruckt! Wenn all dies möglich ist, kann den Blinden geholfen werden.“
„Nicht nur geholfen“, sagte er mit tiefer Überzeugung. „Die Blinden können Berufe erlernen, ihren Unterhalt verdienen, eine Familie gründen. Kurz und gut, die Blinden können ein völlig normales Leben führen, vorausgesetzt …“
„Was?“
„Vorausgesetzt, dass ihnen die Möglichkeit geboten wird.“
„Ich glaube, dass hier in Österreich, in Deutschland, in England usw. die Regierungen Institute eröffnet haben. Wir in Wien haben einige Schulen. Die Kriegsblinden haben Schulungskurse, und nachher arbeiten sie …“
„Ja, in Europa und in Amerika. Aber im Großteil der Welt, wo es sehr viel mehr Blinde gibt als hier, geschieht fast gar nichts. Es gibt nur wenige Schulen und sehr wenige Ausbildungsmöglichkeiten.“
„Und in Indien?“
„In Indien haben wir über zwei Millionen Blinde. Nicht einmal ein Zehntel hat eine Schulbildung oder Ausbildung, sehr wenige finden eine Anstellung.“
„Aber kann denn gar nichts für sie getan werden? Die Regierung …“
„Indien ist ein Entwicklungsland. Die Regierung hat viele andere Sorgen. Sie muss diesen Menschen zur Hilfe kommen, aber zuerst müssen wir einen Anfang machen. Die Menschen müssen die Regierung erziehen, sie müssen klarmachen, dass die Blinden studieren und arbeiten können. Ich bin von unserer Regierung als Austauschstudent nach Amerika geschickt worden: Ich habe einen Fortgeschrittenenkurs zur Erziehung der Blinden an der Perkins Institution for the Blind bei Boston besucht und zugleich an der Universität Boston studiert. Nun kehre ich nach Indien zurück, um meine weiteren Pläne zu verwirklichen.“
„Ich nehme an, dass Ihnen Ihre Regierung die nötigen Mittel zur Verfügung stellen wird.“
„Ganz und gar nicht! Ich beabsichtige, eine private Schule zu eröffnen. Wenn ich warte, bis die Regierung mir Mittel zur Verfügung stellt, wird es sehr lange dauern.“
„Dann müssen Sie über sehr große Mittel verfügen.“
„Ja und nein! Zur Zeit besitze ich fast gar nichts. Doch Gott wird dafür sorgen! Die Reichtümer der ganzen Welt gehören ihm. Und wenn wir an seine Vorsehung glauben, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.“
„Wir Europäer haben da wohl eine eher skeptische Weltanschauung …“
„Weil ihr an eure eigenen Fähigkeiten glaubt“, unterbrach er mich schnell. „Deswegen werdet ihr Enttäuschungen erleben. Ihr müsst euch als Seine Werkzeuge betrachten!“
„Ich gestehe, dass Ihre Worte bei mir mitten ins Schwarze treffen … Wann wollen Sie Ihr Werk für die Blinden beginnen?“
„So bald wie möglich! Die Ärzte sagen, dass eine Gehirnoperation nötig sein wird, um die Ursache meiner Sehstörung zu beseitigen.
Dabei kann ich gelähmt werden oder die Sprache verlieren und vieles mehr. Deswegen will ich eine Blindenanstalt eröffnen, bevor diese Operation nötig ist.“ Und leise fügte er hinzu: „Falls ich sie nicht überlebe, habe ich wenigstens mein Werk begonnen und den Stein ins Rollen gebracht …“
„Ihr Mut imponiert mir sehr!“, entgegnete ich. „Ihr Glaube ist vielleicht das, was uns hier fehlt, was viele Berge versetzen könnte. In den menschlichen Beziehungen und in den Beziehungen der Völker an dieser gefährlichen Weggabelung der Weltgeschichte.“
„Sagen Sie mir doch“, entgegnete Father Abraham nach einer kurzen Pause, „wann und wie Sie nach Indien reisen wollen.“
„Ich bin hierhergekommen, um mein Visum für Indien abzuholen“, sagte ich. „In zwei Wochen plane ich abzureisen. Ich beabsichtige, mit einem Roller zu fahren, und werde ihn in den nächsten Tagen von der Fabrik abholen.“
„Sehr abenteuerlich! Warum auf dem Landweg?“
„Ich möchte viele Länder besuchen, von denen ich im Gymnasium gehört habe.“
„Sehr gut!“, sagte Father Abraham. „Können Sie mich mitnehmen? Ich will auch einige Blindenschulen in Europa und im Nahen Osten besuchen.“ Ich war total verblüfft und fragte zunächst: „Warum? Haben Sie nicht in Amerika gute Schulen gesehen?“
„Zu gute Schulen! Die elektrischen Geräte, die dort verwendet werden, sind in Indien entweder nicht erhältlich oder unerschwinglich. Deshalb will ich sehen, wie die Schulen in den Entwicklungsländern ihre Aufgabe erfüllen.“
„Ihre Absicht kann ich nachvollziehen. Aber wie können Sie auf einer so beschwerlichen Fahrt auf einem Roller sitzen? Es ist eine große Anstrengung, die ich, ehrlich gesagt, nur jungen Leuten zutraue!“
„Sie haben recht“, entgegnete er nach einigem Nachdenken. „Doch könnten wir die Reise nicht gemeinsam im Auto machen? Haben Sie einen Führerschein?“
„Ja, den habe ich. Aber haben Sie ein Auto?“, fragte ich.
„God will provide – Gott wird dafür sorgen“, sagte er lakonisch.
„Das klingt ja gut“, lächelte ich. „Unser Zusammentreffen ist wirklich ein sonderbarer Zufall.“
„Nichts geschieht durch Zufall“, war die Antwort. „Alles ist in Seinem Plan vorgesehen!“
Einem solch verwegenen Vorschlag, wie ihn Father Abraham gemacht hatte, konnte ich nicht widerstehen. Ich lud ihn zu meinen Eltern ein, damit wir uns besser kennenlernen konnten.
Reverend Father Abraham erzählte seine Geschichte: Wie er als Priester der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Malabar arbeitete und heiratete. Mit seiner inzwischen verstorbenen Frau hatte er eine Tochter. Später war er als Militärkaplan bei den Britisch-Indischen Truppen tätig gewesen, von denen etliche Christen waren und aus Kerala kamen.
Durch einen Hirntumor hatte er sein Augenlicht verloren, in Indien im Trainingszentrum in Dehra Dun Blindenerziehung studiert und seine Studien an der Perkins School for the Blind in Boston fortgesetzt. Und jetzt wollte er mit mir auf dem Landweg nach Indien fahren.
Tatsächlich wurden ihm die Mittel zum Kauf eines Autos geschenkt. Am 2. September 1957 war es so weit: Father Abraham kaufte einen gebrauchten dunkelbraunen Volkswagen, Baujahr 1952, mit geteilten Heckscheiben und Blinkern, die ausklappten wie die Flügel einer Ente. Die deutsche Zollnummer auf dem Nummernschild war 188-Z-4090. Ein flacher Bodenpanzer – für die Wüste gut geeignet. Dazu ein luftgekühlter Heckmotor, der im Vergleich zu späteren Modellen einfach zu bedienen war: Den Vergaser reinigen oder die Zündung einstellen konnte sogar ich mit meinen „zwei linken Händen“.
Wir reisten nach Wolfsburg, um einen Austauschmotor (ein Geschenk des Volkswagenwerks, konkret von dessen Chef, Professor Dr. Heinrich Nordhoff) einbauen und einige Reparaturen durchführen zu lassen.
Auf dem Weg nach Süden machten wir einen Zwischenstopp in Mannheim. Dort lernten wir eine Schwester – Mutter Maria Odile aus Indore, Indien – kennen, sowie ihre Verwandten, die Mannheimer Familie Isele. Die Mitglieder der Familie Isele waren von Fathers Plänen zum Aufbau einer Blindenschule in Südindien sehr angetan, auch von meiner Bereitschaft, mit ihm nach Indien zu fahren. Und sie sagten ganz spontan zu mir: „Wenn du das machst, dann kannst du bei uns umsonst so lange wohnen, bis du dein Studium an der Universität Heidelberg absolviert hast!“
„Danke, danke! Aber ich habe andere Pläne nach meiner Indienreise!“, erwiderte ich. Das generöse Angebot der Familie Isele war für mich erstaunlich – so viel Anteilnahme an Fathers Plänen, so viel Vertrauen in mich, dass ich ihn wohlbehalten nach Indien bringen würde! Jahrzehnte später fand ich im Nachlass meiner verstorbenen Eltern zwei Schreiben, die Franz Isele am 6. Oktober sowie am 13. November 1957 an meine Eltern geschickt hatte. Sie zeigten die religiöse Motivation für sein Handeln: „Martin wollte ja mit dem Roller nach Indien fahren. So tut er ein gottgefälliges Werk, indem er sich des fast blinden und schwerkranken Priesters annimmt. Sie können ja auf Martin sehr stolz sein; denn wir haben in unserem langen Leben noch kaum einen so charaktervollen und selbstlosen jungen Menschen kennengelernt. Möge der liebe Gott geben, dass die beiden wohlbehalten in Indien ankommen. Unser Gebet begleitet die beiden.“
Ich hoffe jedenfalls, dass der Brief für meine Eltern eine Stütze war, machten sie sich doch genügend Sorgen um mich.
Dann ging es wieder zurück zu meinem Elternhaus. Hier rüsteten wir uns für die Fahrt durch entlegene Gebiete. Bei Semperit in Traiskirchen erhielten wir Ersatzreifen und passende Schläuche. Ich ließ noch meine Zähne richten, die diversen Schutzimpfungen hatte ich schon vorher bekommen.
In einem längeren Gespräch, an dem auch meine Eltern beteiligt waren, wandte sich Father an mich: „Martin, warum denkst du nicht darüber nach, in Indien zu studieren? Wir haben gute Colleges und Universitäten – das wäre eine Chance!“
„Ich habe mich bereits entschlossen, in Wien im Herbst 1958 mein Studium zu beginnen.“
„Nimm jedenfalls dein Abschlusszeugnis mit, damit du die Option hast für ein Studium in Indien. Wäre das nicht klüger, als es gleich auszuschließen?“
Ich musste ihm recht geben. Meine Eltern stimmten wohl mit gemischten Gefühlen zu. Noch während meiner langen Fahrt nach Indien erkundigten sie sich über meine Chancen, mit dem Studium zu beginnen. Und in mehreren Briefen versuchte ich, ihre Sorgen zu zerstreuen, war ich doch selbst absolut überzeugt, dass ich mich durch ein universitäres Studium in Europa für den Lebensweg besser würde wappnen können.
Im letzten Schuljahr hatten wir an einem Test über unsere Fähigkeiten, Potenziale und Intelligenz teilgenommen. Zu mir sagten die Psychologen: „Über Ihre Intelligenz brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen!“ Einen IQ nannten sie mir nicht – auch nicht meinen Schulkollegen. Vielmehr zeigten sie uns eine bildhafte Darstellung in Form eines Balkendiagramms. Ich habe es damals schnell in meinen Jahreskalender skizziert, und es liegt mir heute vor. Ich bin verblüfft, wie sehr es meiner eigenen Einschätzung entspricht: Am schwächsten waren manuelle Fähigkeiten und musikalische Begabung ausgebildet – Ersteres trifft exakt zu, Letzteres verwundert mich, da ich zum Musikliebhaber geworden war. Im Mittelbereich der Balkenlandschaft finde ich soziale Fertigkeiten und künstlerische Fähigkeiten. Am besten schneide ich ab bei kaufmännischen, wirtschaftlichen und politischen Fähigkeiten, gefolgt von Sprachen, Verwaltung und Wissenschaft.
Meine Mitschüler glaubten, dass ich wohl Jura studieren würde, da ich „so gut reden kann“. Mir aber schien das Fach Recht zu länderspezifisch und nicht international genug orientiert zu sein. Ich wollte an der Hochschule für Welthandel – inzwischen Wirtschaftsuniversität – in Wien mein Studium beginnen. Wie der folgende Bericht zeigt, sollte es anders kommen.
Im Prozess des Aufwachsens in Österreich war ich vom Reagierenden zum Suchenden geworden. Ich wusste aber weder, was ich suchen wollte, noch welche Ziele und Wege ich mit dieser Suche verband. Ich fasste einen Plan, um mir Schritt für Schritt mehr Gewissheit zu schaffen. All die Aktivitäten und Abenteuer, die Wege über vielgestaltige Grenzen, waren Schritte auf dem Weg zu mir selbst. Und alle Prüfungen, denen ich mich unterzog, sollten dazu dienen, meine eigene Identität zu suchen und mein Innerstes in der als problematisch empfundenen Welt zu finden.
Die innere Unsicherheit über Lebensziel und Lebensweg kleidete ich – als Achtzehnjähriger – in einige Zeilen freier Verse. Die Bezeichnung „Gedicht“ wäre wohl zu hoch gegriffen. Es ist jedenfalls, der römischen Auffassung folgend, ein Anruf zu meinem Schutzgeist (Genius). Die humanistische Ausbildung hatte offensichtlich ihre Spuren hinterlassen.
Wer lieber in Begriffen des jüdisch-christlichen anstatt des griechisch-römischen Strangs unserer westlichen Kultur denkt, kann anstelle des persönlichen Schutzgeistes den Begriff „Schutzengel“ setzen. Und wer mit beiden Probleme hat, kann die Dialoge als ein Zwiegespräch mit mir selbst interpretieren. Im Endeffekt ist es eine kritische Bestandsaufnahme, wie ich sie im Lauf meines Lebensweges öfters vorgenommen habe: Stimmt die Richtung? Wie weit bin ich gekommen? Wie und wo soll es weitergehen?
Die anvisierten Alternativen spiegeln meine bisherigen Lebenserfahrungen wider, mein Interesse an künstlerischer Tätigkeit und meine Träume über einen persönlichen Beitrag zur Vermeidung künftiger Kriege und zur Völkerversöhnung, wohl erreichbar durch politisches Engagement. Oder ein Leben der Entsagung weltlicher Genüsse, auch der irdischen Liebe, und der Hingabe an ein Leben für die Schwächsten der Gesellschaft.
Fragen ohne Antwort …
1 Der Durst des Genius brennt in meinen Adern heiß; wann, ach wann, wird der Glutstrom seinen Weg und mir Erfüllung finden?
2 Ein Leben künstlerischen Schaffens – kann das Werk des Staubes spiegeln der Gedanken Flug und die Schönheit der Natur?
3 Zeigt der Stab des Schicksals zur schweren Bürde hoher Sendung, der Völkerversöhnung und des Friedens dornenreicher Lebenspfad?
4 Oder liegt des Traumes Schlüssel im Blumenbeete der Entsagung, des Opfers und des Mitleids wundenlindernder Mission?
5 Auf der Suche nach der Antwort, am Scheideweg der Pilgerfahrt, winkt das Kartenhaus des rationellen Westens. Und auch das mystische Dunkel unter’m Banianbaum.
6 Die Asphaltstraße konventionellen Denkens, führt sie wirklich schneller, als der Millennien überwucherte Pfad zum heißersehnten Ziele hin?
7 Oder ist sie nur ein Teil des hypnotischen Kreises, der in sich selbst zurück mich führt, und der Pfad, ist er der Weg ins düstre Dunkel ohne Wiederkehr?
8 Das Echo dieser Fragen, schallt hohl von beiden mir zurück. Mein Genius, ich beschwöre dich, gib mir Antwort, Frucht und Licht!
Manches Mal, wenn ich im Halbschlaf vor mich hindämmerte, oder oben auf dem Felsen im schönen Helenental vor mich hinträumte, führte ich ein Zwiegespräch mit meinem Schutzgeist:
„So sag mir doch gleich, mein Genius, welchen dieser Wege ich gehen soll – du würdest mir sehr viel Zeit, Unsicherheit und Mühe ersparen!“
„Aber nein! Ich will dir doch nicht Zeit und Mühe ersparen! Denn dann wäre die Spannung, die Anstrengung der Suche, weg! Dein Leben wäre viel eintöniger. Bedenke: Der Weg ist das Ziel! Also: Du musst deinem Leben schon selber Sinn geben, denn darin besteht deine Freiheit! Und diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen, auch ich nicht!“
„Wenn du mir schon den genauen Weg nicht verrätst, den ich gehen soll: Sag mir wenigstens, ob ich ein ruhmreiches Leben oder aber ein glückliches Leben anstreben soll!“
„Aber, aber … Die Antwort hast du dir doch schon vor einigen Jahren selbst gegeben! Als du vom Idealbild des Achilles und des Alexander Abschied nahmst! Weil man vom Ruhm nichts hat, wenn man schon in jungen Jahren tot ist! Denn du musst wissen: Wenn du dein persönliches Glück suchst, musst du einen Preis dafür zahlen! Wenn du dagegen den Erfolg mit allen Fasern deines Herzens begehrst, musst du bereit sein, auf vieles zu verzichten, was Menschen glücklich macht!“
„Aber Genius, geht nicht beides?“
„In deinem Leben jedenfalls wohl kaum! Nachdem du schon in jungen Jahren so viel Ungemach und Unglück erleben musstest, kommst du jetzt gar nicht umhin, nach dem Glück zu suchen!“
Mein Schutzgeist schickte sich an, mich zu verlassen.
„Genius, sehe ich dich wieder?“
„O ja! Denn du sollst verstehen: Wer seinen Schutzgeist einmal anruft, muss damit rechnen, dass dieser in Zukunft von selbst wieder kommt. Auch wenn er nicht gerufen wird. Und unbequeme Fragen stellen wird, über die Richtung, die dein Leben genommen hat!“
„Aber beantwortest du dann meine Fragen etwas klarer, als du es gerade getan hast?“
„Vielleicht … vielleicht! Aber besser noch: Ich werde dich anregen, selber Fragen zu stellen! Denn eine gut gestellte Frage enthält schon den Keim einer Antwort!“
„Genius, das klingt aber sehr mysteriös!“
„O ja! Du sollst jetzt schon erkennen, dass das Leben oft ein Rätsel ist, das sich erst im Lauf der Dinge entschlüsseln lässt … du wirst schon sehen!“
So ganz konnte ich diese Antwort nicht akzeptieren. Lag es daran, dass ich mir mit meinen achtzehn Jahren gar nicht vorstellen konnte, was denn genau das persönliche Glück beinhalten sollte? Oder wie ich es durch eigenes Handeln erreichen konnte?
Die Antwort auf diese Fragen sollte mir das Leben selbst geben – und dies oft erst nach Jahren der Suche …