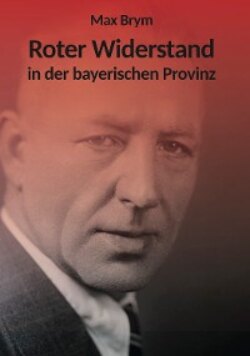Читать книгу Roter Widerstand in der bayerischen Provinz - Max Brym - Страница 9
Zur Neuzeit und zu dem sich entwickelnden „roten Burghausen“. Im Chemiedreieck
ОглавлениеAls „Bayerisches Chemiedreieck“ wird der Raum zwischen Trostberg, Töging am Inn und Burghausen an der Salzach in Südostoberbayern bezeichnet. Inmitten des landwirtschaftlich geprägten Raumes entstanden vor dem Ersten Weltkrieg wichtige Produktionsstätten elektro-chemischer Art. Dabei wurden die Wasserkräfte der Flüsse Alz und Inn genutzt. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 kam der Trostberger Produktion für die Kriegswirtschaft eine besondere Bedeutung zu. Kalkstickstoff wurde als Vorprodukt für die von den Munitions- und Pulverfabriken benötigte Salpetersäure genutzt. Während des Ersten Weltkriegs erfolgte im Chemiedreieck die Errichtung einer weiteren Karbidfabrik der Bayerischen Stickstoffwerke in Hart, die Gründung der „Innwerk Aluminium KG“ sowie der beschleunigte Ausbau der „Alexander Wacker-Werke“ in Burghausen.
Die Oberste Heeresleitung unter General Erich Ludendorff sponserte für die Werksgründungen und Erweiterungen viel Geld. Heute ist auf der Website der Wacker-Chemie dazu zu lesen: „Mitten im Ersten Weltkrieg nimmt die Fabrik mit 450 Mitarbeitern ihren Betrieb zur Herstellung von Aceton aus Essigsäure auf. Aceton war plötzlich kriegswichtig geworden, da man es für die Herstellung von Kunstgummi verwendete, um damit die Batterien von U-Booten abzudichten. Der Ausgangspunkt für den Aufstieg zu einem internationalen Chemieunternehmen war gesetzt.“ Ergo garantierten der Krieg und der Massenmord besonders hohe Profitraten. In der Weimarer Republik wurde der Aufbau der im Ersten Weltkrieg projektierten Werke abgeschlossen. Wichtig für die Produktion sind die Elektrizitätswerke „Alzwerk“ und „Innwerk“.
Seit Februar 1933 spendete die Wacker-Chemie nur noch Gelder an die NSDAP. Die „Parteispenden“ an die „Bayerische Volkspartei“ BVP wurden eingestellt. Mit der Zerschlagung der organisierten Arbeiterbewegung und der unter Göring (Vierjahresplanbehörde) einsetzenden Förderung der massiven Kriegsproduktion stiegen die Profite von Wacker gewaltig an.
Zwischen 1929 und 1933 war der Umsatz der Wacker-Chemie um rund 30 % gesunken. Die Nazis schätzten nahezu alle Betriebe von Wacker-Chemie nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 als kriegswichtig ein. Wacker-Chemie war damit in der Lage, weiterhin chemische Grundstoffe wie Acetaldehyd, Essigsäure oder chlorierte Lösungsmittel zu produzieren. Besonders wichtig war in dieser Zeit die Herstellung hochwertiger Metalllegierungen wie Ferrochrom oder Ferrosilicium in den damaligen Wacker-Werken Mückenberg und Tschechnitz. Im Zweiten Weltkrieg schufteten für Wacker auch Tausende von Zwangsarbeitern. „Fremdarbeiter“ ersetzten rund ein Drittel der in den Kriegsdienst einberufenen Stammbelegschaft. (Erst im Jahr 2000 beteiligte sich die Wacker-Chemie an einer Stiftung, welche der Zwangsarbeiter gedenkt. Das kostet wenig und fördert das Image.)
In der seit Ende den Zwanzigerjahren wöchentlich kostenlos erscheinenden Werkszeitung „Südbayerische Chemie“ vertrat die Wacker-Chemie zunehmend pro-nazistische Positionen.
In der Ausgabe Nr. 48 von 1931 schob die Wacker-Chemie alle Schuld an der Massenarbeitslosigkeit in Deutschland (in Wahrheit gab es eine weltweite kapitalistische Krise) den Siegermächten zu. Wörtlich ist zu lesen: „Unser Land wird versklavt, wir müssen uns in nationaler Geschlossenheit erheben.“ Das sagte den wenigen Nazis im Betrieb (u. a. dem Chemiker Dr. Zabel) zu, aber nicht den Arbeitern. Für die Arbeiter waren der Kapitalismus und damit einhergehend die Wacker-Chemie in Privatbesitz das Problem.