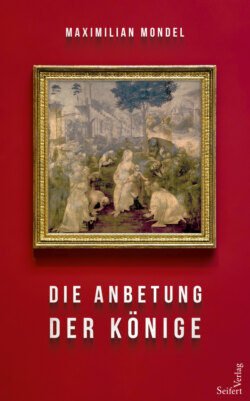Читать книгу Die Anbetung der Könige - Maximilian Mondel - Страница 16
EIN PERFEKTER ARBEITSPLATZ
ОглавлениеSeit rund zehn Minuten starrten die beiden nun auf das 246 x 243 Zentimeter große Bild. Weder der Mann, der sich Francesco nannte, noch Gabriele Schillaci machten Anstalten, die feierliche Stille an diesem April-Abend zu stören. Bevor die beiden das Bild vorsichtig aus der Transportkiste genommen und auf die vorbereitete Staffelei gestellt hatten, hatte Francesco einen Chianti Classico Riserva aus Lamole geöffnet, zwei Gläser eingeschenkt, und die beiden hatten sich zugeprostet. Die unterschiedlichsten Gedanken schossen Schillaci durch den Kopf. Vor allem aber stellte er sich die Frage, was wohl seine Aufgabe in Zusammenhang mit dem weltbekannten Gemälde sein werde.
»So könnte die ›Anbetung der Könige‹ tatsächlich einmal ausgesehen haben«, meinte Schillaci schließlich. »Wer immer diese Kopie angefertigt hat, versteht etwas von seinem Handwerk, vor allem, weil er die längst fällige Restaurierung des Gemäldes vorweggenommen hat.«
»In der Tat«, erwiderte Francesco, dessen Blick sich noch immer nicht von Leondardo da Vincis Meisterwerk gelöst hatte. Er strahlte über das ganze Gesicht. Jeden Quadratmillimeter des Gemäldes schien er mit seinen glänzenden Augen abzutasten.
Seit zwei Stunden war Schillaci nun bereits vor Ort, wobei der schlacksige Kunststudent keine Ahnung hatte, wohin ihn Franceso denn nun eigentlich gebracht hatte. Ein paar Tage zuvor hatte dieser ihn mit unterdrückter Telefonnummer angerufen und erklärt, dass er ihn am 5. April pünktlich um neun Uhr Vormittag am Flughafen in Bologna abholen werde, dass er sich auf einen Aufenthalt von zumindest drei Monaten einstellen und sein Umfeld entsprechend von einem Forschungsaufenthalt in Südamerika informieren solle.
Als Schillaci dann zum vereinbarten Zeitpunkt mit seinem Koffer vor dem Ankunftsbereich des Flughafens von Bologna wartete, fuhr ein fensterloser weißer Lieferwagen vor. Francesco saß am Steuer des Vans, wies ihn an, vorne einzusteigen und sich anzuschnallen, und reichte ihm, nachdem sie losgefahren waren, eine Flasche Wasser zur Erfrischung. Wenige Minuten später hatte ihn die Müdigkeit übermannt. Das Nächste, woran er sich erinnern konnte, war Francesco, der vor der geöffneten Beifahrertür stand, ihn anstupste und sagte: »Signore, wachen Sie auf! Wir sind da.«
Instinktiv blickte Schillaci auf seine Armbanduhr und sah, dass fast zwei Stunden vergangen waren, seit er in Bologna in den Van gestiegen war. Er griff in seine Jackentasche nach dem Smartphone. Es war nicht mehr an seinem Platz.
»Keine Sorge, ich habe es Ihnen vorsorglich abgenommen. Sie bekommen es wieder«, beschwichtigte Francesco, der Schillaci beobachtet hatte, und half ihm gleich darauf mit dem Gepäck. Schillaci war zu müde, um zu protestieren. Seine Augen gewöhnten sich nur langsam an das Tageslicht. Und schließlich hatte er noch ein zweites Mobiltelefon im Koffer.
Der Van parkte vor einem inmitten einer Gartenlandschaft gelegenen Haus, das – so erklärte ihm Francesco – in den nächsten Wochen seine Heim- und Arbeitsstätte sein würde. Schillacis Schlafzimmer lag im ersten Stock, gleich daneben befand sich das Badezimmer, und wenn er es richtig verstanden hatte, durfte er es sich auch in den unteren Räumen bequem machen, schließlich würde er das Haus für die Zeit seines Aufenthalts ganz alleine bewohnen.
»Richten Sie sich ein, verstauen Sie Ihre Sachen. In einer halben Stunde essen wir zu Mittag.« Und schon hatte Francesco die Fahrertür des Lieferwagens – eines Fiat Talento mit Hochdach – geschlossen, sich ans Steuer gesetzt und war davongebraust. Von dem Mittel, das man ihm offensichtlich verabreicht hatte, noch leicht benommen, blickte Schillaci dem weißen Van hinterher. Rund 20 Meter vom Haus entfernt, fuhr das Auto in eine Kurve und war wenige Sekunden später zwischen einigen Zypressen verschwunden. Exakt 30 Minuten danach stand hinter dem Haus auf einem hölzernen Gartentisch das Mittagessen bereit. Wie es dorthin gekommen war, wusste Schillaci nicht. Es war einfach da. Und es war gut.
Als Francesco wieder zurück war, aßen sie Panzanella und tranken Wasser und Weißwein – einen Capsula Viola von Antinori. Schillaci begann sich wohlzufühlen. Es war angenehm warm, und er hatte ein rundum gutes Gefühl. Allerdings fragte er sich langsam, welcher Auftrag nun eigentlich auf ihn wartete.
»Gemach, gemach, Signore Schillaci. Jetzt trinken wir noch einen Cappuccino, und dann zeige ich Ihnen Ihren Arbeitsplatz. Ich hoffe, dass er Ihnen gefallen wird. Und noch was: Bitte, bitte, verzeihen Sie meine kleinen Sicherheitsmaßnahmen. Sie werden sehen, dass sie zu Beginn einfach notwendig sind.«
Gabriele Schillaci war mit der Ausstattung des anscheinend eigens für ihn eingerichteten Ateliers mehr als zufrieden. Er hatte zwar seine eigenen Malereiutensilien mitgebracht, die würde er aber wohl gar nicht brauchen. Das im Keller seiner Unterkunft gelegene, über eine steinerne Treppe erreichbare Atelier ließ keine Wünsche offen: Mehrere mächtige Staffeleien waren aufgebaut, unzählige Farbtuben lagen bereit, Pinsel und Skalpelle in allen Größen harrten ihrer Verwendung. Francesco hatte an alles gedacht. An einer Wand stand ein Bücherschrank mit rund 40 Bänden einschlägiger Fachliteratur. Das Ganze erinnerte Schillaci an einen Malereibedarfsladen. Und wenn der Keller je modrig gewesen war, dann war ihm jetzt jegliche Muffigkeit ausgetrieben worden: Eine Klimaanlage sorgte für eine angenehme Temperatur, Abzugsrohre beförderten die verbrauchte Luft nach draußen, das Licht ließ sich stufenlos verstellen, und in der Ecke stand sogar eine Infrarotlampe für die Analyse verschiedener Farbschichten bereit. Hier würde es sich vorzüglich arbeiten lassen, überlegte Schillaci, die professionelle Ausstattung und die Aussicht auf das fürstliche Salär würden ihn über die paar Wochen in Einsamkeit und Abgeschiedenheit hinwegtrösten. Mit Francesco, den er für einen kunstsinnigen Experten und einen geradlinigen Zeitgenossen hielt, würde er gut auskommen, und dass dieser ihn eindringlich gebeten hatte, sich nur im Umkreis des Nebenhauses der Villa zu bewegen, bereitete ihm kein Kopfzerbrechen. Warum auch. Rund um das ihm zugewiesene Häuschen ließ es sich sicher gut leben, auch wenn es hier weder Fernseher noch Computer gab. Irgendwie kommt mir das alles wie ein bezahlter Urlaub am Land vor, schmunzelte Schillaci bei sich und schüttelte den Kopf. Francesco würde sich auf ihn verlassen können. Wieder und wieder vergegenwärtigte er sich dessen Worte:
»Signore Schillaci, malen Sie mir ein möglichst perfektes Abbild dieser Kopie der ›Anbetung der Könige‹! Ich will zwischen den beiden Bildern keinen wie auch immer gearteten Unterschied erkennen können! Überraschen Sie mich! Und lassen Sie sich ruhig Zeit.«