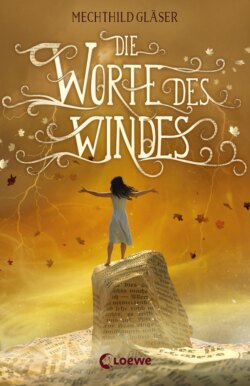Читать книгу Die Worte des Windes - Mechthild Glaser - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Donnerdrache
ОглавлениеStürme der anderen Art sind tückisch. Nicht umsonst bemerkt man sie meistens erst, wenn man sich bereits mitten in ihnen befindet. Die meisten Leute sind vermutlich sogar schon tot, noch bevor ihnen klar wird, was überhaupt vor sich geht. Ich hingegen war einst dazu trainiert worden, die Anderen zu finden. Sie schon an den kleinsten Anzeichen zu erkennen und ihnen die Stirn zu bieten.
Und ein Überbleibsel dieses Trainings war wohl das Einzige, das mich heute davor bewahrte, auf der Stelle zu sterben. Die Tatsache, dass mir der Nachhall des Donners in die Glieder fuhr und mich von der Schaukel springen ließ, noch bevor –
Der Aufprall war hart, meine Fußsohlen kribbelten. Ich ignorierte den Schmerz und stürzte los. Ohne Blitzklinge blieb mir nämlich wohl oder übel nur eines – und das war die Flucht. Ich musste so viel Abstand wie möglich zwischen mich und ihn bringen. Und ich betete zum Gott des Schicksals, dass meine Unaufmerksamkeit mich nicht den Kopf kosten würde.
Ich rannte.
Der Spielplatz befand sich am Rande eines Parks. Doch auf der Grünfläche wäre ich vollkommen schutzlos. Stattdessen wandte ich mich in Richtung Straße. Meine Schuhe platschten durch Pfützen, das Blut rauschte mir in den Ohren und das Gewicht meiner nassen Kleider schien mich zurückzuhalten. Aber ich preschte voran, stolperte mehr vorwärts, als dass ich lief.
Weg!
Ich musste weg.
Wieder durchfuhr das grelle Leuchten eines Blitzes den Himmel. Fast im gleichen Augenblick donnerte es und der Klang fraß sich in jede Faser meines Körpers. Dieses tiefe Dröhnen, das einem den Atem stocken ließ. Gleich darauf wandelte es sich: Das Rauschen der See mischte sich hinein, laut und zornig. Und der Geruch von fauligem Fisch. Wie aus dem Nichts erschienen Muschelsplitter und wirbelten durch die Luft, zerkratzten meine Haut.
Ich konnte es nicht glauben. Wirklich nicht. Das war doch ganz und gar verrückt! Seit tausend Jahren war keiner der Anderen in einer Stadt aufgetaucht. Oder überhaupt an Land!
Vielleicht täuschte ich mich ja doch. Auf jeden Fall wagte ich nicht innezuhalten, um mich umzudrehen und mich mit eigenen Augen zu vergewissern.
Erneut beschleunigte ich meine Schritte, stürzte den Gehweg entlang. Wenn ich es bis zur Ampel schaffte … Dort war eine Fußgängerunterführung. Schmal und dunkel …
Meine Sinne waren bis aufs Äußerste geschärft, hinter mir meinte ich, eiskalten Atem zu spüren, während grüngraue Nebelschwaden mich umflossen.
War mein Kopfschmerz in Wahrheit ein Hirntumor, der zu Wahnvorstellungen führte?
Verdammt, verdammt, verdammt!
Endlich tauchte die Unterführung vor mir auf. Ich warf mich die Stufen hinab in die Dunkelheit, doch Nebel und Muschelscherben folgten mir. In das Rauschen mischte sich das Geräusch von … etwas anderem. Gleichzeitig schwoll das Dröhnen zu einem ohrenbetäubenden Grollen an, das die steinernen Platten unter meinen Füßen vibrieren ließ.
Die Erde erbebte vom Kampfschrei des Donnerdrachen, jenes Wesens, das im Herzen dieses Sturms lebte.
Der Drache war nun beinahe bei mir.
Und er griff an.
Ich verfluchte meine Hilflosigkeit. In Atlantis, dem Reich meiner Mutter, hatte ich stets gleich mehrere Blitzklingen in einem Holster aus Samt bei mir getragen. Meine Exemplare waren kunstvoll verziert gewesen und so scharf, dass man selbst Perlen damit spalten konnte.
Jetzt hatte ich bloß einen gammeligen Rucksack voller Hefte und Stifte dabei. Möglicherweise fand sich irgendwo darin noch eine Bastelschere. Doch allein der Gedanke, mit einem Spielzeug aus Plastik und Stahl gegen einen Drachen zu kämpfen, war geradezu lächerlich!
Die Nebelschwaden verdichteten sich derweil zusehends und nahmen mir den Atem, während der Tornado aus Muschelscherben sich kaum merklich verlangsamte. Das Auge des Sturms war nahe. Jeden Moment würde der Donnerdrache –
Wenn ich jetzt anhielt, wäre ich tot, bevor ich auch nur den Reißverschluss des Rucksacks geöffnet hätte.
Blindlings stürzte ich die letzten Stufen hinab, mitten ins Dämmerlicht der Unterführung. Der Nebel verschleierte noch immer meine Sicht, sodass ich die beiden Gestalten, die an der Betonwand lehnten und rauchten, erst erkannte, als ich beinahe an ihnen vorbeirannte.
»Was zur Hölle?«, rief Vivien, als eine Scherbe ihre Wange traf. Sie starrte mich an, vermutlich, weil meine Haare im Nebel wehten, als führten sie ein Eigenleben.
»Was macht ihr denn hier?«, keuchte ich.
»Na, uns vor dem Regen unterstellen«, schrie Marie gegen das Rauschen an. »Was soll die Scheiße? Was ist das?« Sie deutete auf das schmutzig grüne Licht und die Muschelscherben, von denen sich nicht wenige in meiner Kleidung verfangen hatten.
»Bah, Alter, wieso stinkt das plötzlich nach verwester –«, setzte derweil Vivien an.
Da bebte die Erde so stark, dass wir alle drei taumelten und ich gegen die beiden prallte.
Marie versuchte, sich an der Tunnelwand festzuhalten. Vivien fiel auf die Knie und schrie auf.
Unterdessen standen mir meine Optionen binnen eines Herzschlags plötzlich ganz klar vor Augen: Entweder ich rannte weiterhin um mein Leben und überließ Vivien und Marie ihrem Schicksal. Oder ich versuchte, den Donnerdrachen aufzuhalten, damit wenigstens die beiden eine Chance hatten. So oder so, es sah nicht gut für mich aus. Ich biss mir auf die Unterlippe. Auch wenn ich diese Mädchen nicht leiden konnte und sie sich benahmen, als wäre ihnen alles und jeder auf der Welt egal außer ihnen selbst, sie waren immer noch Menschen. Und einst hatte ich wie alle Hexen einen Eid geleistet …
Der Eingang verfinsterte sich, als sich etwas mit dunkel geschuppten Beinen und messerscharfen Krallen um die Ecke schob.
Etwas … Gewaltiges.
»Was für ein Freak bist du eigentlich, Schlafwandler-Schlampe?«, kreischte Marie. Ihre Plastikfingernägel krallten sich in die Betonwand.
»Lauft einfach, okay?«, brüllte ich. »LAUFT WEG!«
»Aber da draußen ist ein krasses Gewitter«, stammelte Vivien.
»Ja, was, wenn wir vom Blitz –«
Der Drache gab ein gurgelndes, zischendes Fauchen von sich, das wie tausend tosende Mahlströme auf einmal klang. Gleichzeitig schnellte eine Schnauze von der Größe eines Autos in die Unterführung. Mit geblähten Nüstern schob sich das Maul über den Beton auf uns zu. Eine weitere Welle aus Gestank und Muschelsplittern rollte über uns hinweg, noch viel übler als die erste.
Ich unterdrückte ein Würgen. Marie und Vivien waren inzwischen bleich wie Gespenster. Ihre Münder klappten auf, doch kein Ton kam heraus. Sie waren viel zu geschockt, um zu schreien, weil sie ja noch nicht einmal an die Existenz von Drachen glaubten! Herrje! Falls wir es doch irgendwie hier herausschafften, konnte ich nur hoffen, dass ihnen das Ganze derart absurd vorkam, dass sie annahmen, sich die Geschichte eingebildet zu haben … Wobei das im Moment natürlich meine geringste Sorge war.
Nacheinander verpasste ich jeder von ihnen eine Ohrfeige. »MACHT SCHON!«, brüllte ich sie an. »Wir haben keine Zeit für Erklärungen. RENNT!«
Da endlich setzten sie sich in Bewegung. Über ihre eigenen Füße stolpernd stürzten sie zum anderen Ende des Tunnels und die Treppe hinauf.
Ich hingegen begann nun doch, in meinem Rucksack nach der Bastelschere zu tasten. Mit grimmiger Miene wandte ich mich dem Drachen zu.
Er füllte inzwischen den gesamten Eingang der Unterführung aus. Da sein Kopf zu groß war, um ganz hindurchzupassen, hatte er das gewaltige Maul wieder ein Stück zurückgezogen. Stattdessen peitschte ein stachelbewehrter Schwanz vom Umfang eines Baumstamms durch den Nebel. Dahinter erkannte ich einen Teil seines gallertigen Rumpfes – solche Körper besaßen sonst nur die Geschöpfe der tiefsten Tiefsee. Lichtblitze glommen in seinem Inneren auf, der faulige Gestank hing nun beinahe greifbar in der Luft und schien jeglichen Sauerstoff zu verdrängen.
Ich hustete und wich zurück, als der Schwanz nach mir zu tasten begann. Schuppen und Stacheln kratzten mit einem schabenden Geräusch über den Asphalt und krochen dabei unaufhaltsam auf mich zu. Der Drache konnte mich nicht sehen, noch immer gelang es ihm nicht, sich in die Unterführung zu quetschen. Nur würde ihn dieses Hindernis vermutlich nicht allzu lange aufhalten.
Instinktiv wollte ich so viel Abstand wie möglich zwischen mich und das Biest bringen, doch da erreichte mich die mit einem langen Stachel besetzte Schwanzspitze. Genauer gesagt schnellte sie mit rasender Geschwindigkeit auf mich zu wie eine Peitsche und zerriss den Stoff meiner Jeans. Ich unterdrückte einen Schrei, als sie die Haut darunter traf.
Etwas Warmes sickerte an meinem Bein hinab. Vermutlich Blut.
Allerdings verwendete ich keine Energie darauf, es zu überprüfen. Wie schlimm die Wunde auch sein mochte, das war jetzt vollkommen unwichtig.
Meinen ersten Donnerdrachen hatte ich im Alter von zehn Jahren erlegt, als jüngste Hexe, der dieses Kunststück je gelungen war. Der Sturm hatte meine Schwestern und mich bei einem Ausflug an die Wasseroberfläche überrascht. Damals hatte ich meine Blitzklinge, ohne zu zögern, direkt in das leuchtende Herz der Bestie gestoßen. Mit mehr Glück als Verstand.
Wie naiv ich gewesen war! Ich hatte nämlich tatsächlich geglaubt, was alle behauptet hatten: dass ich unbesiegbar sei. Unfehlbar. Das sagenumwobene Kind der Prophezeiungen. Allein bei der Erinnerung daran legte sich ein bitterer Geschmack auf meine Zunge.
Inzwischen wussten wir alle es besser.
Und heute, jeglicher Klinge beraubt, brauchte ich ohnehin einen anderen Plan. Irgendetwas, das den Drachen zumindest so lange aufhielt, bis Vivien und Marie aus der Schusslinie waren (und das vorzugsweise nicht beinhaltete, dass ich mich fressen ließ).
Wieder zuckte der Schwanz in meine Richtung, doch dieses Mal verfehlte er mich um Haaresbreite, weil ich gerade noch rechtzeitig zur Seite sprang. Die Erleichterung währte leider nur kurz.
Schon näherte sich das Ding erneut.
Endlich fand ich die Schere. Ohne zu zögern, rammte ich sie mit aller Kraft in die schuppenbesetzte Haut. Doch statt zurückzuweichen, fühlte sich das Ungeheuer wohl bloß weiter angestachelt. Zumindest verriet mein lächerlicher Angriff aber, wo genau in der Unterführung ich mich befand. Wieder sauste der Drachenschwanz durch die Luft, traf mich an der Hüfte, drückte meine Oberschenkel gegen die Wand und zog mich näher und näher in Richtung des Körpers.
Die gewaltige Schnauze erschien, schnüffelte genüsslich und öffnete sich einen Spaltbreit. Der Drache spie eine weitere Ladung Muschelscherben aus, die nun auf mich zuschossen, scharf und spitz.
Ich riss die Arme hoch, um wenigstens mein Gesicht zu schützen.
Der Donnerdrache stieß einen Kampfschrei aus, der mir beinahe die Trommelfelle zerriss und außerdem ziemlich siegessicher klang. Siegessicher und hungrig.
Ich blinzelte, suchte verzweifelt nach einem Ausweg. War das also nun das Ende? Nach all den Jahren des Versteckens fiel ich nicht den Häschern, sondern einem verirrten Donnerdrachen zum Opfer? Unbewaffnet und an der Oberfläche? Die Prinzessin, die schon als Kind für ihre Klingenkunst berühmt gewesen war?
Das Maul öffnete sich weiter und machte sich bereit, mich zu verschlingen.
Nein, das durfte nicht geschehen! Ich konnte mich nicht einfach kampflos meinem Schicksal ergeben, ich musste … es wenigstens versuchen, oder?
Ja, es war riskant und gefährlich und dumm, aber mir blieb kein anderer Ausweg.
Ich wollte nicht sterben.
Muschelscherben ritzten meine Haut auf, während der Drachenschweif mich so fest umschlungen hielt, dass er meinen Brustkorb zu zerquetschen drohte.
Es war so weit, entweder jetzt oder …
Der Tod lauerte in den Schatten, umklammerte mich bereits. Hässlich und unerbittlich wie der Donnerdrache selbst.
Nein!
Ich nahm einen Atemzug, der mein letzter hätte sein können, und dann tat ich es. Tat, was ich mir eigentlich nie wieder hatte gestatten wollen.
Ich sang.
Nur einen einzelnen klaren Ton, der so fließend aus meiner Kehle emporstieg, als hätte ich ihn nicht seit vier Jahren, fünf Monaten und 16 Tagen zurückgehalten. Ein Ton, der sich ausbreitete wie ein frisch ausgeworfenes Fischernetz, der von den Tunnelwänden widerhallte und sich als knisternde Welle bis in die Stadt und den Himmel darüber auszudehnen schien. Ein Ton, der über das Meer bis zum Horizont tanzte.
Es war keine Melodie, kein Lied, keine Musik im eigentlichen Sinne. Es war ein Ruf.
Und der Ostwind antwortete.
Er gehorchte mir tatsächlich noch!
Es begann mit einem Rascheln, das sich unter das Grollen des Donnerdrachen mischte und langsam anschwoll. Es durchschnitt den Nebel und wirbelte seine Schwaden durcheinander, drängte das Drachenmaul zurück. Kurz darauf durchfuhr mein alter Freund als Bö mein zotteliges Haar, um mich zu begrüßen. Einen Herzschlag lang spielte er mit den langen Strähnen, als habe er mich vermisst, zerrte an meiner nassen Jacke, als wolle er mich umarmen. Dann stimmte er seinen eigenen Ton an.
Ich blinzelte eine Träne aus meinem Augenwinkel fort, als sich unser beider Gesang zu einem summenden Duett verband, das die Unterführung nun ganz und gar ausfüllte. Mein Haar umtoste mich, während der Ostwind mich umkreiste und so verhinderte, dass der Drache mich weiter zu sich ziehen konnte. Ich legte den Kopf in den Nacken und schloss für die Dauer eines Wimpernschlags die Augen.
Noch einmal holte ich tief Luft und veränderte meinen Ton um eine Nuance.
Der Ostwind reagierte prompt und stob auf den gallertigen Körper des Ungeheuers zu. Die Lichtblitze im Innern des Drachen flammten auf, als er aus dem Gleichgewicht geriet und zurücktaumelte. Klauen und Nebel zogen sich ein Stück zurück und tatsächlich lockerte sich auch der stachelige Schwanz um meine Hüften so weit, dass ich mich losmachen konnte.
Lange würde der Wind den Donnerdrachen sicherlich nicht aufhalten können. Aber immerhin war ich nun frei, konnte wieder rennen – und das tat ich auch.
Ich hastete zum Ausgang, zu der Treppe, die ich Marie und Vivien vor wenigen Minuten hinaufgeschickt hatte. Vielleicht gelang es uns am Ende ja doch noch allen dreien zu entkommen.
Hinter mir brauste der Ostwind noch immer mit aller Macht, um mir den Drachen vom Leib zu halten.
Doch mit einem Mal mischte sich da etwas in seinen Gesang. Ein merkwürdiges Knacken, als läge plötzlich eine Spannung in der Luft, als befänden wir uns im Innern einer Gewitterwolke kurz vor ihrer Entladung.
Ich hatte gerade die unterste Treppenstufe erreicht, da flammte ein gleißendes Licht auf, hell und scharf. Hitze durchströmte den Tunnel.
Eine Blitzklinge?
Der Donnerdrache stieß einen markerschütternden Schrei aus. Etwas Verbranntes durchtränkte den fauligen Gestank.
Ich fuhr herum.
Und da sah ich, wie sie am anderen Ende der Unterführung auftauchten: meinesgleichen!
Es waren zwei Jungen, Hexer, der eine wohl noch nicht lange volljährig. Er war höchstens dreizehn Jahre alt, hatte ein schmales Gesicht und bleiche Haut, wie man sie nun einmal bekommt, wenn man sein Leben viele Kilometer unterhalb der Wasseroberfläche verbringt. Der Kleine sprang nun in die Höhe, hielt in jeder Hand einen glühenden Blitz und hieb damit nach den Drachennüstern.
Währenddessen zog der zweite, deutlich größere Hexer seine Klinge aus dem gallertigen Rumpf und stach gleich darauf erneut zu. Dieses Mal traf er das zuckende Herz. Noch einmal bäumte der Donnerdrache sich auf. Er stieß einen weiteren Schrei aus, Muschelsplitter stoben in alle Richtungen und eine letzte Welle fischigen Atems breitete sich aus.
Dann erloschen die Lichter im Inneren seines Rumpfes. Der Nebel sank zu Boden und versickerte irgendwo unter unseren Füßen.
Der Drache war tot, der andere Sturm besiegt.
Und der Hexer entfernte die Blitzklinge sorgfältig, wischte sie mit einem Lappen ab und verstaute sie mit geübten Bewegungen wieder in dem Holster auf seinem Rücken. Er tat das hier offenbar nicht zum ersten Mal, dabei konnte er kaum älter als ich sein. Ich schätzte ihn auf achtzehn oder neunzehn, allerhöchstens zwanzig. Er wirkte durchtrainiert und überragte seinen jungen Begleiter um mehrere Köpfe. Das Haar fiel ihm in dunklen Wellen in die Stirn, als wäre es genauso schwer zu bändigen wie mein eigenes, und seine Stiefel hatten eindeutig schon bessere Zeiten gesehen.
Außerdem zitterten seine kräftigen Hände nun doch ein wenig, als er dem Kleinen die Blitze abnahm und sie ebenfalls einpackte.
»Ich hab dir gesagt, du sollst oben warten! Das hier ist noch zu gefährlich für dich«, schalt er den Jungen.
Doch der zuckte bloß mit den Achseln. »Du brauchtest Hilfe, oder?«
»Nein«, sagte der Hüne. »Und das weißt du genau. Du bist noch nicht so weit, Damian. Als dein Lehrmeister –«
»Was wollte das Biest überhaupt hier?«, unterbrach der Kleine ihn und sprach mir damit aus der Seele.
Drachen kommen nicht an Land. Niemals. Und ich – verdammt, war ich denn von allen Geistern der See verlassen? Wieso machte ich nicht, dass ich wegkam? Noch hatten die beiden mich nicht bemerkt.
Dummerweise fühlten sich meine Knie wie zwei matschige Quallen an, am liebsten hätte ich mich für einen Moment hingesetzt.
Während meine Füße mir ihren Dienst verweigerten, begannen die beiden Hexer, den Kadaver vor sich zu untersuchen. Oder zumindest das, was noch von ihm übrig geblieben war.
Die Schnauze des Donnerdrachen war bereits in sich zusammengefallen und löste sich mit rasender Geschwindigkeit auf. Überall lagen glitschige Schuppen herum und der Schwanz zerfloss zu einer übel riechenden Pfütze.
Andere verschwanden genauso rasch, wie sie sich bildeten. Ohne Vorwarnung. Ohne Spuren zu hinterlassen.
Trotzdem suchten die Hexer den Asphalt ab. Vermutlich nach Hinweisen darauf, was um alles in der Welt dieses Biest mitten in eine menschliche Siedlung geführt haben mochte.
Auch ich hätte gerne mehr darüber erfahren. Ich spielte sogar schon mit dem Gedanken, mich zu bücken und eine der schleimigen Schuppen aufzuklauben. Doch in diesem Moment hob der größere Typ den Blick und riss mich damit endlich aus meiner seltsamen Erstarrung. Bisher hatte er nicht in meine Richtung gesehen, aber … War ich eigentlich verrückt geworden, so lange zu zögern?
Gerade noch rechtzeitig hechtete ich in den Schatten der Treppe. Ohne mich umzusehen, rannte ich los, die Stufen hinauf und fort von den Hexern und allem, was für mich sowieso nur in ferner Vergangenheit existieren durfte.
Der Ostwind zupfte ein letztes Mal an meiner Kapuze, doch ich schickte ihn so übereilt weg, dass ich sogar vergaß, mich für seine Hilfe zu bedanken.
Auf der Straße sprang ich über abgebrochene Zweige und den Inhalt umgewehter Mülleimer hinweg. Ich wollte nur noch zurück zur Wohngruppe.
Der Bürgersteig flog unter meinen Schritten dahin, während die Panik mich bereits überrollte wie ein mittelgroßer Tsunami. Ja, ich war froh, noch am Leben zu sein, erleichtert. Aber … nach all den Jahren ohne meine Kräfte … Sie nie wieder einzusetzen, war stets die wichtigste Regel von allen gewesen.
Was hatte ich nur getan?
Ja, ich war einst Prinzessin eines magischen Volkes gewesen. Und offensichtlich hatten meine Kräfte mich nicht verlassen. Ich konnte noch immer kämpfen. Doch das alles änderte nichts an dem, was heute für mich galt.
Ich durfte einfach keine Hexe mehr sein.
In der Nacht der Katastrophe, der Nacht meiner Flucht, hatte ich meinen wahren Namen und Titel ein für alle Mal abgelegt. Undina Severina Mare, siebte Tochter der siebten Königin, das Kind, dem einst Großes vorherbestimmt gewesen war, existierte nicht mehr.
Meiner Magie und den Stürmen hatte ich längst abgeschworen.
Und wenn ich nicht entdeckt werden wollte, musste es dabei bleiben.