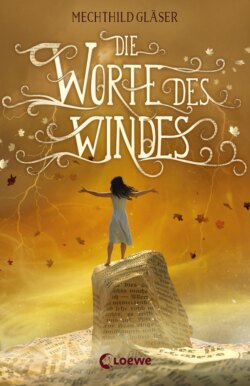Читать книгу Die Worte des Windes - Mechthild Glaser - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Ein Sturm zieht auf
ОглавлениеDer Wind raunte mir Geheimnisse ins Ohr und das aufziehende Unwetter prickelte bereits in meinen Fingerspitzen. Jede Faser meines Körpers sehnte sich danach, den Kopf in den Nacken zu legen und auf das noch ferne Donnergrollen zu lauschen. Wie gern wäre ich mitten auf der Straße stehen geblieben, um auf die ersten silbrigen Regenfäden zu warten und sie mit den alten Liedern zu begrüßen!
Aber das ging natürlich auf keinen Fall. Wieder einmal ermahnte ich mich selbst: Nach allem, was ich angerichtet hatte, durfte ich keine Hexe mehr sein. Jenen Teil meines Lebens hatte ich zusammen mit meiner Kindheit längst hinter mir gelassen. Ein Sturm sollte für mich inzwischen nur noch etwas sein, das manchmal eben geschah. Herrje, ich musste dringend aufhören, es für etwas anderes zu halten.
Eilig hastete ich weiter über das Pflaster. Autos brausten an mir vorbei, wirbelten bräunliche Pfützen auf und mein Haar löste sich aus dem Knoten an meinem Hinterkopf, um wie eine Fahne hinter mir herzuflattern. Langsam bekam ich Seitenstiche, so als wäre ich wirklich bloß Robin, das sechzehnjährige Menschenmädchen, als das ich mich ausgab.
Trotz der Stiche beschleunigte ich meine Schritte weiter. Ich konnte jetzt nicht zurückfallen. Nicht, wenn ich das Schlimmste verhindern wollte.
Die Sohlen meiner Turnschuhe quietschten auf dem regenfeuchten Stein, während mich die schmutzigen Plattenbauten der Wohnsiedlung beobachteten. Es hatte den ganzen Vormittag über geschüttet wie aus Eimern und auch jetzt bauschten sich dunkle Wolken am Himmel über der Stadt. Und das Rauschen der verdammten Brandung, die wenige Häuserblocks entfernt über den Strand tanzte, erschien mir wieder einmal allgegenwärtig.
Ein Stück vor mir erkannte ich derweil gerade noch die beiden Pferdeschwänze, die um die nächste Ecke verschwanden. Sie gehörten zu zwei Mädchen aus dem Jahrgang über meinem: Marie und Vivien. Ich kannte sie nicht wirklich und hegte eigentlich auch nicht den Wunsch, daran etwas zu ändern.
So ziemlich jeder auf unserer Schule wusste, dass die beiden selten Gutes im Schilde führten. Wenn sie sich nicht rauchend bei den Toiletten herumdrückten, machten sie mit Vorliebe Jagd auf jüngere Schüler, um ihnen Geld oder die Handys abzuknöpfen. Notfalls mit Gewalt. Und ich hatte vor ein paar Minuten beschlossen, dabei nicht weiter zuzusehen. Eine Entscheidung, die ich möglicherweise schon bald bereuen würde, aber das war jetzt egal.
Ich schlitterte ebenfalls um die Kurve und kurz darauf fand ich mich in einer Sackgasse wieder. Es war eine Art Hinterhof, an drei Seiten von bröckligen Betonmauern umgeben, die irgendjemand mit fragwürdigen Parolen besprüht hatte. Dazwischen Mülltonnen und ein rostiges Fahrrad – und Louisa aus der Achten.
»Haha, jetzt kriegst du die Spider-App«, grölte Vivien, die sich vor ihr aufgebaut hatte und somit den einzigen Fluchtweg versperrte. Sie war kräftig gebaut und pfefferte Louisas uraltes iPhone mit Schwung auf den Boden.
Louisa zuckte beim Geräusch des Aufpralls so heftig zusammen, dass sie beinahe ihre Brille verloren hätte. Vor Wut kamen ihr Tränen.
»Bist du bescheuert?!«, rief sie, traute sich jedoch offenbar nicht, sich nach dem Handy mit dem nun gesprungenen Display zu bücken. Sie war vierzehn (sah allerdings aus wie zwölf) und erst vor einer Woche in unserer Wohngruppe eingezogen. Ich hatte mir daher überlegt, sie unter meine Fittiche zu nehmen, bis sie sich eingewöhnt hatte. Von ihrem Talent, sich andauernd in Schwierigkeiten zu bringen, hatte ich da natürlich noch nichts geahnt.
»Jetzt ist deine Klappe plötzlich nicht mehr so groß, was?«, feixte Marie. Sie war so stark geschminkt, dass es mich an das Farbenspiel so mancher Tiefseeraubfische erinnerte. Auf ihren Wangen glänzte perlmuttfarbenes Puder und ihr Lidstrich war etwa zwanzigmal dicker als mein eigener. Vielleicht bemerkte sie mich auch deshalb erst, als ich mich an ihr vorbeidrängte und vor Louisa schob.
»Robin!«, murmelte diese erleichtert und ich nickte ihr kurz zu, bevor ich mich an die Smartphone-Zerstörerinnen wandte.
»Okay, das reicht, ihr hattet euren Spaß«, sagte ich und verschränkte die Arme vor der Brust. »Lasst sie in Ruhe.«
Vivien, die inzwischen Anstalten gemacht hatte, auf dem Handy herumzutrampeln, hielt in ihrer Bewegung inne. »Und was hast du hier zu sagen?«, erkundigte sie sich halb belustigt, halb genervt. Ihr Sweatshirt spannte über ihrer Brust, als sie sich zu ihrer vollen Größe aufrichtete.
Ich blinzelte, weil ich keine Lust auf diesen Blödsinn und schon seit der Mathestunde schlimme Kopfschmerzen hatte. Es war dieses dumpfe Pochen hinter meinen Augen, das mich häufig belästigte und auch heute wieder wie ein unaufhörlich kreiselnder Wirbelsturm in meinem Schädel wütete … Ich biss mir auf die Unterlippe und konzentrierte mich aufs Atmen.
Unterdessen reckte Vivien herausfordernd das Kinn. »Was du zu melden hast?«, wiederholte sie mit einem warnenden Unterton in der Stimme.
Ich seufzte und sah ihr direkt in die Augen. »Witzigerweise wollte ich dich gerade genau dasselbe fragen.«
Sie starrte mich an und ich starrte zurück, während ich mich daran zu erinnern versuchte, ob es Vivien oder Marie gewesen war, die letztes Jahr diese Jugendstrafe wegen Körperverletzung bekommen hatte.
Realistisch betrachtet hatte ich natürlich keiner der beiden etwas entgegenzusetzen. Ich war schließlich kaum größer als Louisa, nicht gerade muskulös und konnte keinerlei Judotricks oder so. Warum hätte ich so etwas auch lernen sollen, wenn ich meine Hexenmagie besaß? Zwar stand es nicht zur Debatte, sie je wieder einzusetzen … Doch ich wusste, dass ein schwacher Abglanz meiner früheren Macht noch immer dann und wann aufblitzte, und vielleicht gelang es mir ja …
Tatsächlich wichen die beiden Mädchen plötzlich kaum merklich vor mir zurück.
Marie, die noch immer Louisas Rucksack in der Hand hielt und just ein Trinkpäckchen darin gefunden hatte, kniff die von künstlichen Wimpern umrahmten Augen zusammen und betrachtete mich genauer. Sie taxierte mich einen Moment lang, bevor sie murmelte: »Du bist doch die Schlafwandler-Schlampe aus der Elften.«
»Hundert Punkte.« Selbstverständlich schlafwandelte ich ganz und gar nicht, aber es war immer noch die beste Erklärung für meine neumondnächtlichen Spaziergänge am Strand und daher ließ ich die Leute gern in dem Glauben. »Und ihr seid also diejenigen, die für diese Handyreparatur aufkommen werden«, sagte ich. »Schön, dass wir das klären konnten.«
Jetzt sog Marie scharf die Luft ein. »Wie bitte?«
Vivien schnaubte. »Als ob –«, begann sie.
»Doof, dass es euch versehentlich heruntergefallen ist«, fuhr ich fort. »Aber Louisa gibt euch netterweise die Chance, es wiedergutzumachen. Wir lassen euch dann die Rechnung für das neue Display zukommen.« Ich bückte mich nach dem Handy und wischte es an meiner Jeans sauber, bevor ich es Louisa reichte. Anschließend schnappte ich Marie den Rucksack weg, ehe sie so recht begriff, was geschah. »Also dann.«
Vivien und Marie tauschten einen verwirrten Blick. Etwas an mir hatte sie für einen Augenblick aus dem Konzept gebracht, vielleicht sogar eingeschüchtert. Aber bestimmt konnten sie sich keinen Reim darauf machen, was genau das sein sollte. Sie ahnten ja nicht einmal, wer und was ich bis zu meinem zwölften Geburtstag gewesen war, geschweige denn, dass Hexen überhaupt existierten.
Und so langsam dämmerte ihnen wohl, dass sie mich genauso leicht verprügeln könnten, wie sie es mit Louisa vorgehabt hatten. Man sah beinahe, wie es hinter ihren schlichten Stirnen arbeitete. Noch ein paar Sekunden und … Unsere einzige Chance war die Überraschung. Wir mussten von hier verschwinden.
Und zwar rasch.
»Lauf!«, raunte ich Louisa zu und gab ihr einen leichten Schubs. »Jetzt!«
Sie setzte sich in Bewegung, tat erst zögerlich einen Schritt nach vorn, dann stürzte sie plötzlich los, an den Mädchen vorbei und blindlings aus der Gasse.
Ich machte es ihr nach, drängte mich zwischen der Mauer und Vivien hindurch, die nach mir hieb, mich allerdings verfehlte. Einen Herzschlag später nahm sie bereits die Verfolgung auf. So schnell mich meine Beine trugen, flitzte ich um die nächste Ecke.
Ich war noch nie eine gute Läuferin gewesen. In meinen nunmehr fast viereinhalb Jahren unter den Menschen hatte ich mich weder fürs Joggen noch für sonst eine Sportart großartig begeistern können, weil meine Füße an Land dummerweise ziemlich schmerzten. Dementsprechend war es leider auch um meine Kondition bestellt. Lange würde ich das definitiv nicht durchhalten können. Allerdings besaß ich eine gewisse Wendigkeit und verlegte mich daher darauf, möglichst viele Haken zu schlagen.
Zuerst zwängte ich mich an einem parkenden Auto vorbei, dann tauchte ich unter einem Geländer hindurch. Als Nächstes rannte ich im Zickzack über eine der seltenen Wiesen in diesem Stadtteil, um kurz darauf ohne Vorwarnung auf einen Spielplatz abzubiegen. Nach einer Runde um das Klettergerüst, den Mülleimer und die Bänke gab Vivien es endgültig auf und auch Marie, die in ihren Plateauschuhen sowieso Probleme hatte mitzuhalten, war die Lust vergangen, mich zu jagen. Einmal versuchte sie noch, mir den Weg abzuschneiden. Doch als ich einen weiteren Haken schlug, wurde es auch ihr zu bunt. Mit einer letzten wüsten Beschimpfung schleuderte sie Louisas Trinkpäckchen in meine Richtung.
»Volltreffer!«, johlte sie, als mir das Ding gegen die Schläfe klatschte und dort aufplatzte. Der klebrige Inhalt rann über mein Gesicht, wobei meine Kopfschmerzen sich zu neuen Höhen aufschwangen.
Ich ballte die Hände zu Fäusten. »Ganz toll«, zischte ich. »Gar nicht albern oder so.«
Vivien prustete, während Marie mich mit ihrem Blick durchbohrte. »Du kannst froh sein, dass wir es dabei belassen«, sagte sie. »Für heute.«
Dann hakte sie sich bei Vivien unter und zusammen verließen sie den Spielplatz.
Wütend sah ich ihnen nach.
Alles in mir schrie danach, den Ostwind zu rufen und ihnen auf den Hals zu hetzen. Nur ganz kurz. Bloß, um sie etwas Respekt zu lehren. Früher in meiner Heimat hatte es kaum jemand gewagt, auch nur den Blick in meiner Gegenwart zu heben. Und nun stand ich hier und musste mir so etwas gefallen lassen?
Wieder spürte ich das übermächtige Rauschen der Brandung und mit ihm den Gesang der See. Wild und stark. Aber nein, ich unterdrückte den Impuls, wie ich es immer tat. Vermutlich würde mein geliebter Ostwind mir ohnehin nicht mehr gehorchen, oder? Ich seufzte.
Selbst wenn, ich würde es nie herausfinden und das war auch besser so. Ich hatte es nicht anders verdient. Und ich sollte dankbar für das Leben sein, das ich nun führte. Dafür, überhaupt noch lebendig zu sein!
Mit dem Ärmel wischte ich mir den Saft aus den Augen. Immer noch ein wenig außer Atem schlurfte ich zu den Schaukeln und ließ mich auf einer davon nieder. Dass die Sitzfläche nass war, kümmerte mich nicht. Der Himmel sah aus, als wollte er sich jeden Augenblick erneut auswringen, doch ich fürchtete mich nicht vor ein paar Regentropfen. Diese Wolken waren zwar einen Hauch zu dunkel, aber bestimmt bildete ich mir das nur ein.
Ja, ganz sicher.
Hätte ich mich auf hoher See befunden … Hier hingegen? Das mussten die Kopfschmerzen sein, ich begann wohl schon zu halluzinieren.
Wenigstens hatte ich den Spielplatz bei diesem Wetter für mich allein. Ich machte einen Moment lang die Augen zu, stieß mich mit den Füßen vom Sand ab und stellte mir vor, dass es Wellen wären, die mich sanft auf und ab schaukelten.
Louisa war am Ende der Gasse in die entgegengesetzte Richtung gelaufen und vermutlich längst zu Hause. Jedenfalls hoffte ich das. Es war schon das dritte Mal diese Woche, dass ich sie vor einer Schulhofschlägerei hatte retten müssen! Wie schaffte sie das bloß immer wieder? Zwar kümmerte ich mich wirklich gerne um sie, aber eine kleine Pause wäre definitiv nicht schlecht.
Ich massierte meine Nasenwurzel mit Daumen und Zeigefinger. Die Lider hielt ich geschlossen. Wenn bloß dieses verdammte Kopfweh nicht dafür sorgen würde, dass ich seit Tagen kaum geradeaus gucken konnte! Ob es am Luftdruck lag?
Das Atmen an Land war stets schwierig für mich. Bei jedem Zug plagte mich dieses Gefühl, dass irgendetwas Entscheidendes fehlte. Ich würde mich wohl niemals daran gewöhnen, den Himmel statt des Ozeans über mir zu spüren. Dieser erschreckend leere Raum über meinem Kopf, diese grauenvolle Abwesenheit von … allem! Da konnte man auf die Dauer ja nur krank werden. Freiwillig hielt sich jedenfalls keine Hexe länger als nötig hier oben auf. Niemand von uns verließ die von gläsernen Kuppeln geschützten Siedlungen der Tiefsee, wenn wir es irgendwie vermeiden konnten.
Und genau deshalb war die Oberfläche so ein gutes Versteck.
Auch in dieser Stadt gab es natürlich Außenposten der Meerhexen. Die Regelung des Wetters, das Brauen und Köcheln und Sieden mussten schließlich außerhalb des Wassers stattfinden und hin und wieder entdeckte ich meinesgleichen tatsächlich am Strand oder in den Wellen. Ich wusste, dass sie den alten Leuchtturm oben auf den Klippen als Geheimversteck nutzten. Doch keiner von ihnen hatte mich bisher auch nur eines Blickes gewürdigt. Mich, Robin, das Menschenmädchen. Das in einer Wohngruppe für Jugendliche mit sozialen Problemen lebte und unter chronischem Kopfschmerz litt, vermutlich vom Schulstress. Nun ja, ich war so langweilig geworden, um im Chaos der oberflächigen Welt unterzutauchen.
Je langweiliger, desto besser, lautete meine Devise.
Wieder traf etwas Nasses mein Gesicht, doch dieses Mal war es ein Regentropfen, kühl und prall, nicht so klebrig wie der Orangensaft. Angenehm. Ich schaukelte schneller und schneller und genoss das Gefühl von weiteren Tropfen, die auf meinen Wangen zerplatzten und sich in mein langes, zotteliges Haar verirrten. Der Wind zerrte an meinen Kleidern und selbst durch die geschlossenen Lider erkannte ich den Blitz, der über den Himmel zuckte. Hell und scharf, eine Klinge bester Qualität würde man daraus schmieden können.
Was mich natürlich nicht mehr im Geringsten interessierte. Mich, eine normale Teenagerin, die hier bloß in Ruhe im Regen schaukeln wollte …
Schon nach kurzer Zeit war ich vollkommen durchnässt. Meine Jeans klebten an meinen Oberschenkeln und meine Jacke hing schwer an meinen Schultern. Aber die Kopfschmerzen verflüchtigten sich etwas. Ich lächelte in mich hinein. Es waren Momente wie diese, die mir eine gewisse Linderung verschafften. Die mich vergessen ließen, was ich verloren hatte. Wasser! Wasser, das über mein Gesicht perlte, in meinen Ohren rauschte und jeden einzelnen meiner Gedanken durchflutete. Wasser, das sich für einen Augenblick so sehr nach zu Hause anfühlte, dass ich nicht einmal die offensichtlichsten Anzeichen erkannte.
Denn als ich das nächste Mal blinzelte, war es bereits zu spät. Das Gewitter hatte sich verändert. Nicht der Regen, der prasselte weiter auf die Erde, als wäre es das Gewöhnlichste auf der Welt.
Aber die Wolken.
Die Blitze.
Der Nachhall des Donners!
Plötzlich durchpflügte dieses Dröhnen den Himmel, ein dumpfes, wütendes Grollen von der Art, die man nicht hören, sondern nur tief im Bauch spüren konnte. Wütend. Bedrohlich.
Verdammt! Die Dunkelheit der Wolkenbäuche war keine Einbildung gewesen! Dieser Sturm war eindeutig … anders.
Doch das konnte nicht sein!
Es war lange her, dass mir ein Geräusch wie dieses begegnet war. Sehr, sehr lange. Und das war selbstverständlich weit draußen geschehen, mitten auf dem Meer. Hunderte von Kilometern entfernt von der Zivilisation, an einem Ort, an dem man leider jederzeit mit solchen Stürmen rechnen musste.
Dies hier allerdings war eine Stadt. Eine bewohnte Stadt!
Menschengebiet.
Meine Hände krallten sich fester um die Ketten der Schaukel, denn so unmöglich mir das alles auch erscheinen mochte, leider bestand kein Zweifel:
Das Böse hatte mich gefunden.