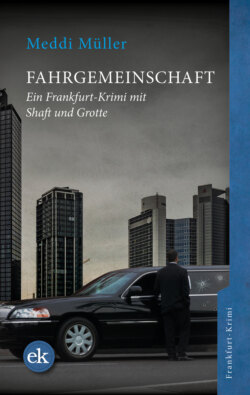Читать книгу Fahrgemeinschaft - Meddi Müller - Страница 7
Armes reiches Mädchen
ОглавлениеKöhler hasste es, die Angehörigen von Mordopfern zu informieren. Er war überhaupt nicht gut in solchen Dingen. Grundsätzlich wusste er, wie er sich in diesen Situationen zu verhalten hatte. Seine jahrelange Erfahrung hatte ihn in derlei Dingen zwar geschult, allerdings war es für ihn auch in diesem Fall genauso wie beim ersten Mal. Es nutzte sich einfach nicht ab. Er war nervös. Und wenn Köhler nervös wurde, benahm er sich seltsam.
Grotewohl wusste um diese Schwäche und war stets darauf bedacht, Köhler bei Einsätzen, die eine gewisse empathische Herausforderung bedeuteten, zu begleiten. Dabei ging es ihr weniger darum, ihren geschätzten Kollegen vor einer Blamage zu bewahren, als darum, die Empfänger der Nachricht vor seiner unbeholfenen Art zu beschützen.
Wie eigentlich immer fuhren die beiden Ermittler mit Köhlers Privatfahrzeug, seinem Mercedes. Die fast schon herbstliche Wetterlage ließ es nicht zu, dass sie offen fuhren. Köhler stieß fast an die Decke des Cabriolets, während bei Grotewohl noch reichlich Luft nach oben war.
Nach etwas mehr als einer halben Stunde Fahrt erreichten sie die Adresse der Familie Walkenhorst in Königstein. Die Kleinstadt im Taunus galt als Wohnsitz der Reichen und Schönen. Wunderbar gelegen, mit unbezahlbarem Blick über das Rhein-Main-Gebiet und ausgestattet mit allem, was der Millionär von heute benötigte. Das Anwesen der Familie Walkenhorst war in allen Belangen beeindruckend. Hohe steinerne Mauern, hinter denen sich auch ein Jagdschloss hätte verbergen können, umgaben das Gelände. In regelmäßigen Abständen waren Überwachungskameras zu erkennen.
»Warum wohnst du eigentlich nicht hier?«, fragte Grotewohl beim Anblick des Anwesens.
»Warum sollte ich? Bei Muttern ist es doch immer noch am besten.«
Grotewohl grinste. »Leisten könntest du es dir doch locker.« Sie spielte auf das immense Vermögen an, das Köhler von seinem Vater, einem ehemaligen Fußballprofi ohne Fortune, geerbt hatte. Der Mann war ein eher zweitklassiger Torwart gewesen, der allerdings seine Gagen äußerst gewinnbringend investiert hatte. Tatsächlich hätte Köhler einen derartigen Wohnsitz in Königstein finanzieren können, doch was sollte er damit? Das Leben bei seiner Mutter im dörflichen Frankfurter Stadtteil Harheim, in dem er aufgewachsen war, genügte ihm. Hier hatte er seine Freunde und vor allem seine Ruhe.
»Klar könnte ich«, sagte er und stieg aus. »Will ich aber nicht.«
Grotewohl nahm es hin und folgte ihrem Partner zum Eingang des Anwesens. »Lass mich das regeln«, sagte sie, bevor sie die Klingel betätigte.
Köhler widersprach ihr nicht.
Am Tor war ein Schild angebracht, das auf die Überwachung des Geländes durch einen privaten Sicherheitsdienst hinwies.
Nachdem sie einen kurzen Augenblick gewartet hatten, ertönte eine blecherne Männerstimme aus der Gegensprechanlage. »Ja, bitte?«
Grotewohl stellte sich und ihren Partner vor und bat um Einlass.
»Worum geht es denn?«, wollte die Stimme wissen.
»Das würden wir gern persönlich klären«, erwiderte Grotewohl freundlich.
»Einen Moment«, bat die Stimme. »Ich schicke Ihnen jemanden, der Sie abholt.«
»Schlimm«, sagte Köhler. »Niemand vertraut einem mehr heutzutage.«
»Kannst du es ihm verdenken?«
»Nö.«
Es dauerte einige Minuten, bis jemand am Tor erschien. Wie aus dem Nichts tauchte ein Mann auf. Er trug die Fantasieuniform eines Sicherheitsunternehmens inklusive Barrett und war mit Pfefferspray und einem Knüppel bewaffnet. An der kurzen Leine hielt er einen Schäferhund, der einen Maulkorb trug. Köhler und Grotewohl mussten zugeben, dass der Mann Eindruck machte. Die Botschaft war eindeutig: Hier wollte jemand ungestört bleiben.
»Darf ich bitte Ihre Ausweise sehen?«, fragte der Wachmann.
Grotewohl und Köhler reichten ihre Ausweise durch das Gitter und warteten ab. Sie empfanden die Situation als absurd und wechselten vielsagende Blicke. Nach eingehender Prüfung nickte der Mann, gab ihnen die Ausweise zurück und öffnete das Tor mittels einer Fernbedienung. Sein offensichtliches Misstrauen war einer routinierten Freundlichkeit gewichen.
»Verzeihen Sie das Vorgehen, aber man kann nicht vorsichtig genug sein.« Er lächelte gequält. Köhler und Grotewohl wurden von dem Wachmann auf einem Kiesweg bis zum Haupthaus begleitet. Der Kies knirschte unter ihren Füßen. Die beiden Ermittler kamen sich vor wie in einem Barnaby-Krimi, der in einem Schloss des südenglischen Landadels spielte. Das riesige Haus war imposant gelegen, leicht erhöht inmitten eines Parks. Große Säulen säumten den Eingang. Unzählige Fenster durchbrachen die massive, aus beigen Steinen gefertigte Fassade. Ornamente und kleine Figuren schmückten die Front und verliehen ihr eine herrschaftliche Würde. Das Gebäude war aufgeteilt in drei Flügel, einen größeren in der Mitte und zwei nur leicht niedrigere jeweils rechts und links davon. Wie ein englisches Schloss eben. Grotewohl und Köhler waren beeindruckt.
Kurz vor der überdimensionierten zweiflügeligen Haustür sprach der Wachmann in ein Funkgerät. Einen Augenblick später öffnete sich die Tür und ein Mann im Anzug stand vor ihnen. Dieser nickte dem Wachmann zu, woraufhin der sich zurückzog.
»Mein Name ist Oskar Bajohr«, stellte sich der Mann vor. »Ich bin der persönliche Assistent von Herrn Walkenhorst. Treten Sie bitte ein, ich werde Sie zu ihm bringen.«
»Äh …« Köhler deutete auf sein Fahrzeug, das immer noch in der Einfahrt stand. »Was ist mit meinem Auto?«
Der Mann hob den Blick, verzog jedoch keine Miene. »Natürlich«, sagte er nach einer kurzen Pause. »Sie können hineinfahren und vor dem Haupthaus parken.«
»Warum bin ich dann erst hierhergelaufen?«, motzte Köhler.
Bajohr sah ihn ausdruckslos an und verzog keine Miene. In aller Deutlichkeit spürte Köhler dessen unausgesprochene Worte: Was kann ich dafür, dass du so blöd bist.
Köhler hob die Schultern und stiefelte zurück zur Einfahrt. Kurz bevor er am Tor ankam, öffnete es sich wie von Geisterhand. Er drehte sich um und sah Grotewohl und Bajohr auf den Stufen des Eingangs stehen. Bajohr hielt etwas in der Hand, allem Anschein nach die Fernbedienung für das Tor. Köhler stieg in sein Fahrzeug und fuhr damit bis direkt vor die Treppe, die zum Eingang führte.
»Wenn Sie mir bitte folgen wollen«, bat Bajohr, als Köhler zu ihnen aufgeschlossen hatte, und betrat das Haus. Wie nicht anders zu erwarten war, kamen sie in eine opulente Eingangshalle. Direkt gegenüber befand sich eine riesige zweigeteilte Treppe, die zu einer Galerie führte, die wiederum die Flügel des Hauses miteinander verband. Köhler hatte jetzt zum ersten Mal Gelegenheit, den Assistenten des Hausherrn zu mustern. Bajohr sah aus, als spielte er eine der Hauptrollen in einem Edgar-Wallace-Film. Grau meliertes Haar, etwa einssiebzig groß, stand er leicht nach vorn gebeugt da und deutete mit einer eleganten Bewegung auf ein Zimmer, das sich links an die Eingangshalle anschloss.
»Wenn Sie bitte in der Bibliothek warten möchten«, sagte er etwas steif. »Ich werde Herrn Walkenhorst Ihren Besuch melden. Er wird sich dann zu Ihnen gesellen.«
Wieder musste Köhler an die Edgar-Wallace-Filme denken und ein Grinsen unterdrücken. Bajohr schien Gedanken lesen zu können und strafte Köhler mit einem eiskalten Blick, bevor er ging, um seinen Boss zu holen. Bajohr war trotz seiner geringen Größe ein Mann, der durchaus respekteinflößend war. Allem Anschein nach war er mehr als nur der Assistent des alten Walkenhorst, wohl eher der Bodyguard der Familie. Alles an ihm schien kampfbereit zu sein.
Grotewohl und Köhler betraten die Bibliothek, die erstaunlich modern eingerichtet war.
Von außen wie ein Schloss und von innen wie ein Penthouse, schoss es Köhler durch den Kopf. Staunend sah er sich um.
»Handelt es sich bei dem Typen um ein Gespenst?«, fragte Grotewohl.
Köhler lachte. »Das ist der Hausgeist.« Interessiert sah er sich um. Die Einrichtung war exklusiv und offenbar maßgefertigt. »Ich muss mich korrigieren«, sagte er anerkennend. »Ich kann mir eine solche Hütte doch nicht leisten. Das übersteigt eindeutig mein Budget.« Er zeigte auf eine Vitrine. »Ist das ein Fabergé-Ei?«
»Das haben Sie gut erkannt«, erklang eine tiefe Stimme hinter den beiden Polizisten. Als hätte man sie bei der Ausübung einer Straftat ertappt, fuhren sie herum.
»Entschuldigen Sie, wir wollten nicht …«
Der Mann hob die Hand und brachte damit Köhler zum Schweigen. Er war mit einer natürlichen Autorität ausgestattet, die einem sofort Respekt einflößte. Er saß in einem Rollstuhl, den er selbst gesteuert haben musste, denn Bajohr stand etwa zehn Meter entfernt und beobachtete die Szenerie. »Wussten Sie, dass gerade mal fünfzig Stück davon hergestellt wurden?«
»Von dem hier?«, fragte Grotewohl.
Der Mann lachte amüsiert und es klang wie eine Reaktion auf die naive Frage eines Kindes. »Nein. Insgesamt gibt es nur fünfzig Fabergé-Eier.«
»Oh …«, machte Grotewohl und trat einen Schritt von der Vitrine weg.
»Und jedes davon ist einzigartig«, ergänzte er nicht ohne Stolz. »Aber Sie sind doch sicher nicht gekommen, um mein Fabergé-Ei zu bewundern.«
»Nein, natürlich nicht.« Köhler straffte die Schultern. »Sie sind Herr Walkenhorst?«
»Wie unhöflich von mir!« Der Mann reichte dem Kommissar die Hand. »Gestatten, Thomas Walkenhorst.«
Köhler nannte nun auch seinen Namen. Anschließend begrüßte der Hausherr Grotewohl.
»Nun, da wir die Formalitäten ausgetauscht haben: Was hat mein Sohn schon wieder ausgefressen?«
Köhler und Grotewohl wechselten einen raschen Blick. Die Frage war interessant und wurde sofort von beiden gespeichert.
»Wie kommen Sie darauf, dass wir wegen Ihres Sohnes hier sind?«, fragte Grotewohl.
»Weil es zu meinem Bedauern recht häufig vorkommt, dass er sich im Konflikt mit dem Gesetz befindet.« Er deutete auf die beiden. »Sie allerdings müssen neu sein. Ich habe Sie noch nie zuvor gesehen.« Er lachte kurz auf. »Und verzeihen Sie mir die Bemerkung, aber einen schwarzen Polizisten in einem Maßanzug hätte ich mir mit Sicherheit gemerkt.«
Köhler fühlte sich seltsam unwohl und geschmeichelt zugleich. Verlegen griff er an das Revers seines Jacketts und räusperte sich. »Wir sind nicht aus Königstein, hatten wir das nicht erwähnt?«
Wieder lachte der Mann im Rollstuhl. Diesmal klang es resigniert. »Sie glauben nicht, von woher überall die Polizei gekommen ist, um mit mir über meinen Sohn zu reden.« Für den Bruchteil einer Sekunde verklärte sich sein Blick. Eine unangenehme Erinnerung schien sich seiner zu bemächtigen. Dann war er wieder hellwach. »Muss ich meinen Anwalt konsultieren?«
Köhler warf Grotewohl einen hilfesuchenden Blick zu. Sie reagierte mit einem Seufzer.
»Wir sind wegen Ihrer Tochter hier.«
Die Bemerkung rief in Walkenhorst eine deutliche Reaktion hervor. Seine bisher gezeigte selbstgefällige Haltung fiel von ihm ab wie trockener Putz von einer Wand. Bajohr trat ein paar Schritte in den Raum hinein. Seine Aufmerksamkeit schien sich schlagartig zu erhöhen.
»Meine … Tochter?«, fragte Walkenhorst stockend, nun gar nicht mehr der souveräne Hausherr mit Bodyguard. Erstaunlich schnell hatte er sich wieder im Griff. »Ich habe meine Tochter schon lange nicht mehr gesehen«, fuhr er fort, »und denke auch nicht, dass sie meine Hilfe annehmen würde. Wie es aussieht, haben Sie wohl Ihre Zeit verschwendet.«
»Das glaube ich kaum«, entgegnete Köhler trocken. Bevor Grotewohl es verhindern konnte, fügte er an: »Sie wird Ihre Hilfe nicht mehr benötigen, denn sie ist tot.«
Walkenhorsts Blick war wie versteinert. Für einen Augenblick erfüllte sein Schweigen den Raum.
Grotewohl sah sich in der Pflicht. »Wir haben Ihre Tochter gestern in Frankfurt am Mainufer gefunden. Wir gehen davon aus, dass sie ermordet wurde.«
»Ermordet?!«, entfuhr es Walkenhorst. »Warum?«
»Das wissen wir noch nicht.« Sie hielt kurz inne, um sich zu sammeln. »Um ehrlich zu sein, sind wir noch nicht mal zu hundert Prozent sicher, ob es sich wirklich um Ihre Tochter handelt. Deshalb möchten wir Sie bitten, sie zu identifizieren.«
»Was?« Walkenhorst schien weggetreten zu sein, fing sich aber rasch wieder. »Ja … natürlich. Gerne.« Sein Blick ging wieder ins Leere.
Köhler räusperte sich. »Wo ist denn Ihre Frau?«
»Hab keine.« Walkenhorst blieb einsilbig.
»Ich meinte die Mutter Ihrer Tochter.«
»Schon lange tot. Flugzeugabsturz.«
»Oh«, machte Köhler. »Das tut mir leid.«
»Ist Jahre her.«
»Gibt es noch andere Verwandte, denen wir Bescheid sagen sollten?«, erkundigte sich Grotewohl.
»Nur noch meinen Sohn, Frederic. Das erledige ich. Machen Sie sich keine Mühe.«
»Es tut mir leid, dass wir Ihnen diese schlechte Nachricht überbringen müssen.«
Walkenhorst hob abwehrend die Hand. Sein Blick war jetzt klar. »Dafür können Sie ja nichts«, sagte er erstaunlich gefasst. Er lächelte Grotewohl an. »Wissen Sie, ich hatte nicht das beste Verhältnis zu meiner Tochter. Sie ist vor langer Zeit … ausgezogen.«