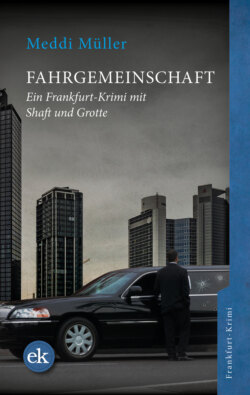Читать книгу Fahrgemeinschaft - Meddi Müller - Страница 8
Leichenschau
Оглавление»Boah, Shaft, du bist wirklich das Letzte!«, schimpfte Grotewohl, als sie wieder im Auto saßen.
»Was hab ich denn jetzt schon wieder verbrochen?« Köhler war sich keiner Schuld bewusst.
»Du kannst doch dem Mann nicht einfach an den Kopf knallen, dass seine Tochter keine Hilfe mehr braucht, weil sie tot ist.«
»Ist das etwa falsch?«
Wieder einmal war Grotewohl überrascht, wie wenig einfühlsam ihr Partner in manchen Situationen war. Dennoch musste sie sich verbessern. »Inhaltlich war das natürlich richtig, in Sachen Empathie jedoch … na ja.«
»Was denn nun?«
»Shaft, das ist nicht dein Ernst! Du kannst unmöglich so unsensibel sein.« Sie sah ihren Kollegen an, der völlig entspannt seinen Oldtimer vom Anwesen auf die Straße lenkte. »Hast du dich mal auf Asperger untersuchen lassen?«
»Was soll das sein?«
»Eine Form des Autismus, bei der man unter anderem Schwierigkeiten bei der sozialen Kommunikation hat.«
»Hab ich die?«
Grotewohl wusste nicht, ob ihr Partner sie ernst nahm. »Du willst mich doch verarschen, oder?«
»Klar!« Köhler lachte.
»Das ist nicht witzig.«
Nun seufzte er. Köhler schien sein unsensibles Verhalten einzusehen, war aber weit davon entfernt, es zu bereuen. »Wie hätte ich es ihm denn schonender beibringen sollen?«
»Keine Ahnung.« Grotewohl warf die Hände in die Luft. »So jedenfalls nicht.«
»Siehste!« Köhler wirkte zufrieden. »Dir fällt auch nichts Besseres ein.«
»Ist ja jetzt egal.« Grotewohl gab auf. Es hatte keinen Sinn, ihrem Kollegen den taktvollen Umgang mit Angehörigen zu erklären, er würde es nie lernen.
»Wollen wir dabei sein, wenn er sie sich ansieht?« Köhler spielte darauf an, dass sie Walkenhorst gebeten hatten, die Leiche seiner Tochter zu identifizieren. Dies sollte am Nachmittag geschehen.
»Bleibt uns wohl nichts anderes übrig.« Grotewohl hasste diese Momente. Zu viel Drama. »Es wäre aber schön, wenn du wenigstens dort versuchen würdest, ein wenig Empathie zu zeigen.«
Zurück im Präsidium trafen die beiden Ermittler auf ihre Kollegen Müller und Brauer, die fleißig ihrer Arbeit nachzugehen schienen.
»Was gibts Neues?«, fragte Köhler und hängte sein Jackett über die Stuhllehne.
»Wir haben ein paar Leute rausgeschickt, um die anderen Pen…« Müller stockte, als ihn Grotewohls Blick traf, und verbesserte sich. »Um die anderen Obdachlosen zu fragen, ob ihnen was aufgefallen ist, ob sie das Opfer kannten und so weiter.«
»Prima.« Köhler war froh, in die Routine einzusteigen. »Gibt es schon was bezüglich der Obduktion?«
Die beiden jungen Kollegen schüttelten den Kopf.
»Noch nicht«, antwortete Brauer. »Die Ergebnisse sollten aber jeden Moment eintreffen.«
»Das wäre gut, denn heute Nachmittag kommt der Vater des Opfers, um die Leiche zu identifizieren. Da wäre es blöd, wenn sie noch nicht wieder zugenäht wäre.«
»Was können wir bis dahin tun?«, fragte Grotewohl.
Köhler hob die Schultern und sagte: »Abwarten und Mittagessen.«
Als Grotewohl und Köhler aus der Kantine zurück waren, lagen die Ergebnisse der Obduktion und die ersten Berichte der Befragung verschiedener Obdachloser vom Mainufer vor. Kurzerhand berief Ballauf eine Besprechung ein.
»Schön, dass …« Weiter kam er nicht, denn die Tür flog auf und Laußner stolperte unter lautem Getöse in den Raum.
»Sorry«, sagte er und suchte sich einen Platz. Er knallte einen Block auf den Tisch und warf sich in die Lehne. Der Stuhl ächzte unter seinem massiven Gewicht. »Ich wäre dann so weit.« Unter seinem Schnurrbart wurde ein breites Grinsen sichtbar.
Ballauf ließ ihm das durchgehen, kommentierte das Auftreten seines Mitarbeiters jedoch mit einem missbilligenden Kopfschütteln. »Na gut«, sagte er. »Dann sind wir ja jetzt komplett.« Er warf einen prüfenden Blick in die Runde. Alle sahen sich gegenseitig an. Keiner von ihnen sagte etwas. »Egal.« Ballauf fuhr fort. »Wir haben den Autopsiebericht vorliegen. Darin steht, dass die aufgefundene Frau, von der wir bisher unbestätigt davon ausgehen, dass es sich um Laura Walkenhorst handelt, durch den berühmten Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf getötet wurde. Da dieser nicht durch sie selbst ausgeführt oder von einem Sturz herbeigeführt werden konnte, gehen wir von einer Fremdbeteiligung aus. Also ermitteln wir ab sofort offiziell in einem Mordfall.«
»Entschuldigung.« Brauer hob die Hand. »Ich will mich nicht blamieren, aber was macht Sie so sicher, dass es ein Schlag war?«
Ballauf sah Brauer abschätzend an. »Gut … Sie sind der Neue.« Er holte tief Luft und setzte zu einem Leierton an. »Es gibt einen Unterschied im Verletzungsmuster zwischen einem Schlag mit dem berühmten stumpfen Gegenstand und einem Sturz oder einem Unfallgeschehen. Das ist anhand der Wundränder und des Verletzungsmusters klar zu erkennen. Und wenn in der Obduktion von einem stumpfen Gegenstand die Rede ist, dann handelt es sich immer um ein Gewaltverbrechen.«
Brauer nickte und bedankte sich für die Belehrung.
Grotewohl wirkte zufrieden.
»Wer von euch hat die Penner am Main befragt?«, fuhr Ballauf fort.
Bei dem Wort »Penner« zuckte Grotewohl zusammen. Ballauf ignorierte diese Gefühlsregung.
»Ich«, antwortete Schmidt und hob die Hand. Mit einem Bleistift deutete er auf seinen Lieblingskollegen. »Und Laußner.«
»Natürlich. Die siamesischen Bullen«, flüsterte Grotewohl.
Köhler kicherte.
»Niemand von denen will was gesehen haben.« Schmidt nahm wieder Platz.
»War das alles?«, wollte Ballauf wissen.
Laußners Blick suchte den von Schmidt. Beide machten einen ratlosen Eindruck.
»Öh … ja«, sagte Schmidt. »Den ganzen Morgen über haben wir die Penner am Main abgeklappert, aber keiner wusste was.«
Jetzt hatte Grotewohl genug. »Können wir uns bitte auf einen der Begriffe ›Obdachlose‹ oder ›Wohnsitzlose‹ einigen?«, forderte sie mit deutlich strengem Unterton.
»Wieso?«, wollte Laußner wissen.
»Weil das Wort ›Penner‹ despektierlich und menschenverachtend ist.«
»Despek… was?«
»…tierlich, du Hohlkopf. Und jetzt reiß dich gefälligst zusammen und zeig uns, dass du ein Profi bist. Ein einfaches ›Keiner von denen hat was gesehen‹ ist mir hier zu wenig. Vielleicht habt ihr nicht richtig gefragt.«
»Jetzt mach mal keinen Stress, Grotte!«, blaffte Laußner. »Wir haben die Pen… – die Obdachlosen – gefragt, ob sie in der angenommenen Tatzeit etwas Ungewöhnliches gesehen haben, und da hat keiner was gesehen. Was sollen wir denn machen? Etwas erfinden, damit die hochwohlgeborene politisch korrekte Lesbe zufrieden ist, oder was?«
»Vorsicht!«, ging Ballauf dazwischen. »Nicht persönlich werden, Laußner.«
»Ist doch wahr!«, motzte er. »Die macht immer einen Affen, als wäre sie die Chefin.« Laußner wandte sich an Grotewohl. »Bist du aber nicht! Du bist hier nur Ermittlerin, genauso wie ich und Schmidt und alle hier im Raum, also spiel dich nicht immer so auf!« Er war in Fahrt geraten. »Der Einzigste, der mir was zu sagen hat, ist der da.« Er zeigte auf Ballauf.
»Der steht im Stall, mein Freund, und jetzt komm wieder runter«, versuchte Ballauf zu schlichten. Aus Deeskalationsgründen unterließ er es hinzuzufügen, dass es ›der Einzige‹ hieß und nicht ›der Einzigste‹.
»Die geht mir auf den Sack.«
»Haben wir mitbekommen, und jetzt stell mal die Schnappatmung ein. Was sind denn das für Manieren hier?«
Laußner nahm wieder Platz und schmollte.
»Laußner ist nicht befördert worden und hat Stress mit dem Personalrat.« Schmidt wollte seinen Freund in Schutz nehmen, doch das ging nach hinten los.
»Halt die Fresse!«, brüllte Laußner. »Das geht hier keinen was an.«
»Aber …«
Der hochschnellende Drohfinger seines Kollegen schnitt Schmidt den Satz ab. Alle Blicke waren auf die beiden Streithähne gerichtet.
»So«, machte Ballauf, dem die Situation sichtlich unangenehm war, und räumte den Papierstapel vor sich auf. »Die Show ist vorbei. Der Obduktionsbericht ist zur Einsicht verfügbar, und wenn ich mich recht entsinne, steht da noch ein Termin mit dem mutmaßlichen Vater der Leiche an.«
Grotewohl und Köhler nickten und beeilten sich, den Raum zu verlassen. Laußner saß wie ein beleidigtes Kind, dessen Geburtstag geplatzt war, auf seinem Stuhl und rührte sich nicht. Alle anderen verließen zügig den Raum.
Auf dem Flur hielt Grotewohl Schmidt an.
»Stimmt das?«
»Was?«
»Dass Laußner nicht befördert wurde.«
Schmidt nickte traurig. »Das Blöde ist, dass er mit der Beförderung gerechnet hatte und sich schon ein Wohnmobil bestellt hat.«
»Oh Mann!«, stieß Grotewohl aus. »Man verkauft doch nicht das Fell, bevor der Bär erlegt ist.«
»Was soll ich sagen?« Schmidt schien in Sorge um seinen Freund. »Er war aber wirklich mal dran jetzt. Schon beim letzten Mal haben sie ihn nicht berücksichtigt. Der wird auch nicht jünger.«
Das erste Mal, seit sie Laußner kannte, empfand Grotewohl so etwas wie Mitgefühl für ihren Kollegen. Auch wenn er im Umgang schwierig war, war er doch ein passabler Polizist, der eine Beförderung verdient hatte. Schließlich war er seit mehr als zwanzig Jahren bei der Truppe. »Das tut mir leid«, sagte sie deshalb.
»Eine Sauerei ist das!«, kommentierte Schmidt.
Grotewohl hakte nicht mehr nach. Ballauf kam vorbei und sie heftete sich an ihn. »Chef, ich will, dass mein Team noch mal die Obdachlosen befragt. Die müssen doch was gesehen haben.«
»Haben das nicht Schmidt und Laußner bereits getan? Dann wäre das ja wohl Zeitverschwendung.«
Grotewohl wollte insistieren, aber Ballauf ließ sie nicht zu Wort kommen. »Es ist spät«, sagte der Gruppenleiter. »Ihr müsst los. Bei dem Verkehr braucht ihr ewig bis nach Sachsenhausen.«
Grotewohl warf einen Blick auf die Uhr. »Scheiße!«, stieß sie aus. »Shaft!«, brüllte sie.
Von irgendwoher kam ein undeutliches »Was ist?«
»Schwing deinen schwarzen Arsch hierher, wir müssen los!«
Die Fahrt hinüber auf die andere Mainseite verlief zäh. Der Verkehr in der Innenstadt war dem Kollaps nahe. Durch den Raderlass und den dadurch bedingten massiven Ausbau der Radwege in der Innenstadt bei gleichzeitiger Reduzierung der Fahrspuren für Autos war das Chaos vorprogrammiert.
»Da wären wir zu Fuß schneller gewesen«, moserte Grotewohl, als sie an der Konstablerwache im Stau standen. »Hier geht ja gar nichts mehr!«
»Hätten wir mit der Bahn fahren sollen?«, fragte Köhler.
»Warum nicht?«
»Weil das viel zu lange gedauert hätte und wir jetzt völlig unflexibel wären.«
»Vom Präsidium bis zum Schweizer Platz braucht man gerade mal fünfzehn Minuten mit der U-Bahn.«
»Die Rechtsmedizin ist aber in der Kennedyallee.«
»Die paar Meter könnte man doch laufen.«
»Vom Schweizer Platz bis zur Rechtsmedizin sind es locker zwei Kilometer.« Köhler konnte mit dem Gedanken, die öffentlichen Verkehrsmittel für Dienstfahrten zu nutzen, nicht warm werden. Grotewohl fing aber immer wieder davon an, seit sie ihre Sympathie für die globale soziale Bewegung »Fridays for Future« entdeckt hatte. »Dein Umweltbewusstsein in allen Ehren, Grotte, aber die Polizei fährt nicht mit der Bahn zur Einsatzstelle. Das geht einfach nicht!«
»Und sie verschleudert auch nicht unsinnig viel fossilen Brennstoff durch die Nutzung privater Fahrzeuge ihrer Mitarbeiter.« Mit dieser Bemerkung hatte Grotewohl Köhlers wunden Punkt getroffen. Gegen seinen historischen, top gepflegten Mercedes durfte niemand etwas sagen.
»Du befindest dich in einem Klassiker der Automobilgeschichte und nicht in irgendeinem Auto.« Köhler musste seinen Zorn unterdrücken. »Ich werde bestimmt nicht in einem Dienst-Opel durch die Stadt fahren. Schließlich habe ich Stil!«
Grotewohl kannte die Feinfühligkeit ihres langjährigen Kollegen sehr genau, weshalb sie sich gelegentlich einen Spaß erlaubte und ihn bewusst provozierte. »Wie viel schluckt denn die Karre?«, legte sie nach.
»Dieser Wagen benötigt gerade mal neun Komma fünf Liter auf einhundert Kilometer. Das ist nicht viel mehr, als ein Fahrzeug der heutigen Generation verbraucht. Außerdem – und das muss erwähnt sein – ist er 1999 zum Sportwagen des Jahrhunderts gewählt worden. Dieses Fahrzeug ist über jeden Zweifel erhaben.«
Grotewohl beließ es dabei. Sie wollte ihren Partner nicht weiter provozieren. In Anbetracht der bevorstehenden Aufgabe wäre das keine gute Idee gewesen. Ein schlecht gelaunter Köhler neigte zu unkontrolliertem Verhalten.
Letztendlich erreichten sie dann doch noch pünktlich die Rechtsmedizin in der Kennedyallee. Zeitgleich mit ihnen fuhr ein schwarzer Maibach vor. Köhler war beeindruckt von dem Luxusgefährt, während Grotewohl noch nicht einmal bewusst war, dass es sich um ein Auto handelte, für das man den Preis einer Eigentumswohnung auf den Tisch blätterte. Zwei Männer stiegen aus dem Maibach. Einer davon war den Ermittlern bekannt. Es handelte sich um Oskar Bajohr. Er trat an den Kofferraum des Fahrzeugs, öffnete ihn per Knopfdruck und hob einen Rollstuhl heraus, den er neben der hinteren Tür platzierte. Der zweite Mann war in einen dunkelblauen Anzug gekleidet und schien der Fahrer zu sein. Er machte keine Anstalten, Bajohr zu helfen, den körperlich angeschlagenen wirkenden Walkenhorst aus dem Auto in den Rollstuhl zu bugsieren.
Köhler und Grotewohl standen ein wenig abseits und beobachteten die Szenerie. Mühevoll kletterte Walkenhorst aus dem Maibach, hielt sich kurz auf einem Bein und ließ sich schließlich in den Rollstuhl fallen. Wenig später kam das Dreigestirn auf die Ermittler zu.
»Guten Tag«, begrüßte Walkenhorst die Polizisten. »Darf ich vorstellen?« Er deutete auf den Fahrer. »Das ist mein Sohn, Frederic Walkenhorst. Ich gehe davon aus, dass es für Sie in Ordnung ist, wenn er mir bei der Identifizierung behilflich ist. Wir haben Laura beide eine Weile nicht gesehen.«
»Selbstverständlich«, erwiderte Köhler. Irgendetwas in seinem Blick ließ erkennen, dass er die Situation nicht gänzlich erfasste.
»Mein Sohn betreibt einen exklusiven Limousinenservice«, erklärte der alte Walkenhorst mit einem selbstgefälligen Lächeln. »Deshalb der Auftritt als Chauffeur. Und bevor Sie fragen: Nein, Frederic hatte kein Interesse, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, er wollte sich etwas Eigenes aufbauen.«
»Ich kann für mich selbst reden«, fuhr ihm der Sohn in die Parade. »Und ich glaube kaum, dass sich die beiden für unsere Familiengeschichten interessieren. Du langweilst sie damit nur.« Er wandte sich an Grotewohl und Köhler und reichte beiden die Hand. »Wenn Sie mal einen Fahrservice benötigen, wir haben auch preisgünstigere Modelle als dieses.« Nicht ohne Stolz deutete er auf den Maibach.
»Besten Dank, aber ich bevorzuge Klassiker«, konterte Köhler und warf einen Blick auf seinen Oldtimer, der neben dem Maibach stand und dabei eine glänzende Figur machte.
»Ist das etwa Ihrer?«, fragte Walkenhorst junior. »Handelt es sich um einen Neunzehnhundertachtundfünfziger?«
»Siebenundfünfziger«, berichtigte Köhler.
»Wahnsinn! Noch dazu in einem so guten Zustand.« Der junge Walkenhorst schien ernsthaft begeistert zu sein. »Aber die Lackierung ist nicht ab Werk.«
»Ich sehe, ich habe es mit einem Fachmann zu tun.« Köhler war beeindruckt. »Ich habe ihn selbst aufgebaut und dann in Lackschuhschwarz lackiert.«
»Respekt!«
»Danke, Ihrer ist aber auch nicht zu verachten«, gab Köhler das Kompliment zurück.
Bevor die Schwärmerei über Fortbewegungsmittel der besonderen Art ausarten konnte, unterbrach Grotewohl die Lobpreisungen. »Ich denke, wir sind aus einem anderen Grund hier«, sagte sie geschäftig. »Wenn wir es dann hinter uns bringen könnten …«
In stillem Einverständnis setzte sich die kleine Gruppe in Bewegung. Wenig später befanden sie sich in einem schmucklosen Raum, in dem die Identifizierung stattfinden sollte. Der Rechtsmediziner bereitete Vater und Bruder der Ermordeten auf den wenig schönen Anblick vor und erklärte ihnen, dass er die Frau für die Obduktion hatte aufschneiden müssen und ihr Körper deshalb verschiedene Nähte aufwies.
»Gibt es denn ein unverkennbares Zeichen, das Ihre Tochter zweifelsfrei identifiziert?« Grotewohl versuchte, mit dieser Frage die Aufenthaltsdauer in der Leichenhalle so kurz wie möglich zu halten. Sie hasste diesen Raum. Er erinnerte sie an ihre eigene Vergänglichkeit.
»Als sie uns verließ, war sie weder tätowiert noch gepierct.« Der alte Walkenhorst starrte auf die abgedeckte Leiche und wirkte seltsam entrückt.
»Ein Muttermal oder eine Narbe?«, versuchte Grotewohl es weiter. Sie sah hinüber zu Frederic Walkenhorst, der neben seinem Vater stand und seinen Blick auf den Boden geheftet hatte.
»Sie hatte eine Narbe an der rechten Wade; die hat sie sich bei einem Reitunfall zugezogen. Etwa zehn Zentimeter.«
Köhler sah den Mitarbeiter der Rechtsmedizin an. Dieser schlug die Abdeckung an der rechten unteren Seite zurück, hob das Bein der Leiche an und schaute nach.
»Da befindet sich eine solche Narbe.«
»Das heißt ja noch nichts«, protestierte Frederic Walkenhorst. »Ich will meine Schwester jetzt sehen!«
»Beruhigen Sie sich.« Köhler wollte auf keinen Fall, dass einer der beiden Angehörigen etwas Unüberlegtes tat. Er machte einen Schritt auf den Junior zu, woraufhin dieser innehielt. Ihre Blicke trafen sich.
»Decken Sie bitte die Leiche auf«, sagte Köhler zu dem Assistenten, ohne den Blick von Frederic Walkenhorst zu nehmen. Der Mann tat, wie ihm geheißen. Sekunden später lag Laura Walkenhorst für alle sichtbar nackt vor ihnen. Die beiden Angehörigen warfen einen Blick auf die Frau. Der Alte kämpfte mit den Tränen und nickte, woraufhin die Leiche wieder abgedeckt wurde.
»Das ist sie!«
Schweigend standen Köhler und Grotewohl im Hof der Rechtsmedizin und rauchten. Als sie Bajohr und die Walkenhorsts aus dem Gebäude kommen sahen, drückten sie ihre Zigaretten in einem großen mit Sand gefüllten Aschenbecher aus und gingen den dreien entgegen.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte Grotewohl leise.
»Geht schon«, antwortete der Junior. »Sie müssen wissen, dass wir seit langer Zeit keinen Kontakt mehr zu Laura hatten.«
Köhlers Telefon klingelte. Hastig warf er einen Blick auf das Display und drückte den Anruf weg. »Gut, dass Sie darauf zu sprechen kommen«, hakte er ein. »Sie werden sicherlich verstehen, dass wir Ihnen noch ein paar Fragen zu Ihrer Angehörigen stellen müssen.«
»Sicher.« Thomas Walkenhorst schien mit der Tatsache, dass seine Tochter tot war, gut umgehen zu können. Mal abgesehen von der einzelnen Träne, die ihm während der Gegenüberstellung über die Wange gelaufen war, hatte Köhler keinerlei Regung feststellen können. »Wann sollen wir zu Ihnen kommen?«
»Wir können das auch gerne bei Ihnen machen«, schlug Grotewohl dem gebrechlich wirkenden Mann vor.
»Nein, nein!« Thomas Walkenhorst winkte ab. »Was mich betrifft, bin ich ganz froh, mal was anderes zu sehen.« Er deutete auf seinen Rollstuhl. »Seit meinem Skiunfall im Januar bin ich an dieses Ding gefesselt. Schlechtes Heilfleisch, sagt mein Arzt.« Er lachte bitter. »Ich sollte mir einen anderen suchen.«
»Vater, ich glaube kaum, dass sich die beiden für deine Krankengeschichte interessieren.« Frederic Walkenhorst lächelte verlegen, gerade so, als müsse er sich für das alberne Benehmen seines Vaters entschuldigen.
»Um was für eine Verletzung handelt es sich denn?«, erkundigte sich Köhler, den Einwand des Sohnes ignorierend.
»Schien- und Wadenbein«, antwortete der Mann im Rollstuhl. »Wie ein dürrer Ast. Komplett durch. Mit Platten und Schrauben fixiert.«
Köhler zog mitleidig die Luft durch die Zähne und schnitt eine Grimasse. »Unangenehm«, kommentierte er. »Hatte ich auch mal. Ist beim Fußball passiert.«
»Dann können Sie ja sicherlich mitfühlen.«
Grotewohl warf Köhler einen fragenden Blick zu.
Der wiegelte ab und setzte das Gespräch fort. »Oh ja!« Er trat an den Rollstuhl und bugsierte den alten Mann in Richtung ihrer Fahrzeuge.
Angesichts des Szenarios – ein schwarzer Mann schob einen weißen Mann im Rollstuhl – unterdrückte Grotewohl ein Lachen. Die Ähnlichkeit zu Philippe und seinem Pfleger in der Komödie »Ziemlich beste Freunde« war nicht zu leugnen.
»Warum dauert bei Ihnen die Heilung so lange?«, fragte Köhler im Gehen. »Bei mir war das innerhalb von sechs Wochen erledigt.«
»Hat sich entzündet.«
»Verdammt!«, stieß Köhler aus.
»Das können Sie laut sagen. Eine entsetzliche Quälerei ist das.«
Als sie den Maibach erreichten, hielt Bajohr bereits die hintere Tür auf. Der Leibwächter verzog keine Miene. Köhler übergab ihm den Patienten, der daraufhin mit Mühe in die Luxuskarosse einstieg.
»Moment!«, rief Grotewohl, als die Tür hinter dem alten Mann zuschlug. »Wir müssen noch einen Termin machen.«
»Das können Sie gerne mit mir besprechen.« Bajohr baute sich vor der knapp einsfünfzig großen Polizistin auf.
Sie blickte auf seine Brust. »Aha«, kommentierte sie schnippisch. »Sie sind also neben all Ihren anderen Funktionen auch seine Sekretärin. Multitalent, was?«
»Sozusagen.«
Der Kerl ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Grotewohls Handy klingelte, doch sie ignorierte es. Auf keinen Fall würde sie das Duell gegen diesen Muskelmann verlieren.
»Wollen Sie nicht an Ihr Telefon gehen?«, fragte dieser prompt.
»Wenns wichtig ist, ruft er noch mal an.«
»Woher wollen Sie wissen, dass es ein Er ist?«
»Ach, Gleichstellungsbeauftragter sind Sie auch noch. Ämterhäufung nennt man das.«
Köhler stöhnte innerlich. Laußner mit seinem Gendergehabe hatte ihm schon gereicht. Jetzt kam auch noch dieses aufgeblasene Muskelpaket und schlug in die gleiche Bresche. Insgeheim bewunderte er, wie Grotewohl ihm Paroli bot.
»Was ist eigentlich Ihr Problem?«, blaffte Bajohr.
Grotewohl hätte nun zur Höchstform auflaufen und den Bodyguard nach allen Regeln der Kunst verbal attackieren können, doch Köhler setzte der Show ein Ende.
»Dann wollen wir das hier mal abkürzen. Ich will es Ihnen einfach machen, Herr Bajohr. Sie haben sicher alle Hände voll zu tun.« Er schob Grotewohl zur Seite. Jetzt klingelte sein Handy, doch auch er ignorierte den Signalton. »Morgen Vormittag um elf Uhr in unserem Büro.« Mit einer eleganten Bewegung zückte er eine Visitenkarte und reichte sie dem Leibwächter. »Zimmer viertausenddreihundertneun im vierten Stock. Und bitte seien Sie pünktlich!« Ohne eine Reaktion abzuwarten, drehte er sich um und ging hinüber zu seinem Mercedes.
Wie bestellt und nicht abgeholt stand Bajohr da und hielt die Visitenkarte in der Hand.
Grotewohl schlug ihm gönnerhaft auf die Schulter und sagte: »Ist eine Mordermittlung, da versteht er keinen Spaß. Zur Not verschieben Sie einfach ein paar Termine.« Sie zwinkerte dem Mann zu und wandte sich zu dem Sohn des Bankiers um, der die Szene grinsend verfolgt hatte. »Mit Ihnen möchte ich morgen am frühen Nachmittag reden, Herr Walkenhorst.«
»Wann genau?«, hakte der Junior nach. »Im Gegensatz zu meinem Vater habe ich wirklich Termine, die ich einhalten muss.«
»Passt Ihnen vierzehn Uhr?«
»Passt.«
»Na dann …«