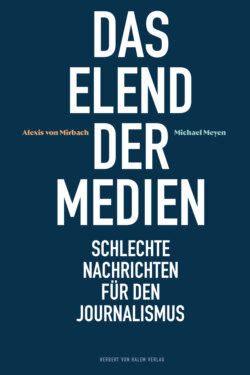Читать книгу Das Elend der Medien - Michael Meyen - Страница 16
Der Frame des Dritten Weges
ОглавлениеDie theoretischen Gedanken Bourdieus kann für das journalistische Feld in Deutschland niemand besser mit Leben füllen als Albrecht Müller, früher unter anderem Wahlkampf-Manager für Willy Brandt und Gründer der NachDenkSeiten. Müller hat erlebt, wie vor der Bundestagswahl 1972 »anonyme Kreise« um die CDU eine massive Kampagne gegen die Ostpolitik Brands führten.144 Damals habe ihm Spiegel-Chefredakteur Günter Gaus in einem Hintergrundgespräch die Idee für eine Gegenkampagne geliefert, die sich um den Begriff des ›großen Geldes‹ drehte. Wie das ›große Geld‹ heute den Journalismus nach allen Regeln der Kunst regiert, zeigt Müller an zahlreichen Beispielen, etwa beim »Nato-Angriffskrieg« in Jugoslawien oder bei der Vorbereitung der Agenda 2010 unter Federführung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel.
Für Albrecht Müller und Bourdieu wurzelt das Elend der Medien im Neoliberalismus und in der Umkehrung des sozialdemokratischen Milieus. Ich nenne das Narrativ der beiden den ›Frame des Dritten Weges‹. Der Begriff geht auf Anthony Giddens zurück, der in den 1990er-Jahren eine Alternative zu Sozialismus und Kapitalismus ausarbeitete145 und in der Soziologie gemeinsam mit Ulrich Beck der neoliberalen Ideologie »das Wort redet«, indem sie Risikogesellschaft, Globalisierung und Individualisierung »feiern«.146
Die »wissenschaftlich vorhersehbaren Folgen der von neoliberalen Philosophien beseelten Politik« sagt Bourdieu 1999 auf eine Weise voraus, als wäre Donald Trump bereits Präsident der USA: Sehnsucht nach dem Nationalstaat, Ausländerfeindlichkeit und ganze Heerscharen von Menschen, die sich dem »erstbesten Demagogen« hingeben. Dazu zynische »Kitschfiguren« mit dem Anschein politischer Machtfülle, die aber nur mediale Mechanismen bedienen und die Entpolitisierung enttäuschter Menschen verkörpern.147 Bei der Problemdefinition ähnelt der Dritte-Weg-Frame dem Desinformations-Frame: Entpolitisierung sowie mehr rechte Akteure und mehr Populisten in einem öffentlich verrückten Raum.
Doch die Wähler von rechten Demagogen sind bei Bourdieu nur ein Symptom vielfältigen gesellschaftlichen Leids – und das Produkt einer symbolischen Revolution.
Bourdieu spricht von einer konservativen Revolution, da der Neoliberalismus mit dem Schein des Revolutionären antritt – als ein »Programm der planmäßigen Zerstörung der Kollektive«, um der »Utopie des reinen und vollkommenen Marktes den Weg zu bereiten.«148 So wie im Deutschland der 1930er-Jahre die Rückkehr zu Blut und Boden gefeiert wurde, glorifiziert der Neoliberalismus den Darwinismus: eine Rückkehr zum Raubtierkapitalismus. Bourdieu spricht von einer symbolischen Revolution, weil sich das Modell nicht nur durch die ökonomischen Pressionen von Banken, Weltwährungsfonds oder internationalen Unternehmen ausbreitet, sondern auch über Thinktanks, Experten und vor allem Journalisten, die damit symbolische Gewalt ausüben.149
Die Macht der Medien ist bei Bourdieu einerseits groß und andererseits klein. Klein ist sie aufgrund der Heteronomie des journalistischen Feldes. Die Abhängigkeit von externen Zwängen sei groß (insbesondere von Ökonomie und Politik). Trotz bester persönlicher Absichten werden Journalisten so zu »Marionetten eines Zwangszusammenhangs« – zu einer dominierten Gruppe, die über ein »seltenes Machtpotential« verfügt: Zugang zur Öffentlichkeit. Groß ist die Macht der Medien, da sie symbolische Herrschaft versprechen und durch »Intrusionseffekte« in die anderen Felder »hineinstrahlen«. Da die Logik des journalistischen Feldes ökonomischen Zwängen folgt, stellt Bourdieu sich die Medien wie ein trojanisches Pferd vor, das seine Bewertungsinstanzen in andere Felder einschleust.150
Im Kampf gegen den Wohlfahrtsstaat ist bei Bourdieu der Begriff (frame) Globalisierung »die entscheidende Waffe« – ein Mythos oder eine »Ideenmacht«, die etwa den gesellschaftlichen Glauben erzeugen kann, Arbeitnehmerrechte müssten zwangsläufig abgebaut werden, um gegen die Konkurrenz aus Bangladesch zu bestehen.151 Wie Medien-Figuren die neuen Denkkategorien »unablässig einhämmern« und die »Denk- und Wahrnehmungsstrukturen« so lange verschieben, bis die ökonomischen Vulgata als alternativlose Glaubenssätze und gemeinsamer Erwartungshorizont erscheinen, zeigt Bourdieu eindrücklich am Beispiel eines Interviews mit Hans Tietmeyer in der Zeitung Le Monde aus dem Jahr 1996. Der damalige Präsident der Bundesbank wird in der Zeitung als »Hohepriester der D-Mark« vorgestellt und damit in den Status eines »Meisterdenkers« erhoben. Tietmeyers eigentlich fatalistische Botschaft ›Sozialabbau‹ verwandelt sich durch lexikalische Spielereien und Euphemismen in eine ›Befreiungsbotschaft‹: »Reform«, »Flexibilität«, »Wettbewerbsfähigkeit«, »Steuersenkung«, »dauerhaftes Wachstum« und (das ist Tietmeyers Schlüsselwort) »Vertrauen der Märkte«. Auf diese Weise werde suggeriert, dass Politiker keine Wahl haben und harte Beschlüsse treffen müssen. »Das Volk« ist im neoliberalen Denken der Gegensatz zum Markt und wird mit »Faulheit« und »Trägheit des Geistes« assoziiert. Wer wirtschaftlich scheitert, ist selbst verantwortlich.152
Heute verbreitet der Begriff ›Globalisierung‹ zwar kaum noch Schrecken, als Drohgebärde aber kann er ersetzt werden – zum Beispiel durch ›Digitalisierung‹, ›Handelskrieg‹ oder ›Desinformation‹. An Aktualität eingebüßt haben Bourdieus Lösungsvorschläge nichts: In seinen Streitschriften fordert er Gewerkschaften auf, sich international zu solidarisieren. Und von Intellektuellen verlangt er, den herrschenden Diskurs mit allen Mitteln zu kritisieren und eine symbolische Konterrevolution zu starten. Wir sollen die Ökonomie des Neoliberalismus durch eine Ökonomie des Glücks ersetzen.153
Auch für Journalisten hat Bourdieu einen Vorschlag. Sie sollen sich der ökonomischen und politischen Zwänge bewusst werden.154 Er hat zum Beispiel beschrieben, wie sich die Medien unbewusst in den Dienst von Demagogen stellen: Erst bauschen die Journalisten eine Meldung auf und gießen Öl ins Feuer, um sich anschließend »als schöne humanistische Seelen noch einen Tugendpreis dafür zu sichern«, wenn »sie lauthals moralisierend die rassistische Intervention einer Partei verurteilen, die sie überhaupt erst zu dem gemacht haben, was sie ist.«155 Bei der Trump-Wahl 2016 hat sich Geschichte wiederholt. Die Berichterstattung über den Kandidaten entsprach schon im März einem Werbewert von drei Milliarden US-Dollar.156 Dieser Befund hielt kein großes Medium davon ab, über jeden Tweet und jeden Skandal zu berichten und Trump dabei in der Regel zu verdammen.
Wie sich Bourdieu und sein Schüler Patrick Champagne den idealen Journalismus vorstellen, kann man schon im Buch Das Elend der Welt lesen. In Kurzform: weg von Konflikten, flüchtigen Berichten und Dramen, hin zum Alltag.157 Dazu gehöre auch, die Auffassung von ›Politik‹ zu überdenken und das Private einzubeziehen. Für die Journalisten heißt das, schreibt Bourdieu 1992, sich nicht nur für ökologische, antirassistische oder feministische Orientierungen zu öffnen, sondern auch für die diffusen Erwartungen und Hoffnungen der Bürger.158
Zugleich hat Bourdieu einen Mechanismus benannt, der die öffentliche Kritik am Neoliberalismus erschwert. Ihm, dem Franzosen, ist »Anti-Amerikanismus« vorgeworfen worden – in Deutschland, das weiß er, ein »Verdammungsurteil«.159 Bourdieu ist 2002 gestorben. Würde er heute twittern, könnte man sich an einem Shitstorm beteiligen und ihm vielleicht strukturellen Antisemitismus unterstellen. Als »öffentlicher Intellektueller« und Mitgründer von Attac sprach er von der »unsichtbaren Hand der Mächtigen«, der »Hochfinanz« sowie »grenzüberschreitenden Kräften des Finanzkapitals« und hat einen Gegensatz gesehen zwischen den herrschenden, kosmopolitischen Intelligenz-Eliten, die in der Berichterstattung »ganz polyglott« und »multikulturell« daherkommen, sowie dem wachsenden Prekariat, der Arbeiterschaft, den »nationalen« und »provinziellen« Ortsansässigen. Bourdieu stellte den US-Dollar als internationale Reservewährung in Frage. Er beschrieb, wie Weltbank, IWF oder WHO unter Berufung auf die Wissenschaft helfen, Finanzinteressen global durchzusetzen, und wie die Philanthropen Bill Gates und George Soros unter dem Schein der Wohltätigkeit die »immaterielle Ökonomie« und »fleischgewordene Höllenmaschine« des Silicon Valley wie beseelt vorantreiben. Bourdieu relativierte den Nationalsozialismus durch einen Vergleich mit dem Neoliberalismus, erkannte in der Macht der Finanzwelt Züge der »Kolonisation«, sah die europäische Kultur in Gefahr (Kulturpessimist!) und fühlte sich durch die Globalisierung »gezwungen, Dinge zu verteidigen, die man nicht verteidigen möchte: den Nationalstaat.«160
Dass der Gegendiskurs zum Neoliberalismus seinerzeit mit Anti-Amerikanismus gleichgesetzt wurde, erklärte Bourdieu schlicht damit, dass die internationale Finanzökonomie dem US-Modell folgt und damit in ein bestimmtes System von Werten und Überzeugungen sowie einer moralischen Weltsicht eingebettet sei. Somit werde die Kritik am Neoliberalismus automatisch mit den sozialen und kognitiven Strukturen der US-Ordnung verbunden. Um es klar zu sagen: Bourdieus Gegendiskurs richtete sich gegen die neoliberale Politik – und sonst nichts.161 Wie die völkische Gesinnung unter den Intellektuellen im Deutschland der (Vor-)Nazi-Zeit entstand, als »konservative Revolutionäre« mit einer Strategie des Drittens Weges das Gegensatzpaar von Kapitalismus und Sozialismus überwinden wollten, arbeitete er 1975 mit einem Blick auf die politische Ontologie Martin Heideggers heraus.162