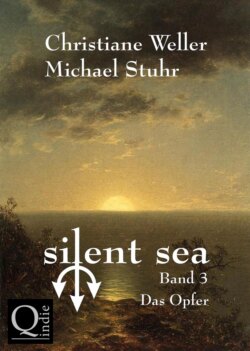Читать книгу DAS OPFER - Michael Stuhr - Страница 10
06 HANDY
ОглавлениеIch erzähle Lou in groben Zügen, wie das Verhör gelaufen ist, und als ich mich wieder einigermaßen beruhigt habe, nehmen wir uns ein Taxi. Ich werfe dem Gebäude des Police-Departments noch einen langen Blick zu. Dort liegt Alicia tot im Keller und sie halten Diego fest. – Was soll er denn bloß mit dieser Sache zu tun haben? Ich verstehe das alles nicht. – Innerhalb von vierundzwanzig Stunden ist die Welt wie ich sie mal kannte völlig in sich zusammengebrochen, aber wenigstens bin ich jetzt diese schrecklichen Selbstmordgedanken los. Das wird mir nie wieder passieren, dass ich auf die Einflüsterungen einer Prätorianerfrau hereinfalle, nehme ich mir ganz fest vor.
Lou nennt dem Fahrer ihre Adresse. Sie will mir endlich die Fachbücher geben, die sie mir versprochen hat, und dann wird sie mich zum International House bringen.
Obwohl ich wirklich immer noch genug Schwierigkeiten habe, spüre ich, wie sich eine hektische Heiterkeit in mir ausbreitet, und Lou lässt sich von mir anstecken. Ich zeige ihr eine Frau, die mit einer viel zu kleinen Haushaltsschere an ihrer Gartenhecke herumschnippelt, und wir kichern. Ein dicker Mann in einer violetten Elastikhose auf einem Fahrrad lässt uns losprusten, und ein kleiner Hund, der auf einem Rasenstück komische Sprünge macht, gibt uns den Rest: Wir hocken hinten im Taxi und lachen uns halbtot, während der Fahrer uns wahrscheinlich für völlig durchgedreht hält. – Sind wir ja auch!
Letzte Nacht waren wir noch drauf und dran, uns von der höchsten Brücke der Bay zu stürzen. Am Morgen hat man uns verhaftet, beschuldigt und dann in diesen widerlichen Leichenkeller geschleppt. Das war alles zu viel. Irgendwie muss der Druck raus, und er entlädt sich in einer überreizten Heiterkeit, die außer uns niemand verstehen kann.
„Halt, halt! Warten Sie!“ Ich schnelle in meinem Gurt vor und klopfe an die Trennscheibe. „Fahren Sie bitte mal da lang.“ Ich zeige in die Richtung, die ich meine. Ich habe die Straße erkannt, die wir in der letzten Nacht benutzt haben, um zur Brücke zu kommen. Da habe ich noch etwas zu erledigen.
„Meinetwegen“, brummt der Taxifahrer verdrießlich. Wahrscheinlich ärgert es ihn, dass er am Wochenende arbeiten muss, aber er biegt brav ab.
Jetzt heißt es aufpassen! Da vorne führt die Straße über eine kleine Brücke. An das Geländer kann ich mich erinnern. „Halten Sie mal kurz an.“
Zögernd stoppt der Fahrer den Wagen und schaut sich misstrauisch nach uns um. „Was soll das denn jetzt werden?“, will er wissen.
„Kleinen Moment nur“, sage ich, lächle ihn an und ziehe an dem Türöffner. Nichts rührt sich. „Lassen Sie mich raus?“, bitte ich. „Ich hab hier in der letzten Nacht was verloren.“
Der Mann brummt etwas Unverständliches, betätigt einen Schalter am Armaturenbrett, und schon lässt die Tür sich öffnen.
Der noch leicht feuchte Fleck auf dem etwas sandigen Boden dient mir als Orientierungsmarke. Hier ist mir gestern vor Wut und Enttäuschung schlecht geworden, und hier habe ich mein Handy in die Büsche gefeuert, als Diego versucht hat mich anzurufen.
Alicia hatte mir eingeflüstert, dass es für mich das Beste sei, mich umzubringen, und ich hatte ihr geglaubt. Sie hatte mir diesen hypnotischen Zwang auferlegt, mich von der Golden Gate Bridge zu stürzen, und ich war mit Lou zusammen auf dem Weg dorthin gewesen. Tote brauchen keine Handys, also weg damit. Jetzt lebe ich allerdings wieder, und ich möchte auch, dass das noch lange so bleibt.
Richtungsbestimmung, Abwurfwinkel schätzen, Schwung berücksichtigen, Datensätze für die Flugbahnberechnung synchronisieren, das geht alles vollautomatisch. - Schließlich bin ich Papas Tochter! Etwa achtzehn Schritte weit in die Botanik hinein, ein suchender Blick, und voilà, da ist es ja, mein liebes Handy.
Muss eine recht harte Landung gewesen sein, denn es hat sich in drei Teile zerlegt. Die hintere Abdeckung hat sich gelöst, und der Akku ist rausgeflogen, aber so weit ich das im Moment beurteilen kann, sind alle Teile da und unbeschädigt. Na ja, die Abdeckung des Akkufachs hat einen Sprung, aber das ist auch schon alles. Ich sammle das Zeug ein und schaue mich noch einmal gründlich um, aber da liegt nichts mehr. Vorsichtig stakse ich durch das Gestrüpp zurück zum Taxi und steige ein.
„Zurück auf die alte Strecke?“, fragt der Fahrer.
„Ja, bitte!“
„Na, geht es?“, will Lou wissen, während der Wagen wendet.
„Keine Ahnung. Ist ein Bausatz.“
„Na, dann zeig mal, was du kannst!“ Neugierig beugt sie sich vor und schaut zu, wie ich die Teile zusammensetze.
Als ich fertig bin, sieht das, was ich in der Hand halte, schon aus wie ein Handy, aber ist es auch eins? Ich bin etwas nervös, als ich es einschalte. Ja! Das Display leuchtet auf und ich soll den PIN-Code eingeben. – Schon ganz gut, und nach wenigen Augenblicken wird sogar ein Netz angezeigt.
„Jaaa!“, jubelt Lou und wir geben uns Fünf.
„Ruf mich mal an“, fordert sie, und da ich ihre Nummer nicht habe, tippt sie sie selbst ein. Sekunden später klingelt ihr Handy und sie geht ran. „Ja?“
„Hi! Hier ist die Cellphone-Klinik. Ich wollte nur eine erfolgreiche Wiederbelebung melden.“
„Und wie geht es dem Patienten?“, will sie wissen.
„Ist schon wieder ziemlich gesprächig“, gebe ich Auskunft. „Müsste mal geputzt werden, aber sonst ist alles klar.“ Ich drücke die Verbindung weg und sehe im Rückspiegel den etwas genervt wirkenden Blick des Fahrers. – So bekloppte Fahrgäste hat er bestimmt auch nur selten.
Der Fotomodus lässt sich ebenfalls aktivieren, und ich mache schnell ein Bild von Lou, wie sie breit grinsend auf der Sitzbank hockt. – Scheint auch alles in Ordnung zu sein. Ein paar schnelle Tastendrücke und das Gerät wählt Diegos Nummer. Natürlich meldet sich nur die Mailbox.
„Hallo, Lana hier. Ruf mich doch bitte zurück.“ Ich drücke die Verbindung weg. Bestimmt sitzt er noch in einem dieser schrecklich grauen Verhörräume. Meine gute Laune fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus.
„Er kommt schon zurecht.“ Ich spüre Lous Hand auf meinem Unterarm und ihre tröstenden Worte tun mir gut. Wirklich helfen kann sie mir aber auch nicht. Ich will endlich mit Diego reden. Ich will ihn fragen, ob er mir wirklich mit seinem Geld den Weg nach Berkeley geebnet hat. Ich muss jetzt endlich wissen, ob er mich gekauft hat, um mich zu benutzen, oder ob das alles nur ein Irrtum, ein Missverständnis ist. Die Ungewissheit frisst mich auf, und die Wand vor der ich stehe ist höher als je zuvor.
Ganz offensichtlich ist der Taxifahrer froh, dass er uns los wird. Ich kann es ihm nicht verdenken. Leute, die ziemlich grundlos vergnügt vor sich hin gackern und im nächsten Moment mit allen Anzeichen der Depression den Kopf hängen lassen, sind mir auch unheimlich.
Wir gehen in Lous Haus, setzen uns auf die Terrasse und essen endlich ein paar von den kalten Pancakes, die eigentlich für das Frühstück gedacht waren. Mit frisch gebrühtem Kaffee und reichlich Ahornsirup kriegt man die ganz gut runter. So langsam melden sich meine Lebensgeister wieder.
Ganz unvermittelt steigt eine heiße Freude in mir hoch. Ich wollte, so lange ich denken kann, meiner Tante nacheifern, die als Archäologin fast so wie Lara Croft durch die Welt gezogen ist. Und nun bin ich hier - in Berkeley. Ich habe die Chance, mir meinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Das werde ich nie wieder vergessen! Egal wie das Stipendium zustande gekommen ist!
Bald schon muss ich bei McCollin mein Referat halten und wenn das ordentlich werden soll, muss ich mich jetzt endlich über Lous Bücher hermachen. Vielleicht lenkt mich das ja von meinen trüben Gedanken ab. –Warum haben sie nun auch Diego verhaftet? Er ist doch kein Mörder! Er würde niemals so etwas Schreckliches zulassen wie das, was mit Alicia passiert ist! Das wäre nicht Diego! Niemals! Ich hoffe, dass ich bald mit ihm reden kann und dann wird sich alles aufklären!
Eins wird mir klar: Ich kann nicht alle Probleme auf einmal lösen und schon gar nicht alleine! Ich muss mich jetzt einfach auf meine Arbeit konzentrieren. Egal was sonst noch um mich herum den Bach runtergeht: Mein Studium werde ich mir deswegen nicht versauen! Ganz automatisch fällt mein Blick auf die Uhr.
Lou schaut mich an.
„Musst du los?“
Ich nicke und trinke meinen letzten Schluck Kaffee. „Ich muss unbedingt heute noch an deine Bücher ran, sonst schaffe ich das mit dem Referat nicht.“
Lou geht ins Wohnzimmer und kommt mit einem Leinenbeutel zurück. „Ich hab die Bücher schon zusammengepackt. Kannst du dir zu Hause ansehen“, meint sie und drückt mir den Beutel in die Hand.
„Danke!“ Ich nehme sie kurz in den Arm und wir gehen zu ihrem Volvo.
„Sie haben den Wagen durchsucht“, stellt Lou fest, als wir einsteigen. „Meine Ersatzschuhe stehen woanders.“
„Hat wohl nichts gebracht“, meine ich, und stelle mir das enttäuschte Gesicht des Detectives vor, als er den Bericht bekommen hat.
Etwas scheint Lou zu bedrücken. Während der ganzen Fahrt nach Berkeley spricht sie kaum ein Wort. Als wir über die Bay kommen, sehe ich in der Ferne die Silhouette der Golden Gate Bridge. Meine Brust und mein Schultergelenk schmerzen immer noch. – Werde ich jemals wieder auch nur ein Bild dieser Brücke ansehen können, ohne an die schreckliche Nacht zu denken, in der wir uns umbringen wollten? An den Moment, als Lou sich einfach über das Geländer kippen ließ? Im wirklich allerletzten Moment hatte ich sie retten können, und da waren wir endlich aus dieser Hypnose, oder was immer das auch gewesen ist, erwacht. Was für eine grausame Macht diese Alicia über uns gehabt hatte, aber das ist ja nun ein für alle Mal vorbei.
„Meinst du, dass es jetzt vorbei ist?“, will ich von Lou wissen.
Sie weiß genau, was ich meine. „Sie werden Diego laufen lassen, denke ich, aber du hast Recht: Jemand hat es darauf abgesehen, uns in Schwierigkeiten zu bringen. Die Polizei war zu schnell da, und sie wussten auch schon viel zu viel. Das hat jemand aus dem Hintergrund gesteuert. – Nein ich glaube nicht, dass es schon zu Ende ist.“
Mir wird ganz schlecht. „Warum machen die das mit uns?“
„Ich weiß es doch auch nicht, aber jemand hat Alicia mit voller Absicht aus dem Spiel genommen, das ist sicher.“
„Aus dem Spiel genommen?“, wiederhole ich. „Lou, sie ist tot! Das ist doch kein Spiel!“
„Das ist nur so ein Ausdruck. Man sagt ja auch verhaftet, während man meint, dass jemand gewaltsam festgehalten wird, und man ihn nach Belieben beleidigen, verdächtigen und demütigen kann.“
„Schöner Vergleich“, sage ich gallig. „Immerhin leben wir noch. Wir sollten vielleicht dankbar dafür sein.“
„Ja, sollten wir vielleicht“, nickt Lou ernst, und plötzlich reißt es mich auf meinem Sitz zu ihr herum. – Daran hatte ich ja überhaupt noch nicht gedacht. „Du – du meinst doch nicht, dass das die Jäger waren?“
Sie sieht einen Moment lang zu mir her und hebt kurz die Schultern. „Möglich wär’s, aber eigentlich sieht es mir eher so aus, als hätten unsere eigenen Leute die Finger da mit drin.“
Ich sehe sie nur stumm an
„Dieser Larence hat schließlich selbst gesagt, dass der Stier über dich wacht“, erklärt sie weiter. „Vielleicht hat es dem Stier ja nicht gefallen, was Alicia mit dir gemacht hat. Vielleicht hat er sie ja dafür bestraft.“
„Del Toro?“, frage ich zweifelnd. „Er hasst mich, weil Diego ihn meinetwegen vor Gericht gezerrt hat. Meinetwegen hat er seine Schwester verloren. Warum sollte er mir helfen?“
„Warum sollte der Detective dich belügen?“, kontert Lou. „Ob es dir gefällt oder nicht, du stehst unter dem Schutz von König Sochons Geheimdienst.“
In meinem Kopf beginnt sich ein Räderwerk zu drehen. Immer neue Zapfen rasten ein, wie bei einer Tresortür: Sochon mag mich. Ich habe den König des Atlantischen Reichs bei der Bestattung von Lous Vater kennengelernt, und er hat mir sogar etwas von seiner Lebenskraft geschenkt. Könnte er Adriano befohlen haben, mich zu überwachen und zu beschützen? Die Macht dazu hätte er, und das würde auch erklären, weshalb in Paris immer irgendwelche Leute hinter mir her waren. Besser geworden ist es erst hier. In den paar Tagen hier in Berkeley ist mir kein Beobachter aufgefallen. Die Schatten schienen verschwunden zu sein, aber da hatte ich mich wohl gründlich getäuscht.
Alles passt zusammen! Die letzten Zapfen rasten ein und die Tür, hinter der die Erkenntnis liegt, schwingt auf. „Alicia ist meinetwegen umgebracht worden“, stelle ich tonlos fest.
„Ja!“ Lou biegt in den Bancroft Way ein. Wir sind bald da.
„Sie hat mich angegriffen, und jetzt ist sie tot.“
„Du musst für jemand sehr wichtig sein“, stellt Lou fest.
Wieder beginnt das Räderwerk in meinem Kopf zu wirbeln, und die nächste Tür öffnet sich. „Könnte Diego das veranlasst haben? – Das mit der Überwachung? Das mit Alicia?“
„Vermutlich schon“, meint Lou. „Die nötigen Beziehungen hätte er - aber das würde er nicht tun!“
„Und du?“, bohre ich weiter. „Könntest du so etwas auch befehlen?“
Ich sehe, wie ihr Körper sich anspannt. „Mein Vater war ein König“, sagt sie mit spröder Stimme. „Ich habe Alicia nicht umbringen lassen!“ Sie schaut mich kurz an. „Da sind andere Interessen im Spiel.“
Ich möchte ihr so gerne glauben.
Lou nimmt Gas weg und biegt langsam in die Zufahrt zum I-House ein.
„Ist es nicht schlimm genug, dass die Jäger euch verfolgen und töten?“, bricht es aus mir heraus. „Fangt ihr jetzt auch noch an, euch gegenseitig zu bekämpfen?“
Lou stoppt den Wagen direkt vor dem Haupteingang. „Das haben wir immer schon getan. Deshalb wollte mein Vater die beiden Königreiche ja vereinigen. – Genau deswegen sollte ich ja Diego heiraten. Die Königreiche des Pazifiks und des Atlantiks sollten zusammengeführt werden, damit diese ewigen Rivalitäten aufhören.“
„Rivalitäten?“ Ich höre selbst, wie schrill und hässlich meine Stimme klingt, aber ich kann es nicht ändern. Es will einfach raus. „Ich werde beobachtet und verfolgt - man will uns in den Selbstmord treiben - eine Tote taucht auf, und da sprichst du von Rivalitäten? Man hat Alicia aus dem Spiel genommen? - Tut mir Leid, Lou, aber in meiner Sprache drückt man das anders aus. Stalking, Terror und Mord würden es da schon eher treffen. – Himmel! Was seid ihr denn für Leute? Auf was habe ich mich da bloß eingelassen.“
Lou sitzt stumm hinter dem Lenkrad. Sie umfasst es so fest, dass die Knöchel ihrer Hand hell hervortreten. Da ist nichts mehr in ihrem Gesicht, was an eine Prinzessin erinnert. Alles mädchenhaft Weiche ist daraus verschwunden. Was ich sehe, ist die starre Maske einer Kriegerin, die bereit ist, den Kampf aufzunehmen. Auch den Kampf gegen mich, wenn es sein muss. „Ja, du hast Recht!“, nickt sie. „Es gibt Entführer und Mörder in meinem Volk. Bei euch Luftatmern ist so etwas natürlich völlig undenkbar. Du hast natürlich jedes Recht uns alle dafür zu verurteilen.“
Es ist, als würde mir der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich hasse mich für meine unbedachten Worte, kaum dass ich sie ausgesprochen habe. „Bitte, Lou, versteh doch ...“, fange ich an.
„Jetzt nicht!“ Sie macht eine abwehrende Handbewegung. „Ich muss jetzt erstmal selbst nachdenken.“
Ich taste unsicher nach dem Türöffner. „Entschuldige“, bringe ich leise hervor. „Ich wollte dich nicht verletzen.“
„Geh jetzt!“, fordert Lou. „Ich rufe dich morgen an.“
„Ja!“ Ich schaue auf meine Armbanduhr. Es wird Zeit. Zum Abschied lege ich Lou kurz die Hand auf die Schulter, aber ich merke, wie sie sich unter meiner Berührung versteift.
Als ich aussteige, lasse ich die Tür so sanft wie möglich ins Schloss schwingen. Lou wirft mir noch einen kurzen, unendlich traurigen Blick zu und fährt an. – Ich bin total fertig! Ich wollte sie wirklich nicht verletzen, aber sie muss doch erkennen, dass auch ich unter einer fürchterlichen Anspannung stehe. Ich kann ihr im Moment auch nicht helfen, verdammt noch mal!
Ich sehe dem Wagen nach, während ich mein Handy herauskrame. Wieder versuche ich Diego zu erreichen. Das Handy am Ohr stolpere ich die Stufen hinauf, aber es ist immer noch nur die Mailbox dran. Mist! Wo ist er? Wird er immer noch verhört?
Mit dem Fahrstuhl fahre ich in den vierten Stock und eile zu unserem Zimmer. Vielleicht ist Biggy ja da. Vielleicht weiß sie ja etwas.
Ungeduldig schließe ich den Raum auf und stürme hinein. Er ist leer.
Mein Zimmer im I-House ist mir in den paar Tagen schon ein richtiges Zuhause geworden. Die Versuchung ist groß, mich unter die Bettdecke zu kuscheln und der feindlichen Welt da draußen einfach den Rücken zuzudrehen.
Den Zimmerschlüssel immer noch in der Hand sinke ich auf die Bettkannte und starre zu Boden. Am liebsten würde ich mich einfach hinlegen und schlafen, schlafen, schlafen! Das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage, aber einen sehnsüchtigen Blick gönne ich meiner kleinen Zuflucht schon, während ich mich aufraffe und Lous Bücher auspacke.
Bald jedoch wird mir klar, dass ich viel zu unruhig bin, um mich auf die Bücher zu konzentrieren. Immer wieder muss ich daran denken, wie Lou sich eben versteift hat, als ich ihr die Hand auf die Schulter legen wollte. Wie traurig und angespannt sie mich angesehen hat, bevor sie losgefahren ist. Verdammt! Jetzt habe ich mich auch noch mit ihr verzankt. Das darf doch nicht wahr sein.
Tränen der Wut schießen mir in die Augen. Ich habe Schuldgefühle wegen meiner blöden Äußerungen, aber was soll ich denn noch alles aushalten? Es geht einfach nicht mehr! Es reicht! Wie soll ich denn das alles kapieren, wenn mir jeder nur so halbe Sachen hinwirft, so wie Lou vorhin?
Ich schaue auf meinen Wecker. Ob Diego wohl schon frei ist? Ich rufe ihn an, aber wieder meldet sich nur die Mailbox. Merde! Ich muss unbedingt mit ihm reden. Sicher war das alles nur ein dummes Missverständnis. Nein, er hat mich nicht gekauft, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch mit Lou werde ich mich wieder vertragen. Bestimmt wird sie einsehen, dass ich es nicht böse gemeint habe und dass ich vor lauter Angst und Streß einfach durchgedreht bin.
Ja, so werde ich es machen! Ich spüre ein Lächeln auf meinem Gesicht. Diego und Lou sind mir die liebsten Menschen hier. Ich muss kichern, nein schlimmer, ich muss laut lachen. „Das sind mir die liebsten Menschen hier“ murmele ich und pruste los. – Zwei Darksider. - Die liebsten Menschen! Guter Witz, Lana!
Ich gehe zum Fenster und öffne es. Die Luft tut mir gut und das Gefühl der Enge verschwindet. Plötzlich schiebt sich eine Wolke vor die Sonne. Wie benommen stütze ich mich an der Fensterbank ab. Ich sehe Studenten die auf Bänken sitzen und sich unterhalten, ich sehe Fahrradfahrer auf den Campuswegen radeln. Ich sehe einen Vogel, der piepsend zum Ast einer Kiefer fliegt. Das alles nehme ich wie in Zeitlupe wahr. Benommen schließe ich die Augen und öffne sie langsam wieder. Ich höre alle Geräusche wie durch Watte, denn das Bild von Alicias verbranntem Körper taucht vor meinem inneren Auge auf. Wie neonfarbene Lettern einer Leuchtreklame in der Nacht blitzt wieder die Frage in meinem Hirn auf: Wer hat Alicia auf so grausame Art und Weise umbringen lassen? Ist es wirklich mein Feind Adriano gewesen? Und wenn nicht: Wer hatte sonst noch ein Interesse an ihrem Tod? – Diego? - Lou?
Ich habe Angst – Angst um mich und um Diego, Angst um unsere Liebe. Eigentlich weiß ich doch, dass er Alicia nichts getan hat, aber gleichzeitig spüre ich wieder dieses Misstrauen. – Wie kann das sein? Traue ich ihm das wirklich zu? Einen Menschen kaltblütig ermorden zu lassen? Nein! Niemals!
Ein würgendes Gefühl schiebt sich vom Magen her zu meiner Kehle hoch. Ich darf nicht weiter darüber nachdenken. Ich werde keine Antworten finden, aber wie macht man das – aufhören zu denken?
Erschöpft setze ich mich auf das Bett und streife die Schuhe ab. Ich kuschele mich in meine Decken und ziehe sie mir über den Kopf, so wie ich es eben schon gerne gemacht hätte. Ich bin geistig völlig ausgelaugt.
Es geht nicht mehr – ich kann nicht mehr! Ich muss einfach erstmal schlafen, um all das zu verarbeiten, was ich erlebt habe. Vielleicht hilft das ja, versuche ich mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Auf dem Schreibtisch wartet so viel Arbeit auf mich. „Erstmal schlafen“, murmele ich, „dann wird alles gut.“