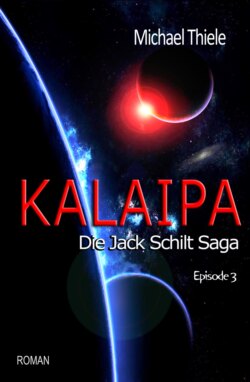Читать книгу Kalaipa - Die Jack Schilt Saga - Michael Thiele - Страница 10
7 Nematoden
ОглавлениеSchon anderntags sah ich mich gezwungen, mein Bild von Akamoras Bevölkerung zu revidieren. Die ganze „Nacht“ über hatte ich ruhelos dagelegen und so gut wie keinen Schlaf gefunden. Es war eine ungewöhnlich kurze Dunkelperiode gewesen, aber vielleicht kam es mir nur so vor. Niemals würde ich mich an diese neuen Gegebenheiten gewöhnen. Wie sehr ich mir wieder normale Tages- und Nachtzeiten wünschte! Auf Kalaipa würde ich wohl vergeblich danach suchen, gab es doch nur entweder ewige Finsternis und Eiseskälte auf der sonnenabgewandten oder mörderische Hitze und permanente Helligkeit auf der sonnenzugewandten Seite. Was immer ich wählte, der sichere Tod wäre die Folge. Nur hier, an den Rändern, eingepfercht zwischen Glut und Eis, in der nach Andras Worten „habitablen Zone“, war ein Überleben möglich. Mehrmals hatte ich mich schon gefragt, welche Ausmaße besagte Zone wohl haben würde. Eines nicht allzu fernen Tages, so hoffte ich, würde ich es herausfinden.
Unruhig wälzte ich mich im Bett hin und her. An Schlaf war nicht zu denken. Ich musste etwas tun. Mein rastloser Blick wanderte durch die Hütte, hin zur Türe. Sollte ich aufstehen und einen besonders frühen Spaziergang unternehmen? Hell war es ja nun bereits. Allein um der Muskulatur willen wäre es ratsam gewesen. Dennoch blieb ich liegen, konzentriert auf die hörbare Stille und das sanfte Morgenlicht, welches in die Hütte drang.
Eine plötzliche Bewegung direkt am Fenster nahm meine volle Aufmerksamkeit in Anspruch. Ich war überzeugt, es handelte sich um eine der alten Gärtnerinnen, die ihre Neugier nicht zügeln konnte. Doch sah ich mich getäuscht.
Für einen Moment tauchte wie eine gespenstische Erscheinung das Antlitz einer jungen Frau auf. Sie hatte wohl nicht erwartet, mich wach anzutreffen, denn als sich unsere Blicke zeitgleich trafen, weiteten sich ihre Augen. Meine mit Sicherheit ebenso. Gab es also doch nicht nur alte Menschen hier! Zum ersten Mal erhaschte ich den Anblick einer Frühjahrgeborenen. Mehr auch nicht. So schnell wie es aufgetaucht war, verschwand das Gesicht wieder. Ich lauschte. Niemand entfernte sich von der Hütte, soweit durfte ich meinen Ohren trauen. Sie verbarg sich also unter dem Fenster.
„Wer bist du?“ flüsterte ich so freundlich wie möglich. „Bitte, zeig dich wieder!“
Keine Antwort.
„Sei lieb und zeig dich, bitte! Komm, ich weiß, dass du da bist. Ich möchte mit dir reden!“ Ich rechnete aus, wie lange ich wohl benötigte, um aus dem Bett zu klettern und ans Fenster zu eilen. Viel zu lange. In der Zwischenzeit würde das Mädchen über alle Berge sein. Wie sehr ich mich für meine noch immer nicht völlig überwundene Gebrechlichkeit hasste! Vor allem das allmorgendliche Aufstehen fiel schwer, als benötigte mein Körper jeden Tag einen gewissen Zeitraum, überhaupt wieder in die Gänge zu kommen. Jeder Knochen und Muskel protestierte nachhaltig. Ich musste mehr tun, viel mehr tun, um so bald als möglich wieder zu alter Form zurückzufinden!
Noch bevor ich irgendeinen Entschluss fassen konnte, erschien überraschenderweise das Gesicht wieder. Zögerlich. Man sah ihr deutlich an, wie wenig sie überzeugt war, das Richtige zu tun.
Oh ja, sie war sehr jung! So wie ich, eher etwas jünger. Semmelblondes, schulterlanges Haar umrahmte die zarten und doch durchaus entschlossen wirkenden Züge. Unsere verwunderten Blicke fanden einander wieder. Diesmal hielt sie stand, wenn es ihr auch sichtbar Mühe bereitete.
„Wie heißt du?“ fragte ich, ein argloses Lächeln aufsetzend, das hoffentlich nicht zu falsch wirkte.
Wieder keine Antwort. Doch sprachen ihre Augen Bände. Noch nie im Leben war ich von Blicken so aufgefressen worden, wie in diesen Sekunden. Dabei hatte ich das Gefühl, je länger sie mich betrachtete, desto weniger vertraute sie ihren Sinnen. Ungeduldig richtete ich mich im Bett auf, um eine günstigere Position zu finden. Ein Fehler! In Windeseile tauchte sie ab.
„Hab doch keine Angst!“ rief ich bedeutend lauter als vorher. „Ich tu dir nichts!“
„Verrate mich nicht!“ Die glockenhelle Stimme war bereits im Rückzug begriffen. Hastige Schritte entfernten sich. Es machte wenig Sinn, ihr jetzt noch hinterherzueilen, zumal ich nicht einmal problemlos aus dem Bett kam, schließlich in meiner Wut auf mich selbst herausstürzte und auf dem Bauch landete.
Wenig hatte ich von ihr gesehen. Sehr wenig. Doch genügten diese kurzen Augenblicke, ein seltsames Band der Vertrautheit zu weben. Was hatte sie gesagt? Ich solle sie nicht verraten?
„Keine Angst“, flüstere ich, noch immer auf dem Boden liegend ans Fenster starrend. „Dein Besuch bleibt unter uns.“
Seit jenem denkwürdigen Ereignis, dem Besuch des jungen Mädchens unter meinem Fenster, betrachtete ich Akamora mit anderen Augen. Es gab also auch jüngere Menschen hier. Nur, wo? Weshalb zeigten sie sich nicht? Ich beschloss, dieser Sache auf den Grund zu gehen.
Auf ausgedehnten Ausflügen durch die Siedlung suchte ich tagelang nach ihr, hoffentlich nicht zu auffällig. Hatte ich doch versprochen, sie nicht zu verraten, was immer sie damit gemeint haben mochte. Allein die Tatsache, sie nirgendwo zu finden, nährte irgendwann den einzig naheliegenden Verdacht: sie musste von jenseits der Mauer gekommen sein. Was zum Teufel befand sich auf der anderen Seite? Welche Welt verbarg man vor mir?
Gegenüber Andra verlor ich kein einziges Wort über das namenlose, fremde Mädchen. Jedoch schien sie die Veränderung zu spüren, auch wenn sie es zunächst nicht in Worte fasste. Mein wachsendes Interesse an der Welt jenseits der „schützenden“ Mauer ließ sich nicht länger ignorieren. Andra musste langsam aber sicher Stellung beziehen.
„Wenn du soweit bist, können wir gerne einmal eine Exkursion auf die andere Seite machen, solltest du es dir wirklich so furchtbar wünschen“, stellte sie mir vage in Aussicht. Es klang so, als nähme sie es selbst nicht ernst. „Ich verstehe dein Interesse durchaus. Die Natur hier oben ist wild und ungezügelt, ein Juwel in ihrer Rauheit. Du wirst sie lieben! Doch bevor du dir so etwas zumutest, solltest du wieder völlig bei Kräften sein.“
Immer dieselbe Leier. Immer wieder scheiterte es an meinem unzureichenden Gesundheitszustand. Welche Ausreden würden ihr einfallen, wenn es soweit sein sollte?
„Erzähle mir mehr von den Eiswürmern!“ bat ich stattdessen.
„Kein erbauliches Thema“, wehrte Andra schwach ab, wohlwissend, meiner Neugierde früher oder später sowieso nachgeben zu müssen. Der unmittelbar folgende tiefe Seufzer sollte wohl ihre Missbilligung unterstreichen, doch überhörte ich ihn geflissentlich und sah sie weiterhin fordernd an. Schließlich gab sie nach. „Trotz der Extreme entwickelte sich auf Kalaipa Leben, wenn auch nur niederes. In der Tat ist dies der Planet der Würmer, es gibt sie in allen erdenklichen Ausmaßen. Die größten unter ihnen sind die Nematoden, deine ach so interessanten Eiswürmer. Sie erreichen Längen von bis zu fünfzehn Metern und können gut und gerne mehrere Tonnen wiegen.“
Mein Unterkiefer klappte auf. „Ist nicht wahr!“
„Oh doch, sehr wohl wahr. Die meisten Wurmarten sind allerdings harmlos, deutlich kleiner und wenig an Menschen interessiert. Mit den Eiswürmern verhält es sich anders, sie sind Karnivoren, ernähren sich ausschließlich von Fleisch. Das macht sie naturgemäß wenig anziehend.“
„Eiswürmer würden uns also verspeisen, wenn ich das mal so ausdrücken darf?“
„Exakt. Mit Haut und Haaren, ohne zu zögern. Gewisse Exemplare haben eine ausgesprochene Vorliebe für Menschenfleisch entwickelt. Es kommt zwar selten vor, aber ich selbst weiß von fünf Fällen. Du siehst, sie sind überaus gefährlich. Deshalb mauern wir uns ein. Um uns vor ihnen zu schützen.“
Ich nickte, wenig überzeugt. Zugegeben, die Mauer, die Akamora umgab, wirkte massiv und stark. Doch zweifelte ich daran, dass sie einem fünfzehn Meter langen und tonnenschweren Ungetüm widerstehen konnte.
„Ihr bekommt demnach hin und wieder Besuch von ihnen?“ fragte ich.
„Zum Glück nicht. In diese Höhen verirren sie sich dem Himmel sei Dank nur sehr selten. Womöglich ist die Luft hier oben zu dünn für sie. In den tiefen und dunklen Tälern verhält sich das anders. Dort sind sie zuhause. Dort ist ihr Reich. Meide stets die Täler! Es ist besser für dich, wenn du im Hochland bleibst. Die Gefahr, hier auf Nematoden zu treffen, ist relativ gering.“ Wollte sie mir Angst vor dem Tiefland machen? Mir war nicht einmal klar, ob ich ihr die Geschichte überhaupt abkaufen durfte. „Vor dem Tooragkrieg besaßen die Menschen hochspezialisierte Waffen, mit denen sie die gefräßigen Monster erfolgreich in Schach hielten. Nachdem die Toorags durch waren, sah alles anders aus. Waffen existierten nicht mehr. Den wenigen, denen die Flucht in die Minen gelang, blieb nur das nackte Leben. Von da an gab es kein Mittel gegen Nematoden. Wir können schlicht und einfach nichts gegen sie ausrichten. Sie sind wieder die wahren Herren Kalaipas. Auch einer der Gründe, warum wir hoch oben im Gebirge leben. Hier wagen sie sich nur gelegentlich her.“
„Wäre das anders, wenn sie von Menschen hier oben wüssten?“
Andra sah mich unverwandt an. „Sie würden den Weg bestimmt nicht scheuen. Wie ich bereits sagte, einige von ihnen haben eine ausgesprochene Vorliebe für uns entwickelt. Es sind wahre Menschenfresser. Unsere einzigen Todfeinde.“
„Du bist ihnen schon begegnet, nicht wahr?“ fragte ich zielsicher.
Sie nickte und senkte den Blick. „Mehrmals, als wir am Ende des kosmischen Winters den Weg in die Außenwelt wagten. Alles war besser, als auch nur noch einen weiteren Tag unter der Erde verbringen zu müssen. Alles! Uns war klar, so schnell wie möglich in die Berge ziehen zu müssen, nur dort gibt es so etwas wie Sicherheit vor ihnen. Und sie wussten es, wussten, dass wir früher oder später auf der Bildfläche erscheinen würden… und lauerten uns auf.“ Die Vorstellung, von Würmern in einen Hinterhalt gelockt zu werden, stimmte mich eher heiter. Sie musste es mir anmerken, als sie missbilligend fortfuhr: „Von den dreiundneunzig Mitgliedern unserer Sippe erreichten nur achtundachtzig die Berge. Fünf haben es nicht geschafft.“ Wir sahen einander ernst an. „Unterschätze niemals Nematoden! Sie sind keinesfalls schwerfällig, trotz ihrer immensen Größe. Kein Mensch kann vor einem Eiswurm davonlaufen. In der Ebene, in den dunklen Tälern, sind sie in ihrem Element. Hüte dich immer vor ihnen, hörst du? Tag und Nacht.“
Es gelang Andra tatsächlich, mir so etwas wie Ehrfurcht einzuflößen. Und Neugier. So paradox es klang, von diesem Moment an spürte ich ein nahezu unwiderstehliches Verlangen, diesen Ungeheuern nachzuspüren. Das ereignislose Leben in Akamora langweilte schon viel zu lange. An manchen Tagen verfluchte ich den fatalen Entschluss, meinen Vater suchen zu wollen und die Geborgenheit Gondwanas aufgegeben zu haben. Um ehrlich zu sein, das Leben zuhause hatte mich angeödet, eine Veränderung war mir unumgänglich erschienen. Paradox! Nun gäbe ich wer weiß was, um wieder zurückkehren zu dürfen.
„Gut, ich werde auf der Hut sein. Versprochen!“ sagte ich stattdessen.
Sie musterte mich misstrauisch, ließ sich keine Sekunde täuschen. „Du nimmst mich nicht wirklich für voll, habe ich recht? Der Glanz in deinen Augen gefällt mir nicht.“
„Von welchem Glanz sprichst du?“
Sie nickte wissend. „Ich kenne diesen Blick. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlassen würdest. Besser, du denkst gar nicht erst daran!“
„Wie verhält man sich, wenn einem ein solches Biest über den Weg kriecht? Welchen Rat kannst du geben?“ fragte ich, ihren Einwand übergehend. „Immerhin muss ich vorbereitet sein, sollten sie uns eines schönen Tages doch einen Besuch abstatten. Davonlaufen scheidet ja nun aus.“
Bereitwillig stand sie mir weiterhin Rede und Antwort. Ein Novum. Bisher war sie noch jeder unangenehmen Thematik mehr oder weniger ausgewichen. Womöglich schloss sie die Möglichkeit einer Begegnung hier oben tatsächlich nicht völlig aus.
„Die Kunst ist, ihnen erst gar nicht erst zu begegnen. Etwas Besseres kann ich dir nicht raten.“
Zwar wartete ich, doch kam nichts mehr von ihr. „Wenig hilfreich“, schnaubte ich verächtlich.
„Mehr gibt es auch nicht zu sagen. Du musst nur eins wissen: sie können überall sein. Es gibt sie auf der ewig dunklen Nachtseite in eisiger Kälte genau so zahlreich wie auf der immer hellen Tagseite bei Backofentemperaturen. Widerstandsfähiger kann keine Kreatur sein. Wir können nur in der gemäßigten Randzone existieren – und das auch nur temporär. Sie dagegen sind Geschöpfe dieses Planeten, perfekt an ihre Umgebung angepasst und uns in allen Belangen haushoch überlegen. Solltest du eines unseligen Tages einem Eiswurm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, ist dein Leben zu Ende, du hast keine Chance. Vergiss das niemals!“
Noch am selben Tag ertappte ich mich dabei, sehnsüchtige Blicke nach jenseits der Mauer zu werfen. Natürlich bekam ich keinen Monsterwurm zu Gesicht, das wäre auch zu schön gewesen. Doch unstillbare Neugier war geweckt. Schon immer hatten mich Geschichten dieser Art fasziniert. Auf Gondwana gab es keine mystischen Geschöpfe mehr. Gerade deswegen hatten mich Vaters Erzählungen stets in ihren Bann gezogen, jene Schilderungen von riesigen Wesen wie den Opreju, die meinen Heimatplaneten einst bewohnten. Lebhaft in meiner Vorstellung waren auch die monströsen Strigul haften geblieben, welche Vater auf Sahul in Atem gehalten hatten. In den wildesten Farben malte ich sie mir aus und stachelte meine Fantasie dadurch nur noch mehr an. Nun gab es also hier auf Kalaipa ebenfalls rätselhafte Kreaturen dieser Kategorie. Und brandgefährliche dazu. Ich kannte mich. Früher oder später würde ich die Suche nach ihnen beginnen. Was sonst sollte ich hier auch tun? In Bälde dürfte ich wieder völlig genesen sein. Nicht im Traum dachte ich daran, mein Dasein weiterhin in dieser Altensiedlung zu fristen. Schon allein Andras Verschwiegenheit verriet, dass es auf Kalaipa mehr geben musste. Viel mehr. Ob sie jemals davon berichten würde, stand in den Sternen. Doch auch ohne sie wusste ich bereits von der Existenz einer ganzen Generation Frühjahrgeborener. Das fremde junge Mädchen war der beste Beweis dafür. Warum Jung und Alt derart getrennte Wege gingen, wollte sich mir allerdings nicht erschließen.
Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr gerieten die Eiswürmer wieder in Vergessenheit. Die Erinnerung an das blonde Mädchen drängte wieder in den Vordergrund. Sie ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Dumm, sie hier diesseits der Mauer zu suchen. Inzwischen war ich zu der hundertprozentigen Überzeugung gekommen, sie niemals in Akamora finden zu können. In diesem Moment fasste ich den kühnen Plan, die Mauer in nicht allzu ferner Zukunft zu überwinden und mir ein eigenes Bild von Kalaipa zu machen. Leider beschlich mich dabei das unangenehme Gefühl, niemals die Zustimmung Andras dazu zu bekommen. Aber brauchte ich sie wirklich? Noch war ich nicht der Lage, einfach so abzuhauen. Zwei Dinge hielten mich in Akamora: zum einen die nicht völlig wiederhergestellte Gesundheit, zum anderen mein verteufelt stark ausgeprägtes Schuldbewusstsein.
Das Vertrauen in meinen Körper kehrte etappenweise zurück. So oft es ging, benutzte ich die Mauer als Trainingsgerät und zog mich an den hier und da vorstehenden Steinen hoch. Anfangs brannte die Armmuskulatur schon nach wenigen Wiederholungen wie Feuer, doch biss ich die Zähne zusammen und blieb hartnäckig. Bereits nach wenigen Tagen stellte ich deutliche Verbesserungen fest, konnte es kaum erwarten, weitere Übungseinheiten zu absolvieren. Schließlich gelang es zum ersten Mal, die Mauer gänzlich zu erklimmen und mich stolz auf ihr niederzulassen. Zwar kannte ich die Umgebung inzwischen wie meine Westentasche, doch war es ein aufregendes Gefühl, der „Freiheit“ so signifikant näher gekommen zu sein. Ein simpler Sprung in die Tiefe und Akamora läge hinter mir. Allerdings war es noch nicht soweit. Sollte mich eines nicht allzu fernen Tages das unwiderstehliche Verlangen packen, dieser trostlosen Siedlung den Rücken zu kehren, musste ich besser vorbereitet sein. Ohne geeignete Ausrüstung und einen gewissen Vorrat an Proviant durfte ich es nicht wagen. Darüber wollte ich mir zu gegebener Zeit den Kopf zerbrechen. Meine Tage in Akamora waren jedoch bereits gezählt, ich ahnte nur noch nichts davon.