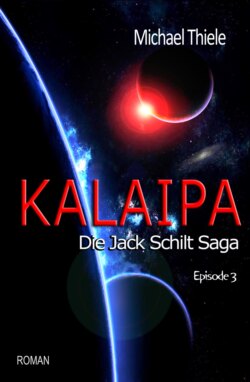Читать книгу Kalaipa - Die Jack Schilt Saga - Michael Thiele - Страница 9
6 Akamora
ОглавлениеDie ersten eigenen Gehversuche ohne fremde Hilfe verliefen überraschend positiv. Zwar protestierte mein Gleichgewichtssinn und bewegten sich beide Beine so, als gehörten sie zu jemand anderem, doch unter diesen Umständen hielt ich mich erstaunlich gut auf den Füßen. Gemessen an der Tatsache, wer weiß wie viele Wochen oder gar Monate gelegen zu haben, stimmten diese ersten Erfolg geradezu tollkühn. Ich tastete mich der Tür entgegen, jener Barriere, die ich schon seit langem zu überwinden gedachte, wenn auch nur in wagemutigen Gedanken. Der Wunsch, endlich etwas anderes zu sehen als diesen inzwischen verhassten Raum, ließ mich alle Vorsicht zumindest für einen Moment ausblenden.
Vom Bett aus hangelte ich mich hinüber zum Stuhl, auf welchem Andra zu sitzen pflegte, wenn sie mir ihre täglichen Besuche abstattete. Dort hielt ich mich wie ein Ertrinkender an der Lehne fest und erlag um ein Haar dem dringenden Verlangen, Platz zu nehmen. Nicht weil ich es wollte, sondern weil ich Angst hatte, wie ein Kegel umzukippen und aus eigener Kraft nicht mehr hochzukommen. Die Vorstellung, Andra könnte mich in dieser Situation vorfinden, erschien mir unerträglich. Also ruhte ich nicht aus und legte die zwei Meter leeren Raumes zwischen Stuhl und Tür ohne jegliche Stütze und Halt zurück. Keuchend, die immer näher heranrückende Wand mit der ausgestreckten, zitternden Rechten zu berühren versuchend, schlurfte ich Zentimeter für Zentimeter dahin, während die zurückbleibende Linke den tröstenden Kontakt mit der Stuhllehne zögerlich aufgab.
Endlich!
Mit Tränen in den Augen spürte ich die kühle Wand in meinem Rücken und lehnte mich vorsichtig dagegen. Entgegen aller Erwartungen knickten die Beine nicht ein. So verharrte ich in dieser Position, bis der Atem wieder unter Kontrolle war und schielte dann zur Tür hin. Sie war nicht mehr weit entfernt, vielleicht anderthalb Meter. Inständig hoffte ich, jetzt nicht von Andra erwischt zu werden! Sicher, ich freute mich stets über ihre Besuche, konnte es manchmal gar nicht erwarten, sie wiederzusehen, doch in diesem Moment käme sie mir höchst ungelegen. Spürte ich bereits, wie wenig es ihr gefallen würde, ertappte sie mich beim ersten Versuch auf den Weg in eine neue Selbstständigkeit?
Zu guter Letzt hatte ich mich nahe genug der Tür angenähert und wagte den Schritt ins Freie. Zum ersten Mal erlebte ich Kalaipa hautnah bei klarem Bewusstsein, atmete ich frische, warme Luft. Das Zentralgestirn, Tau 575, eine riesige schneeweiße Sonne, befand sich auf halber Höhe. Trotz des niedrigen Standes schlugen ihre heißen Strahlen wie Granaten auf meiner entwöhnten Haut ein und lösten wohligen Schmerz aus, welcher das Gefühl vermittelte, wieder unter den Lebenden zu wandeln. Wie eigenartig! Beim direkten Betrachten des grellen Sterns schmerzten meine Augen kaum. Zuhause wäre so etwas nicht möglich gewesen. Obwohl die Xyn am Firmament Gondwanas wesentlich kleiner erschien, verfügte sie ganz offensichtlich über deutlich mehr Leuchtkraft als ihr Pendant hier. Hatte Andra nicht erwähnt, es handelte sich bei Tau 575 um einen Roten Zwerg? Er musste demnach viel kleiner sein als Gondwanas Zentralgestirn, dennoch erschien er um ein Vielfaches größer. Kalaipa musste seinen Hauptstern demzufolge auf einer deutlich näheren Bahn umlaufen.
Erst als ich den Blick von Tau 575 losriss, fiel mir die Natursteinmauer auf, welche dicht an der Hütte, in der ich die letzten Wochen im Dämmerzustand verbracht hatte, entlanglief. Und nicht nur an ihr. Allem Anschein nach führte das übermannshohe Gemäuer um ganz Akamora herum. Reine Spekulation, von meiner Warte aus konnte ich die gesamte Siedlung unmöglich einsehen. Dennoch beschlich mich ein unheimliches Gefühl. Weswegen mauerte sich Akamora ein? Wen oder was sollte der Wall fernhalten?
Gerne hätte ich mich noch ein Stück weiter vorgewagt, doch fühlte ich mich nicht mehr in der Lage dazu. Und dann kam Andra um die Ecke. Als sie mich sah, blieb sie stocksteif stehen. Sie trug wie immer jenes lehmfarbene, konturlose Gewand, das ihr bis zu den Knöcheln reichte. Hatte sie nichts Ansprechenderes anzuziehen? Absurd! Wieso ging mir dieser Gedanke gerade jetzt durch den Kopf?
„Jack!“ Oh ja, es klang wie der vorwurfsvolle Ruf meiner längst verblichenen Mutter. „Was tust du da?“
„Nach was sieht es aus?“ gab ich kühler als beabsichtigt zurück. Für einen Moment ärgerte ich mich sogar über ihre offensichtliche Besorgnis.
„Warum sagst du denn nichts? Ich hätte dir geholfen. Wie unverantwortlich! Was, wenn du gestürzt wärst?“
Mein Versuch, verständnisvoll zu lächeln, scheiterte im Ansatz. „Ich denke, ich bin sehr wohl in der Lage, eigene Schritte zu tun!“ erwiderte ich stattdessen bissig. Wie sehr ich es satt hatte, bemuttert zu werden! Und aus irgendeinem Grund wollte ich es sie spüren lassen. Sie deutete meine Angriffslust jedoch falsch und machte Anstalten, mich ins Innere der Hütte zurück zu bugsieren. Der nächste Fehler.
„Dann lass mich dir zumindest ein wenig zur Seite stehen.“ Viel zu energisch nahm sie mich bei der Hand, was mir ganz und gar nicht zusagte. „Du sollst dich nicht überanstrengen! Komm, ich helfe dir! Ich denke, du brauchst jetzt dringend Ruhe.“
„Ganz und gar nicht!“ Die Kraft, ihr meinen Arm wieder zu entreißen, hätte ich wahrscheinlich gehabt, doch befürchtete ich nicht zu Unrecht, mich durch den eigenen Schwung selbst von den Füßen zu hebeln. „Ich war lange genug da drin, mir steht nicht der Sinn nach einem Nickerchen, Andra! Lass mich verdammt nochmal in Frieden!“
Sie hielt in der Tat inne. So hatte ich noch nie zu ihr gesprochen! Schon in diesem Moment tat es mir wieder leid, sie derart angefahren zu haben. Dennoch sah ich mich nicht der Lage, Worte der Entschuldigung zu formulieren. Stattdessen wandte ich mich von ihr ab und tapste in die Hütte zurück, tat also im Grunde genau das, was sie wollte. Zum ersten Mal wunderte ich mich über Andras hartnäckige Fürsorglichkeit. Als ich wieder im Bett lag und mich umständlich zudeckte, beobachtete sie mich aus einiger Entfernung. Normalerweise würde sie Platz genommen haben, was sie jedoch diesmal unterließ.
„Tut mir leid, ich habe wohl ein wenig überreagiert“, kam die deplatziert klingende Entschuldigung. „Aber als ich dich so plötzlich da stehen sah…“
Schuldbewusstsein überkam mich. Eine Eigenschaft, die ich an mir im Grunde wenig schätzte. „Ich bin wohl auch ein wenig übers Ziel hinausgeschossen“, gab ich freimütig zu, ihrem suchenden Blick ausweichend. „Verzeih, dass ich dich so angegangen bin. Du wolltest nur helfen.“
Sie lächelte verständnisvoll. „Völlig berechtigt! Da kämpfst du dich aus eigener Kraft nach so langer Zeit von deinem Krankenlager hoch, tust stolz erste Schritte – und dann komme ich Glucke um die Ecke und mache alles kaputt mit meiner übertriebenen Fürsorge. Es ist nur… ich weiß auch nicht… ich sorge mich eben sehr um dich.“
Unangenehm berührt wäre ich am liebsten unter der Bettdecke verschwunden. „Das ist lieb von dir“, presste ich schließlich hervor und wünschte, sie würde gehen, wobei ich mir nun auch noch undankbar vorkam.
„Ich lasse dich dann mal lieber alleine und schaue später wieder vorbei“, sagte Andra, als könnte sie Gedanken lesen. Schon war sie fort und ließ mich mit gemischten Gefühlen zurück. Abermals fragte ich mich, aus welchem Grund sie sich dergestalt für meine Genesung interessierte! Und wieso zog sich jener stattliche Wall um die Siedlung herum? Wen fürchteten die Bewohner Akamoras, dass sie den Entschluss gefasst hatten, sich einzumauern? Oder betrachtete ich die Sachlage aus völlig falschem Blickwinkel? Womöglich sollte die Mauer gar nicht dafür sorgen, irgendwen oder irgendwas fernzuhalten. Was, wenn sie am Ende zu einem ganz anderen Zweck errichtet worden war: die eigenen Bewohner daran zu hindern, hinauszukommen?
Erschöpft schloss ich die Augen. Mit einem hatte Andra recht gehabt: ich brauchte jetzt wirklich dringend Ruhe.
Die Tage flogen dahin. Penibel machte ich Notizen über den Verlauf meiner Genesung, wenn auch ich nicht unbedingt wusste, zu welchem Nutzen. Es tat mir jedoch gut und half dabei, das Geschehene zu verarbeiten. Immerhin hatte ich neunundneunzig Jahre Tiefschlaf und einen Crash aus dem Weltraum überlebt, was unter Garantie nicht alle Tage vorkam. Somit durfte ich ein wenig stolz auf meinen Körper sein, der mehr als nur Widerstandsfähigkeit bewiesen hatte.
Auch wenn Andra es nicht gerne sah, unternahm ich schon bald erste Erkundungsausflüge in die nähere Umgebung. Vielleicht alleine aus dem Grund, weil sie es missbilligte. Ich mochte sie, keine Frage, doch ging mir ihre mütterliche Art gegen den Strich. Bei jeder möglichen Gelegenheit büxte ich aus und humpelte quer durchs Dorf. Noch immer zog ich das rechte Bein etwas nach, doch besserte sich mein Zustand mit jedem Tag, der ins Land zog. Übung konnte nicht schaden, und die grotesk zurückentwickelten Muskeln fanden langsam aber sicher zu neuer Stärke.
Der erste längere Ausflug mochte vielleicht nur eine gute Stunde gedauert haben, doch bezahlte ich ihn schmerzhaft: meine sonnenentwöhnte Haut färbte sich in kurzer Zeit krebsrot. Viel zu spät bemerkte ich das Malheur, wohl auch aufgrund des relativ kühlen Windes, der mich vereinzelt sogar frösteln ließ. Auf den Gedanken, mich vor intensiver Strahlung zu schützen, war ich gar nicht gekommen. Erst als die Gesichtshaut unangenehm spannte, ahnte ich, was passiert war und kehrte augenblicklich um. Natürlich viel zu spät. Die kommenden Tage verbrachte ich still leidend in der Abgeschiedenheit meiner Behausung, Gesicht, Arme und Beine dick eingerieben mit Andras kühlender Spezialsalbe, einer Tinktur aus Kuhmilch und ausgewählten Bergkräutern. Mir war zudem nicht klar, was mehr schmerzte: die geschundene Haut oder Andras vorwurfsvoller Blick. Immerhin nahm sie davon Abstand, mir verbal Vorwürfe zu machen. Der Ausdruck in ihren tadelnden Augen genügte vollkommen.
Akamora gab mir so manches Rätsel auf. Die Siedlung bestand aus zahlreichen windigen Hütten, ausnahmslos aus Steinen errichtet und mit Pflanzenmaterial aller Art gedeckt. Atemberaubend gefährlich schmiegte sie sich entlang eines steil abfallenden Hanges. Man musste gut zu Fuß sein, um unbeschadet von einem Punkt zum anderen zu gelangen. Womöglich stellte dies den Grund Andras ständiger Besorgnis dar. Ich war eben noch längst nicht wieder Herr über meinen Körper und an manchen alarmierend abfallenden Passagen kapitulierte ich nicht zuletzt aus Gründen reiner Selbsterhaltung. Jene Stellen waren für mich so etwas wie Meilensteine, Messlatten, an denen ich die eigene Gebrechlichkeit maß. Nach den ersten Stürzen legte ich mir einen Stock zu, mit dessen Hilfe ich deutlich sicherer vorankam. Der Tag, an dem ich ihn nicht mehr brauchen würde, rückte näher. Stolz schwellte in mir, wenn ich ein Stück des Weges meisterte, an dem ich noch Tage zuvor resignierend umgedreht hatte. Es ging aufwärts, Schritt für Schritt.
Wissensdurstig inspizierte ich die Ställe, in welchen das Vieh untergebracht war. Tierhaltung kannte ich von Gondwana nicht, schon allein deswegen, weil es so etwas wie Nutztiere nicht gegeben hatte. Umso dankbarer akzeptierte ich jeden Tag mein Schüsselchen Kuhmilch, auch wenn mein Verdauungssystem anfangs dagegen rebelliert hatte. Inzwischen vertrug ich die fette, weiße Brühe besser, trank sie sogar aus freien Stücken und nicht aufgrund von Andras zähem Beharren. Selbst die einstmalige Scheu vor den wuchtigen Milchspendern hatte ich bald überwunden. Inzwischen genoss ich es sogar, die mit eigenartig schraubenförmigen Hörnern auf ihren massigen Schädeln ausgestatteten Grautiere zu streicheln. Wie immer wurde ich dabei konsequent missachtet. Ich konnte mich jedoch des Verdachts nicht erwehren, gerne gesehen zu sein. Jedenfalls schienen ihnen meine Berührungen nicht zu missfallen, die Tiere hielten eisern still. Da es nur wenig Weidefläche innerhalb Akamoras gab, hielten sich die Kühe bis auf wenige Ausnahmen stets in ihren stinkenden Ställen auf. Manchmal hörte ich sie kläglich brüllen, allerdings nie lange. Ihr Protest richtete sich meiner Meinung nach gegen die ständige Gefangenschaft in den viel zu kleinen Stallungen.
Auf meinen täglichen Exkursionen begegnete ich hin und wieder anderen Dorfbewohnern. Anfangs ging ich ihnen tunlichst aus dem Weg, schlug eine andere Richtung ein, sobald sich nur irgendjemand zeigte. Später fiel mir auf, dass zufällige Begegnungen so gut wie gar nicht mehr stattfanden. Auf Evu hatte es zwar nicht unbedingt von Menschen gewimmelt und gewiss lebten in Akamora deutlich mehr von ihnen – dennoch bekam ich so gut wie nie jemanden zu Gesicht. Es erinnerte mich auf befremdliche Art und Weise an zuhause. Da ich mich vorwiegend mit einem Toorag herumgetrieben hatte, war mir der Status als Sonderling sicher gewesen. Niemand sonst pflegte Umgang mit den Toorags. Nur ich. Zwar war mir die Meinung meiner wenigen Mitmenschen nie völlig gleichgültig gewesen, dennoch gab ich einen Dreck darauf, was sie in diesem speziellen Fall darüber dachten. Gowindi und ich waren Freunde gewesen, daran konnten weder spitzfindige Bemerkungen noch Schimpftiraden etwas ändern. Kein Wunder, dass ich meinen Zeitgenossen aus dem Weg gegangen war. Auf Kalaipa schien es allerdings genau umgekehrt zu sein: hier ging man allem Anschein nach mir aus dem Weg. Der Grund dafür würde mich interessieren... nun ja, das ließe sich bestimmt herausfinden. Früher oder später.
Durchweg alle Bauten Akamoras machten wenig soliden Eindruck. Einem kosmischen Winter würden sie niemals standhalten, so viel war sicher. Sollten sie wohl auch nicht. Nach Andras Worten war die unvermeidliche Kälteperiode noch viele Jahre entfernt (die Zeitrechnung Gondwanas zugrunde gelegt). Wenn es jedoch soweit war, würden die Bewohner ihre Siedlung aufgeben, den langen Weg ins Tal antreten und sich in den Untergrund zurückziehen müssen, um nicht den Kältetod zu sterben. Diese Vorstellung faszinierte mich. Die neue, im Frühling geborene Generation verlebte ihre besten Jahre in einem schier endlosen Sommer, um im Alter zusammen mit den Sommer- und Herbstgeborenen in der Tiefe des Planeten einzurücken und dort im Verlauf des ungleich längeren Winters zu sterben. Was musste das für ein Gefühl sein, zu wissen, nie wieder an die Oberfläche zurückkehren zu können? Wenigstens hatten sie den größten Teil ihres Lebens einigermaßen menschenwürdig verbringen dürfen. Welch Gegensatz im Vergleich mit den Wintergeborenen! Für sie gab es nichts anderes als ein Leben untertage. Der Gedanke, mein ganzes Leben in den Tiefen der Erde zu verbringen, niemals Sonne oder Wärme kennenzulernen, ließ mich schaudern. Ihr Schicksal beschäftigte mich besonders.
„Wie ist es möglich, ganz ohne Sonnenlicht im Bauch eines Planeten zu überleben?“ fragte ich Andra dann auch bei einer ihrer nächsten Krankenbesuche.
„Oh, nicht ganz ohne Sonnenlicht. Zwar ist ein Großteil der Oberfläche Kalaipas während des Winters dick mit Eis und Schnee bedeckt, doch gibt es glücklicherweise Ausnahmen. Den Solarsee beispielsweise.“
„Den Solarsee? Klingt ja aufregend.“
„Das ist er auch. Er ist einer unserer Hauptzufluchtsstätten. Wir verbringen den Großteil des kosmischen Winters direkt unter ihm. Der See wird von einer heißen unterirdischen Quelle gespeist und friert nie völlig zu. Zudem ist er nicht sehr tief, das Sonnenlicht reicht bis auf seinen Grund. Du siehst, wir müssen nicht gänzlich ohne Licht leben.“ Sie sprach mit einer Gelassenheit davon, als hätte sie sich dieser Prozedur schon mehrmals unterziehen müssen.
„Ihr lebt auf dem Grund eines Sees?“ Es klang zu fantastisch, um wahr zu sein.
Andra lächelte. „Ja, wenn man so will. Nein, natürlich nicht auf dem Grund des Sees sondern unter ihm, verstehst du?“ Ich verstand nicht, so wurde sie deutlicher. „Der See selbst ist spiegelklar. Das Sonnenlicht reicht, wie ich bereits sagte, bis auf seinen Grund… und darüber hinaus. Das Gestein unterhalb des Seebodens ist durchsichtig, transparent wie Glas. Wir wissen nicht warum, aber es ist so. Dort leben wir in der Eisperiode, bauen Feldfrüchte an und halten das Vieh. Der Solarsee ist nicht der einzige seiner Art, aber der größte. Er ist der Quell unserer Existenz.“
Ich sah sie blank an. Vieles machte gerade keinen Sinn, vor allem die Tatsache, in einer Art davon zu sprechen, als hätte sie das alles schon erfahren. Der letzte Winter lag, so wie ich es sah, viele Jahrzehnte zurück. Konnte Andra zu dieser Zeit bereits gelebt haben und – was noch unglaubhafter erschien – über derart lebhafte Erinnerungen verfügen?
„Du glaubst mir nicht“, stellte sie zielsicher fest.
Ich machte keinen Hehl daraus. „Es fällt mir jedenfalls schwer. Womöglich liegt es an…“
„Vielleicht wirst du ihn eines Tages mit eigenen Augen sehen“, unterbrach sie mich nicht unfreundlich. „Doch ist der Winter noch fern…“ Sie stutzte einen Augenblick und legte die Stirn in Falten. Hatte sie die Ungereimtheiten in ihren eigenen Worten bemerkt? „Du musst jetzt erst einmal ganz gesund werden. Danach sehen wir weiter.“
Damit war die Audienz beendet.
Ab einem gewissen Grad der Genesung fühlte ich mich beobachtet. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ständig war irgendjemand irgendwo immer in der Nähe. Entweder hantierten permanent Handlanger an der Hütte herum, die ich seit meiner Ankunft bewohnte, oder pflegten Gärtnerinnen den Vorgarten (in dem es nach meinem Dafürhalten nicht viel zu pflegen gab). Näherte ich mich ihnen, um sie zur Rede zu stellen, zogen sie sich zurück, als fürchteten sie meine Gegenwart. Die Gärtnerinnen indes blieben und lächelten überfreundlich. Bei ihnen handelte es sich stets um Greisinnen, die mich nicht gerade anzogen. Zudem verstanden sie meine Sprache nicht und glotzten nur unverständlich. Also unterließ ich es, das Wort an sie zu richten und ignorierte ihre Anwesenheit so gut es ging.
Als ich soweit war, ausgedehntere Spaziergänge zu unternehmen, versuchte Andra beharrlich, mich zu begleiten. Anfangs begrüßte ich ihre Anwesenheit, doch mahnte sie zu oft, mich zu schonen und vorsichtig zu sein, sodass sie bald lästig wurde. Ich war nicht der Ansicht, eine Aufpasserin zu benötigen, die mich bei jeder nur möglichen Gelegenheit zu bemuttern versuchte. Andra schien allerdings anderer Meinung zu sein.
Bei einem der gemeinsamen Ausflüge durch das Dorf erzählte sie eifrig von allen möglichen belanglosen Dingen, die mich wenig interessierten. Sie redete um den heißen Brei, es war völlig klar. Dennoch brachte ich es nicht übers Herz, sie zur Rede zu stellen. Meine Schuldgefühle ihr gegenüber erwiesen sich als zu sehr ausgeprägt. Irgendwann würde sie von selbst mit der Sprache herausrücken, redete ich mir ein.
Das Dorf wollte mir auch nach längerer Anwesenheit nicht gefallen, dieser lieblos zusammengewürfelte Haufen heruntergekommen wirkender Bruchbuden, umgeben von jener ebenso hässlichen wie übermannshohen Steinmauer. Inzwischen hatte ich den Beweis erbracht: besagte Mauer zog sich tatsächlich komplett um das Dorf. Als ich das erste Mal den höchsten Punkt der Siedlung erreichte und Akamora wie ein König auf seinem Thron überblickte, sah ich meinen Verdacht bestätigt. Von diesem Moment an fühlte ich mich wie ein Gefangener.
„Wozu habt ihr diese Mauer errichtet?“ fragte ich Andra bald darauf.
Die Antwort kam ohne zu zögern. „Sie dient zu unserem Schutz.“
Keine weitere Erklärung. Ich musste wohl oder übel nachlegen.
„Schutz vor wem?“
Sie sah mich lange an. „Kalaipa ist nicht das Idyll, wie du es bis jetzt kennst.“
Idyll? Für wie naiv hielt sie mich?
„Was meinst du damit?“ Noch keine Sekunde hatte ich diesen Planeten mit einem Idyll in Zusammenhang gebracht. Gut, die hohen Berge ringsum vermittelten in der Tat ein erhabenes Gefühl. Gebirge kannte ich von Gondwana nicht, weswegen es mich anhaltend faszinierte. Die kahlen, vegetationsarmen Hänge in dieser Höhe hatten etwas Lebensfeindliches an sich, das anzog und abstieß zugleich. Aber nein, als Idyll konnte man diesen Part Kalaipas wirklich nicht bezeichnen.
„Es gibt gefährliche Wesen da draußen.“ Besorgt sah sie mich an, als befürchtete sie, mir Angst einzujagen. Wie sehr ich diesen mütterlichen Blick inzwischen verachtete! Doch ließ ich mir nichts anmerken.
„Und diese Mauer soll sie fernhalten?“ fragte ich unschuldig.
„Ganz genau.“
„Um welche Wesen handelt es sich denn?“ bohrte ich weiter. Freiwillig gab sie ihr Wissen offensichtlich nicht preis.
„Um Nematoden“, kam die überraschend schnelle Antwort. „Besser bekannt unter ihrem geläufigeren Namen ‚Eiswürmer‘.“
„Ihr fürchtet euch vor Würmern?“ Beinahe hätte ich gelacht.
Sie betrachtete mich gütig. „Oh ja, das tun wir. Sehr sogar.“ Der Ernst in ihrer Stimme ließ mich dann doch aufhorchen. „Vielleicht ist es an der Zeit, dich mehr über Kalaipas Fauna wissen zu lassen.“
„Ich bitte darum. Immerhin bin ich nun seit geraumer Zeit hier. Und… ja, irgendwann eines nicht allzu fernen Tages werde ich wohl genesen sein und muss euch nicht länger behelligen. Verstehe mich nicht falsch, ich bin unendlich dankbar für alles, was ihr getan habt. Aber mir widerstrebt es, eine Last zu sein. Und nichts anderes bin ich. Deswegen werde ich euch sobald als möglich verlassen.“ Wieder einmal hatte ich das Gefühl, ihr Blick erhärtete.
In diesem Moment passierten wir eine Hütte. Die Tür ging auf – was selten genug vorkam – und eine alte, gebrechlich wirkende Frau humpelte heraus. Als sie uns erblickte, lächelte sie scheu und machte kehrt, beobachtete uns jedoch aus dem düsteren Innern ihrer Behausung heraus. Da endlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Schon seit Tagen hatte mich unterschwellig etwas beschäftigt, doch war es mir nicht gelungen, den Finger auf die Wunde zu legen. Jetzt endlich bemerkte ich, was mir am meisten Schwierigkeiten mit Akamora bereitet hatte. Lange genug hatte es ja nun gedauert, bis der Groschen fiel!
Alle Menschen, denen ich bisher begegnete, waren durchweg älteren Semesters! Bisher war es mir nicht vergönnt gewesen, einen im Frühjahr oder gar im Sommer geborenen Menschen zu sehen. Nein, nur ältere Vertreter meiner Gattung waren mir über den Weg gelaufen, Wintergeborene, wie ich annahm. Aber wo steckten die Jüngeren? Konnte es sein und ich hatte noch keinen einzigen von ihnen zu Gesicht bekommen? Ja, genau. Das war es! Wo befand sich die jüngere Generation? Offensichtlich nicht in Akamora, soviel stand zweifellos fest.
Mein Blick wanderte von der Greisin, die ich auf gut und gerne achtzig Jahre schätzte, zu Andra und wieder zurück. Sofort brannte mir eine Frage auf der Zunge – doch stellte ich sie nicht. Irgendetwas verbat es. Stattdessen knüpfte ich nahtlos an ihre letzten Worte an, auch wenn inzwischen ein gefühltes Zeitalter vergangen war. Was auch immer hier nicht stimmte, früher oder später würde ich es schon herausfinden.
„Andra, es dürfte wohl an der Zeit sein, mich etwas mehr über Kalaipa aufzuklären. Es gibt sicher so einiges, das ich noch nicht weiß, aber vielleicht besser wissen sollte.“
Ihr unergründlicher Blick bestätigte erneut, wie wenig ich sie kannte – und wie viel weniger ich ihr vertraute. „Ja, mein lieber Jack. Da gibt es in der Tat vieles. Mir ist nur nicht ganz klar, wo ich am besten anfange.“
Ich setzte ein selbstsicheres Grinsen auf, auch wenn ich es im Augenblick wohl am allerwenigsten war. „Wie wäre es mit ganz am Anfang? Wolltest du nicht soeben von diesen Eiswürmern berichten, die ihr so fürchtet? Also, ich bin ganz Ohr.“
Da schenkte sie mir wieder ihr mütterliches Lächeln. „Warten wir damit, bis du wieder völlig genesen bist, einverstanden? Informationen dieser Art wirst du erst benötigen, wenn du uns, wie du eben bemerktest, verlassen hast. So wie ich es sehe, wird das noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.“
Erneut wich sie aus. Ich war es leid, diese Geheimniskrämerin wieder und wieder bitten zu müssen. Die bissige Bemerkung auf der Zunge schluckte ich besonnen hinunter, beließ es bei einem genervten Augenrollen und ließ sie stehen. Mochte sie ihren Spaziergang alleine fortsetzen und mich erst wieder aufsuchen, wenn ich ihrer Meinung nach „völlig genesen“ war, wann immer das sein sollte.