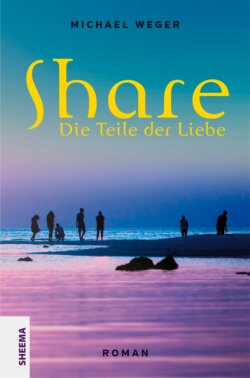Читать книгу Share - Michael Weger - Страница 13
Оглавление4
Es muss doch irgendwo … Claire wühlte in den Schubladen ihrer Kommode. Nachdem sie alle durchsucht hatte, gab sie es auf. Sie stand nackt vor dem Spiegel, der über der Kommode hing, sah hinein, zog die Augenbrauen hoch, drehte ihren Kopf nach rechts und nach links, blickte auf ihren neuen struppigen Kurzhaarschnitt, der sich nur schwer würde bändigen lassen, und schüttelte den Kopf.
Sie war knapp dran. In zwanzig Minuten sollte sie in der Redaktion sein.
Wo könnte noch einer …? Die kleine Reisetasche fiel ihr ein, die sie für die Nächte bei Jerome immer griffbereit im Vorzimmer stehen hatte. Letztens hatte sie zwei, drei Slips mit einem Griff hineingestopft. Sie hastete in den Flur, nahm die Tasche vom Boden vor der Garderobe hoch und wühlte darin weiter. Ha! Grinsend hielt sie einen weißen, spitzenbesetzten Slip in die Höhe wie eine Trophäe. Sie zog ihn an und dachte kurz nach. Auf einen BH musste sie notgedrungen wohl auch an diesem Morgen verzichten. Irgendwann, sehr bald, war dringend ein Waschtag angesagt.
Im kleinen Schlafzimmer ihrer Zweizimmerwohnung in Rive Gauche, dem fünften Pariser Arrondissement, zwängte sie sich in den engen beigefarbenen Rock, den sie am Vorabend in weiser Voraussicht nicht in eine Ecke geworfen hatte. Dazu passend nahm sie ihre letzte gebügelte weiße Bluse aus dem Schrank.
Jerome mochte diese Kombination, vor allem wenn sie in seinem Chefbüro, mit den zum Redaktionsgroßraum offenen Glasscheiben, eine Besprechung hatten. Rock und Bluse, meinte er, wirkten zwar ausreichend sexy, aber auch seriös genug, um den kursierenden Gerüchten über ihre heimliche Liaison nicht noch mehr Zündstoff zu geben.
Doch eigentlich war es ihr heute egal. Im Gegenteil. Sollte er nur einen mittleren Kollaps erleiden, nachdem er ihren Artikel wieder gekürzt und auf Seite zwölf verbannt hatte. Bouvier, der widerliche Redakteur, dem die Endkorrektur der Texte oblag, hatte dann zu allem Überfluss auch noch den fehlenden Buchstaben in ihrem Namen übersehen und so hieß die Urheberin ihres Artikels in der heutigen Ausgabe von „Le Monde“ Cladel statt Claudel. Es war der Mädchenname ihrer Mutter, den sie, schon von Beginn ihrer Journalistenlaufbahn an, als Pseudonym benutzte. So blieb sie, in gewissem Sinn, mit ihr verbunden und schaffte zugleich Distanz zu ihrem Vater.
Seufzend blickte sie kurz zur Seine, die sie, durch einen Spalt zwischen zwei Häusern der ersten Uferreihe, sehen konnte. Tiefe Wolken hingen über dem Fluss und zogen mit ihm durch die Stadt. Am liebsten würde sie den Rest des Vormittags blau machen, sich in eines der Künstlercafés im Viertel setzen, mit der Hand ihren nächsten Artikel schreiben und von den Touristen angestarrt werden, als wäre sie eine der jungen linken Schriftstellerinnen, die sich in Flugblättern und alternativen Zeitschriften immer radikaler zu Wort meldeten.
Sie zog den Rock wieder aus, knöpfte die Bluse auf und sah sich nach etwas anderem Brauchbaren um. Große Auswahl blieb ihr nicht.
Vor allem, weil sie mit Jerome nicht nur über den heutigen Artikel streiten musste, sondern ihn gleichzeitig dazu bewegen wollte, ihr die geplante Recherchereise nach Rom zu genehmigen. Also musste sie taktisch vorgehen. Am besten, ihm zuerst wegen der Kürzungen und Seite zwölf ein schlechtes Gewissen machen, dabei zugleich verführerisch und abweisend genug sein, dass er Angst bekommt, auch die folgende Nacht ohne mich verbringen zu müssen, und ihm dann im richtigen Moment die Zusage für die Romreise entlocken.
Also doch der Rock und die Bluse. Sie zog beides wieder an. Ihr Café au Lait am Küchentisch war mittlerweile kalt. Das hasste sie. Sogar an einem perfekten Morgen hätte schaler Kaffee ihr die Laune verdorben. Sie ließ ihn einfach stehen, packte ihr Neopad in die lachsfarbene David-Jones-Tasche und stand ungeschminkt mit zerzausten Haaren vor der Eingangstür. Das geht so nicht. Doch. Tut es. Anders schaue ich am Morgen, wenn ich neben ihm aufwache, auch nicht aus. Gerade verrucht genug, um ihn auf die richtigen Gedanken zu bringen.
Sie stieg in die eleganten Stöckelschuhe und lief die drei Stockwerke nach unten. Vor der Haustür schlugen ihr der Wind und die feuchtwarme Luft entgegen. Es würde Regen geben. Keinen Schirm dabei. Wird schon aushalten. Eigentlich wollte sie nur die wenigen Meter zum nächsten Taxistandplatz laufen. Doch es war einer jener neuen, autofreien Tage in Paris. Mittlerweile durften Fahrzeuge, egal, ob mit Benzin- oder Elektromotoren, nur noch an jedem zweiten Tag unterwegs sein. Das hatte sie vergessen. Also musste sie wohl oder übel den zehnminütigen Fußweg zur nächsten U-Bahnstation auf sich nehmen. Sie würde sich um einiges verspäten, streifte darum die Stöckelschuhe wieder ab, stopfte sie in die Tasche und rannte barfuß los. So konnte sie wenigstens ein paar Minuten aufholen und die schmutzigen Fußsohlen würde ohnehin niemand bemerken. Aber ihr würde es Spaß machen, dass zumindest etwas ihrem wahren Wesen und so gar nicht den neuerlich erstarkten Rollenklischees der besseren Pariser Gesellschaft entsprach.