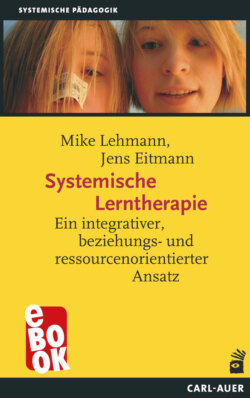Читать книгу Systemische Lerntherapie - Mike Lehmann - Страница 11
1.2Haltung und Menschenbild 1.2.1Die Arbeit mit Kindern
ОглавлениеIn früheren Zeiten spielten Strenge, Verbote und Bestrafung (z. B. der Lehrer mit dem Rohrstock) im Umgang mit Kindern eine viel größere Rolle als heute. Kinder wurden oft als kleine Erwachsene behandelt, die sich entsprechend zu benehmen hatten. Solcherart Erziehungspraktiken sind heute glücklicherweise weitgehend verschwunden. Andererseits waren Kinder auch viel sich selbst überlassen, konnten alleine draußen spielen und die Umgebung erkunden und mussten Begegnungen mit anderen Kindern ohne elterliche Hilfe regeln und bewältigen. Heute werden Kinder oftmals sehr stark beachtet und mit Aufmerksamkeit bedacht, weil sie etwas Besonderes geworden sind, sodass die selbst initiierte Beschäftigung weniger stattfindet. Sie werden behütet, Verbote und Grenzen zu setzen finden viele Eltern überholt. Eine Vielzahl von Medien lädt zum Konsum ein, viele Kinder leiden unter Bewegungsmangel und einer Unterentwicklung der Koordinationsfähigkeiten. Gleichzeitig sehen sich die Eltern oft überfordert, bedingt durch eigene Ansprüche sowohl an sich als auch an das Kind sowie auch durch gesellschaftliche Normen. Bei manchen Kindern kommt aufgrund von Trennung der Umstand eines abwesenden Elternteils hinzu.
Worum nun geht es bei der Arbeit mit Kindern? Was ist das Besondere daran? Welches ist der entscheidende Punkt, der diese Arbeit glücken lassen kann? Hier spielen die grundlegenden Annahmen des Lerntherapeuten, wie Kinder sind und wie man sie behandeln muss, eine bedeutende Rolle. Es geht darum, mit welcher inneren Haltung wir Kindern gegenübertreten. Allgemeiner gefasst geht es um das Menschenbild, das wir in uns tragen und von dem aus wir andere Menschen betrachten und mit ihnen umgehen. Mit »Menschenbild« ist der ganz grundlegende Glaube bezüglich dessen gemeint, wie der Mensch ist und funktioniert – zum Beispiel, ob er eher ein rationales oder ein emotionales Wesen ist, ob er unveränderliche Eigenschaften besitzt, ob er gut oder schlecht ist, ob er auf Zusammenarbeit oder Kampf angelegt ist, ob es so etwas wie ein Unbewusstes gibt, ob zu viel Liebe nur verwöhnt, ob man Kinder erziehen muss oder ob sie von alleine wachsen usw. Auf der Basis dieses Menschenbildes gestaltet sich auch die lerntherapeutische Arbeit. Für das bewusste Arbeiten und die Möglichkeit, sich auf den Klienten und seine Wirklichkeit einlassen zu können, ist es gut, das eigene Menschenbild möglichst gut zu kennen. Wir können dafür im Rahmen dieses Buches keine Vorschläge machen, möchten aber dazu ermuntern, darüber zu reflektieren bzw. auch Weiterbildungen oder Selbsterfahrungskurse zu besuchen, die helfen, sich dem Thema weiter zu nähern. Unser Ansatz, das wird in diesem Buch an verschiedenen Stellen deutlich werden, ist von einem humanistischen Menschenbild getragen.
Im Folgenden möchten wir in diesem Zusammenhang einen Aspekt erläutern, der ein wichtiges Element unseres lerntherapeutischen Verständnisses darstellt. Er gehört einerseits zu unserem Menschenbild und hat andererseits auch praktische Konsequenzen für die lerntherapeutische Arbeit: Unangemessenes Verhalten ist ganz oft Ausdruck ungelöster, meist emotionaler oder seelischer Konflikte im Menschen. Diese Konflikte wiederum liegen meist in Umweltfaktoren (mit) begründet, die die Bedürfnisse des Menschen unerfüllt gelassen haben. Mit unangemessenem Verhalten sind Interaktionen gemeint, die zum Beispiel auf andere verletzend wirken oder von ihnen mehr Reaktionen und Aufmerksamkeit verlangen, als sie ansonsten gegeben hätten. Typische Beispiele wären Wutausbrüche, Anschreien, körperliche Angriffe, Teilnahmslosigkeit, Weglaufen, Anlügen, Verweigerungen, psychische Verletzungen. Unangemessenes Verhalten wird oft auch als »originelles Verhalten« bezeichnet. Der Vorteil dieser Bezeichnung liegt darin, dass nicht etwas Defizitäres oder Schuldhaftes ausgedrückt wird, sondern das Konstruktive im Verhalten gesehen wird. Für gezeigtes Verhalten gibt es immer einen guten Grund, und es hat einerseits eine beziehungsgestaltende Funktion, andererseits stellt es zumeist eine Reaktion auf die Umwelt dar. Wenn das, was das Kind tut, von der Umwelt als unangemessen wahrgenommen wird, hat das Kind einfach keine bessere Möglichkeit zu reagieren. Die Personen in der Umwelt des Kindes finden es unangemessen, weil es nicht ihren Bedürfnissen und Erwartungen entspricht. Für das Kind ist sein Verhalten jedoch richtig und passend, es kommt für die anderen Personen also darauf an, diesen Sinn ebenfalls zu erkennen.
Ein Kind, das solch ein unangemessen erscheinendes Verhalten zeigt, trägt auch eine Not in sich. Diese Not besteht oft aus Angst oder Unsicherheit, das heißt einem niedrigen Selbstwertgefühl. Die Frage ist nun: Liegt die Ursache für das beobachtete Verhalten letztlich im Kind oder in seiner Umwelt? Je nachdem, wie man diese Frage beantwortet, werden auch die einzuleitenden Maßnahmen ausgewählt. Wir glauben: Die entscheidenden Faktoren sind meistens in der Umwelt des Kindes zu suchen, also im System. Das Modell für die Entstehung vieler Problematiken bei Kindern, das wir vertreten, ist zusammenfassend in Tabelle 1 dargestellt.
Tab. 1: Modell für die Entstehung unangemessenen Verhaltens
Mit dem Symptom drückt das Kind eine innere Not aus. Was von anderen als unangemessenes und damit auch unerwünschtes Verhalten angesehen wird, resultiert aus dem Unvermögen des Kindes, besser mit einer als bedrohlich empfundenen Situation umzugehen. Dieses Modell beschreibt den Defizitraum. Es lässt sich genauso auf den Möglichkeitsraum anwenden: In dem Moment, wo sich die Umwelt wandelt und für das Kind andere, positive, konstruktive Erfahrungen bereitstellt, wandeln sich auch Emotionen und Verhalten des Kindes.
Wenn wir von dieser Voraussetzung ausgehen, wie Probleme beim Lernen oder beim Verhalten von Kindern entstanden sind, leitet sich daraus auch ab, wie anzusetzen ist, damit man helfen kann. Es scheiden diejenigen therapeutischen Methoden aus, die lediglich aus Training mit dem Kind bestehen. Demgegenüber erlangen solche Methoden, die am Umfeld des Kindes ansetzen, eine hohe Bedeutung.
Im Griechischen bedeutet methodos »Weg«, das heißt, die Methode ist der Weg dafür, ein Ziel zu erreichen. Wenn ich von A nach B will, stellen sich drei Fragen: Erstens – wo starte ich (wie sieht A aus, was gibt es da, was fehlt)?, zweitens – wo will ich hin (was genau kennzeichnet B, was will ich erreichen)?, und drittens – welchen von den möglichen Wegen wähle ich aus, um ans Ziel zu kommen? Für uns spielt eine besondere Rolle, dass die Menschen verschieden sind und es daher nicht die eine Methode gibt, die immer für alle passend ist. »Die Methode« ist daher nicht, alle denselben Weg beschreiten zu lassen, sondern mit jedem Klienten individuell zu sehen, wie ein guter Weg aussehen kann.