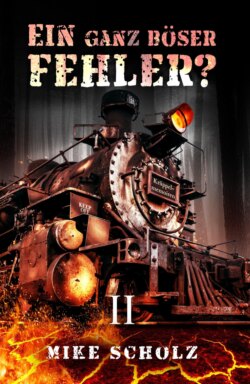Читать книгу Ein ganz böser Fehler? - Mike Scholz - Страница 11
Оглавление6
Montag, 4. Februar. Frühstück ist vorbei.
Ich bin gespannt, wer mich ab heute betreut. Da aber ewig keiner kommt, lasse ich wieder mal eine riskante Versuchsaktion steigen: Ich bewege mich mit nur einer Krücke bewaffnet im Zimmer herum. Muss dabei hochkonzentriert sein – denn ich fühle mich in der Bewegung wie ein Mininashorn auf wegrollenden Eiern! Ich torkel da was durch die Gegend, unklar!
Das Zimmer habe ich einmal durchmessen, muss jetzt wieder zurück. Darum heißt es wenden. Doch da – schneller als ich denken kann, liege ich auf dem Boden.
Was hab ich denn jetzt wieder falsch gemacht?? Zu schnell um die Kurve, Gewicht nicht verlagert, dadurch nicht mittig bewegt, konnte nach rechts den Abgang machen; was ich auch tat.
Franz, der meine Aktion argwöhnisch beobachtete, hat nun natürlich Stoff für eine seiner Moralpredigten gefunden: »Mike, dir kann man erzählen, was man will! Aber du hörst nicht drauf! Aber du hast doch gerade gesehen, wohin das führt! Warum wartest du nicht auf die Krankengymnastik?«
»Weil die immer nur das middir übn, wasde breits vorweisn kannst. Die Kra-Kra-Krankengymnastik diender Stabisation. Neuland betretn musste aer selst erstma.«
»Du bist verrückt!«
»Verrückt is besser as penibel, phantasielos, nüttern in mentalem Sinne. Außedem kann mansn Physoterapeutinn ni zumutn, die Verantworung für soiche riskantn Aktion zu übernehmn. Die muss man schon selber tragn! Deswegen bleibteem ouch gar nischt anres übig, alses alleine zu exerziern.«
»Jetzt gehst du aber zurück zum Bett und wartest!« Während er dies sagt, hilft er mir auf.
»Vergißes!«, entgegne ich. »Was sollchn im Bette?! I will hier laufend entlassn werdn, ni kriechend!«
»Bis du wieder fällst!«
»Hmmmh, dann stehicheben wiederoff.«
»Und wenn dir dabei was passiert?«
»Tja, dann, ja genau dann habch Pech gehat. Das wäraber immer noch besser, als im jetzen Zustand dahinzuvegetiern.«
»Ich habe auch mal so gedacht«, holt er seine Erinnerungen hervor. »Nach dem Krieg lag ich in einem Lazarett, hatte ein Bein verloren. Da habe ich auch gedacht: 'Mensch, was hat dein Leben noch für einen Sinn?! Du wirst nie wieder laufen können.' Aber wir hatten einen Pfleger, der war – wie soll ich es ausdrücken – brutal. Der half dir nicht, wenn du hingefallen warst, da musstest du dir alleine hochhelfen. 'Im späteren Leben hilft dir auch keiner!', sagte er immer. Und im Nachhinein bin ich ihm dankbar; denn durch ihn habe ich gelernt, dass es so auch geht.«
»Siehste, un mei Pfeger binich selber. Bei mir sinaußerdem die Bedingungen een bissel anders: Ich bin, zum Glück, ni beenamutiert. Ich habouchn Sprung vom Rollstuhl zun Krücken schon geschafft. Dasim Ganzn betachtet, stehnmir dochalle Wege offn. Ich muss und werdas freihändige Loufn schaffn!«
»Dein Willen ist echt zu bewundern. Nur oft gehst du zu forsch an die Sache ran. Bei mir war das früher auch so: Ich wollte alles auf einmal. Immerhin war ich erst 2l. Ich musste aber sehr schnell merken, dass es nicht so geht.«
»Na ja, und diese Bereiche mussich seller ersauslotn. Und damm werdch jetzte weitermachn.«
»Ich habe ja auch nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Aber du musst eben langsamer an die Sache rangehen.«
Zustimmend lächle ich ihn an, trabe dann weiter. Allerdings echt in Richtung Bett, weil mir die rechte Beckenseite durch den Flug wehtut; und außerdem bin ich in den Kniekehlen vom langen, noch ungewohnten Stehen abgespannt.
Plötzlich kommt Frau Miller herein, und in ihrem Fahrwasser eine junge Studentin. Welche nicht gerade mein Idealtyp ist – sie hat kurze Haare, trägt Brille – aber sie macht einen so sympathischen Eindruck, der mich sofort begeistert: Sie strahlt in ihrer ganzen Bewegung, in ihrer Art so eine freche Lockerheit aus, welche besagt: 'Jetzt genieße ich das Leben; was danach kommt, wird sich zeigen.' Die gleiche Einstellung, wie ich sie habe.
»Guten Morgen!«, eröffnet Frau Miller ihren Vortrag. »Mike, das ist Fräulein Klotz. Sie wird Sie die nächsten vier Wochen betreuen.« Damit lässt sie uns allein.
»Dass wiruns mit «Sie» ansprechen, kannsde aber vergessn!«, stelle ich erst einmal klar.
»Von mir aus, wenn niemand was dagegen hat Ich bin Lisa.«
»Hi Lisa. Ich bin Mike.«
Nach diesen Begrüßungsformalitäten unterbreitet sie mir den Vorschlag, gleich Laufschule durchzuführen. Und will nach meiner Zustimmung wissen, was ich erwarte.
»Tja, wieder freihändsch loufn. Unne nächste Stufe dothin isses Loufn miteener Krücke. Und daich mir vorgenommn hab, miras in nächsten vier Wochen reinzuziehn, bist dus Opfer.«
»Ääh, hört sich ja grauenvoll an.«
Ich grinse wissend.
»Meinst du, dass du das schaffst?«
»Ich meins ninur, ich bin mir sicher. Vor paar Wochen dacht hierouch noch niemand dran, dasschma – mich mal wiederohne Rollstull bewegn werd. Mit vollm Risiko habichsaber geschafft. Risiko ismei Lebn«, kläre ich sie auf.
»Na Hauptsache, du haust dir dabei nicht den Kopf ein!«
»Derhat schoneen fahrndes Auto geknuttscht, also kanner dasouchab.«
»Okay!« Damit nimmt sie mir die rechte Krücke weg.
Gut, dass ich heute früh schon ein bisschen vorgeübt habe. Dadurch ist mir jetzt bekannt, wie das geht.
»Hmmh, du duftest gutt.« Ich schwebe auf einer berauschenden Wolke.
»Danke.« Sie ist purpurrot geworden.
Treffer?
Infolgedessen werfe ich ihr noch mehr Komplimente an den Kopf.
Immer verlegener werdend, platzt sie heraus: »Du sollst laufen, nicht mich angucken!«
»Eeheh, Spaß muss dowo dabei sein, das gibder ganzn Sacherst die richtsche Würze, machseerst pikant!«
»Tue dich jetzt auf äh dich tun äh kon-konzentrieren, nicht auf mich, nee, auf dich!« Dabei äugt sie durch ihre Brille wie ein Deutschprofessor auf eine knifflige Mathematikaufgabe.
Automatisch setze ich bei dem Anblick zu einem Lachgewieher an.
»Wa-was ist denn nun schon wieder los?«, will sie wissen.
»Entschuldige, aber duäugst durch deie Brille so – naoff jedn Fall niedich! Da konntichs mirni verkneifen, bewundernd zu lachn! «
»Ahaa. Hm. Äh an deine scheinbar so charmante Ausdrucksweise muss ich mich erst gewöhnen, ich werde äh nämlich ständig verlegen dabei. Jetzt a-a-aber laufe weiter!«
*
Es ist gerade Mittagspause und ich liege im Bett. Wach, denn müde bin ich nicht. Aber dadurch haben die Gedanken an das letzte Wochenende wieder die Gelegenheit, mich zu überfallen: Von meiner Mutter war auch gestern nichts zu sehen. Und ich kann mich so dunkel erinnern – am Anfang meines Zombielebens behielt sie auch meine Wäsche für sich. Damit wird es ganz deutlich: Sie will ihre Selbsthygieneangewohnheiten auf mich übertragen, sie ist der festen Ansicht, dass, da sie die Schlüpfer nur einmal in der Woche wechselt, auch ich das nur so oft zu tun brauche. Aber ich kann mich absolut nicht dafür begeistern! Okay, da ich zur Zeit keine intime Partnerin habe, kann ich mich allein in den aufkommenden Fischgestank einsuhlen. Aber trotzdem stört es mich! Es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn man nach dem Waschen wieder in den schon seit einer Woche in Betrieb befindlichen Slip steigen muss, so ausgelaugt, unfrisch, morbide, unangenehm ist dann das Gefühl, das beste Stück kommt sich dann vor wie in einer Miefkammer, wo gerade Klärgrubenprodukte mit Ozeanabfällen vermischt werden! So geht es auf jeden Fall nicht weiter!
Und so wird es auch nicht weitergehen. Denn was sich da in mir als Lösung herauskristallisiert, wird auf jeden Fall in meinem Leben und vielleicht auch in ihrem Leben für Veränderungen sorgen; denn dies ist die einzige Lösung, ich muss sie ergreifen, oder ich werde ein wandelnder, gehirnloser Haufen Dreck, der nur noch willenlos herumgrunzt und den man hinundherschieben kann, wie man möchte, oder man lässt ihn einfach an seiner Stelle kampieren und in seinem eigenen Mief irgendwann verrotten:
Ich gebe meiner Mutter den Abpfiff.
Ich will das ja schon seit ein paar Wochen tun, aber jetzt ist eine Muss-Gelegenheit daraus geworden. – Ich bin sichtbar dabei, mich wieder auf die eigenen Beine zu stellen. Und da ist es doch logisch, dass ich nicht zu Hause hocken bleibe, sondern aktiv werde. Es ist doch wie mit der Aufhebung der Lähmung: Nichts kommt von allein, alles muss man sich erarbeiten. Da darf man nicht auf irgendwelche Wunder warten. Aber dies kann meine Mutter offensichtlich nicht begreifen. Am letzten Wochenende, an dem ich bei ihr war und sie keine Anstalten machte, mir zu helfen, bin ich allein weggegangen. Was ihr die Erkenntnis beschert haben dürfte, dass ich drauf und dran bin, ihr aus den Händen zu gleiten. Infolgedessen hat sie die Konsequenz gezogen, mich im Krankenhaus versauern zu lassen. Da bleibt mir im Endeffekt gar nichts anderes übrig, als ihr die Kehrseite zu zeigen. Denn Versöhnung? Dann müsste ich mich ja auf ein Level begeben, wo ich nie hin will. Und Reue? Wofür? Ich bin nun mal nicht der Typ, der in irgendeinem Sessel im eigenen Dreck teilnahmslos vor sich hinsiecht. Meine Mutter hat aber gedacht, dass dem so ist. Obwohl sie mich nach 22 Jahren doch eigentlich kennen müsste. Tja, dann muss es ihr auf eindrucksvolle Weise klargemacht werden. Und das geht nun nicht mehr anders als mit einem Schlußstrich unter die Beziehung. Dass sie aber die Gründe dafür auf keinen Fall bei sich selbst suchen, sondern alle bei mir finden wird, daran brauche ich nicht zu zweifeln.
Ich bin glücklich darüber, endlich eine Lösung gefunden zu haben. Fühle mich jetzt gelöster, innerlich frischer. Doch da – die nächste Frage taucht hinter einem verborgenen Winkel auf, zeigt mir, dass das Problem noch lange nicht gelöst ist: Wo soll ich hin? In meiner eigenen Wohnung kann ich zur Zeit nicht allein logieren. So realistisch bin ich mittlerweile, dass ich das einsehe. (Aber aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben!) Doch – na eben, hatte Qualle nicht gesagt, dass ich nur Bescheid zu sagen brauche, wenn ich Hilfe benötige? Jetzt habe ich sie nötig! Das werde ich aber nächstes Wochenende einrenken.
Wie komme ich heim? – Wuff, der nächste Einwand kam sofort. – Ach ja, na klar – Fach ist doch hier! Wir gingen zusammen in die 1. Klasse. Werd ihn mal fragen, ob er mich mitnehmen kann!