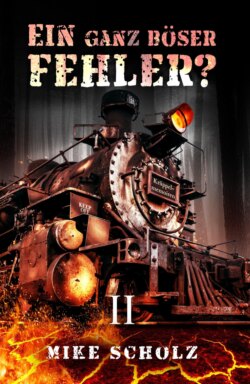Читать книгу Ein ganz böser Fehler? - Mike Scholz - Страница 8
Оглавление3
Sonnabend, 19. Januar. Mittag.
In meinem Sessel, langweile mich – wie fast immer bei meiner Mutter. Und bin dabei, mich an meine neue Brille zu gewöhnen. Schweineteuer war sie, 84 DM. Allerdings habe ich jetzt den größten Durchblick seit meiner Wiedergeburt. Sie wird aber – da bin ich mir 100%-ig sicher – nicht mein Endresultat bleiben; denn ich sehe mit ihr aus wie Clown Ferdinand mit einer verkleinerten Klobrille. Stockhässlich ist sie; aber meiner Meinung nach ist das jede Brille. Und den Intelligenzverstärker, der mir noch genießbar erscheint, führten sie nicht.
Jetzt aber will ich raus an die frische Luft. Ich habe laufen gelernt, draußen ist schönes Wetter, also raus.
»Hallihallo, kommeener voneuch mit raus?« Anfragen muss man ja.
Ein von Ignoranz gekennzeichnetes Schweigen kreist durch den Raum.
»He!«, fange ich nun an, lauter zu rufen. »Ich habeuch gefagt, wer mich zu Mascha bringt! Und ich erwartne Antwort!«
Mitleidig schauen sie sich an. Saskia tanzt ein Grinsen über das Gesicht, und meine Mutter – die steht ihr in nichts nach.
Sie wollen sich wohl gegenseitig sagen: »Ach, der arme Krüppel, jetzt will er raus. Wir haben aber keine Lust, uns jetzt mit seinem Gestolper zu beschäftigen. Soll er doch bleiben, wo er ist und in seinem eigenen Saft schmoren. Der ist sowieso nicht mehr zurechnungsfähig.«
Dann bequemt sich meine Mutter dazu, mir eine Antwort zu geben: »Was willst du dort? Die kommen doch nie zu dir, also warum sollst du zu denen gehen?!«
Ich habe keine Lust, die alte Leier erneut zu servieren; stattdessen wende ich mich an Saskia.
»Nein, keine Zeit!«
»Bei mir genauso!«, fügt meine Mutter hinzu.
Eigentlich hätte ich mir das denken müssen, denn sie spielen gerade zusammen 'Mensch, ärgere dich nicht'!
»Dann machichs eben alleene!« Dies habe ich schon mehrmals gesagt, nur dass ich da noch im Rollstuhl war. Doch ernst gemeint hatte ich es immer. Und diesmal – diesmal mache ich es.
Ich schiebe mich hoch, greife mir meine Krücken, bewege mich zur Wohnungstür.
»Du bleibst sitzen, Mike!«, schreit meine Mutter.
Ich ignoriere ihren Befehl, gehe hinaus in den Korridor.
Während ich mich ankleide, höre ich sie drinnen brabbeln: »Es ist eine Frechheit von ihm, uns das anzutun! Der Verbrecher, der! Aber ich glaube nicht, dass er los macht.«
Meine Schwester schweigt dazu. Aus gutem Grunde, denn seit Silvester weiß sie es besser.
In mir drin rumort es. Die Vernunft in Allianz mit der Bequemlichkeit, der Faulheit, der Gewöhnung und der Familienliebe einerseits und die Unvernunft zusammen mit der Unstetigkeit, dem Draufgängertum und dem Ehrgeiz – Wer sind nun eigentlich die größeren Schweinehunde, die man besiegen muss? – andererseits stehen sich wieder einmal bis an die Zähne bewaffnet gegenüber, lassen die Schwerter funkeln, die Helme blitzen, die Lunten lodern, es scheint nur noch Centi-, Milli-, Mikro-, Nanosekunden zu dauern, bis sie übereinander herfallen und Funkenregen auf das geistige Schlachtfeld niederprasselt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass ich meinen ersten Versuch eines längeren Ganges vorzeitig abgebrochen habe. Der Leichengeruch wird stärker.
Aber diesmal nicht. Auch schon deswegen, da ich dann von meiner Mutter immer belächelt werden würde, wenn ich ankündige, dass ich einen Sololauf hinlege.
Eine letzte Chance gebe ich ihnen aber noch, damit sie nicht sagen können, ich hätte sie links liegen lassen: Ich gehe nochmals in die Stube, frage, ob sie es sich anders überlegt haben. Doch wie erwartet bekomme ich auch diesmal ein »Nein!« zu hören. Woraufhin ich mich verabschiede, die Wohnung verlasse und mich die Treppe hinunter begebe.
Gut, dass ich im Treppenlaufen geübt bin, stelle ich fest, als ich unten ankomme. Kein Flug, kein Wackler, ich hatte mich immer im Griff.
Durch die Haustür, bloß noch ein Absatz vor mir – kein Problem, der sieht nicht weiter schlimm aus.
Huch, Scheiße, fast wäre es passiert. Ein Wackler, ich konnte ihn gerade noch abfangen. Aber mag kommen, was will, ich werde nicht umkehren! Da müssen schon schwerere Geschütze aufgefahren werden! Und nicht mal dann ist es sicher, ob ich zum Rückzug gezwungen werden kann!
Ich komme am Zaun vorbei, den ich zu Silvester umgerempelt hatte. Und bleibe kurz stehen, spüre, wie eine Welle von Gedanken versucht, mich in ihren Fluten mitzureißen. Ich kann es mir aber jetzt nicht leisten, in Gedanken versunken durch die Gegend zu trotten.
Bei dem Anblick des Zaunes steigt in mir unwillkürlich Heiterkeit hoch. Zu Neujahr, als meine Mutter wieder zu Hause aufkreuzte, wetterte sie über diesen umgestürzten Zaun: »Wer weiß, welche Ganoven den wieder umgerissen haben! So was gehört ins Zuchthaus!« Saskia und ich schauten uns wissend grinsend an, hielten aber beide die Klappe. Und ließen unsere Mutter weiter lamentieren, die das Thema noch fleißig erörterte.
*
Nach einer Weile – wie lange weiß ich nicht, da ich ja keine Uhr mehr besitze – bin ich an der Ecke angelangt, an der ich diese Straße verlassen werde. Meine Beinmuskulatur ist natürlich nicht gerade begeistert von der Belastung, die ich ihr aufbürde, deswegen gehe ich auch zum hier ansässigen Zaun, setze mich auf den Erdboden. Und dort wird erst mal die Faust vor Jubel geballt: Geschafft, bis zur hiesigen Ecke – wird ja auch Zeit! Zwar absolvierte ich damit erst rund ein Drittel meines mir bevorstehenden Weges, was aber keinen Grund zur Sorge darstellt – auch diese Strecke nimmt mal ihr Ende.
Ich stehe wieder auf, schaue so ganz beiläufig (?) zu den Fenstern meiner Mutter zurück. Wo tatsächlich jemand seinen Kopf zum Fenster hinausstreckt, ich aber nicht erkennen kann, wer es ist. Aber gleichzeitig fangen zwei Stimmen in meinem Inneren an, sich zu streiten, jede will recht haben, keine weicht einen Schritt zurück: »Mike, geh jetzt zurück! Du hast ihnen doch bewiesen, dass du es kannst!« Die Stimme der Vernunft. Ich dachte, die ist vorhin besiegt worden. Steht wohl auch immer wieder auf, wa? Na, auf jeden Fall hat sie sich schon einmal in mir durchgesetzt, und das darf nicht zur Gewohnheit werden.
Ich höre mir an, was die andere Stimme zu sagen hat: »Mike, geh weiter! Das ist die einmalige Gelegenheit, ihnen zu zeigen, dass sie dich mal können! Und das willst du doch!« Ja, das ist die Stimme, mit der ich mich immer mehr identifiziere, die frei von Angst ist, frei jeder Auferlegung, frei jeder Beschränkung, die meine ist, die ich selber bin.
Okay, diese einmalige Gelegenheit werde ich wahrnehmen. Niemand weiß, ob sie sonst jemals wiederkommt. Denn wenn ich jetzt einen Rückzieher vollführe, habe ich es doppelt schwer. Nein, ein Zurück gibt es nicht.
*
Nächste Ecke, noch circa fünf Meter bis zum Ziel. Auf der Gerade hatte ich einen einzigen Wackler, als der Asphalt sich in Löcher auflöste. Konnte mich da aber abfangen. Und jetzt?
Fast geschafft, nur noch ein Katzensprung bis zu dem Haus, wo Mascha wohnt. Selbst für mich! Wenn man bedenkt – vor einem Monat bin ich noch im Rollstuhl durch die Gegend gekraucht. Und jetzt? – Los, weiter! Auch wenn dir mulmig ist in den Beinen, das Stückchen schaffst du auch noch.
*
Da – geschafft! Angekommen! Der Eingang zum Haus liegt vor mir. Erst mal prüfen: Schaut jemand aus den Fenstern? Nö, niemand zu sehen. Also alleine weiter.
Zur Haustür hinauf muss ich über einen Absatz und über eine Treppe. Und nirgends kann man sich festhalten! – Oder doch? – Die Veranda hat eine Seitenwand; welche ich nutze, da ich keine Lust habe und nicht mehr in der Lage sein dürfte, nur mit Hilfe der Krücken die Stufen hinaufzulaufen.
An der Haustür angekommen halte ich erst einmal Ausschau nach einer Klingel. Ich finde auch eine – namenlos; und es existiert hier eine rechte und eine linke Seite. Na wie schön!
Ich habe keine Ahnung, welche Seite die richtige ist.
Wenn da keiner da ist, habe ich'n Dreck! Ach egal – jetzt bin ich so kurz vor dem Ziel! Jetzt darf mal wieder mein Schutzengel in Aktion treten. Und wenn nicht, setze ich mich eben auf die Treppe und lege eine Pause ein; die habe ich nämlich dringend nötig.
Die Haustür ist offen – wunderbar. Und im Hausflur befinden sich die Briefkästen, wo auf einem von ihnen Maschas und Kulles Namen draufstehen.
Aber hoffentlich wohnen sie nicht ganz oben. Meine Erinnerung besagt zwar, dass ich damals, als ich mit Manuela und Engel hier war, »nur« eine Treppe hinauf musste, aber auf meine Erinnerung verlasse ich mich nicht. Infolgedessen muss ich alles abklappern.
Ganz unten wohnen sie nicht. Darum ächze die Treppe hoch.
Erster Stock – da auch nicht. Aber was mir auffällt: Es existiert nur eine Seite. Warum sind dann an der Klingel zwei? Da waren die Architekten wohl mal wieder nicht ganz nüchtern?!
Nächster Stock – auch hier nur eine Seite. Ich schaue auf das Namensschild – groß und deutlich prangt da Kaminski.
Das ist der richtige Name. Ich bin da. Jetzt brauchen die bloß noch da zu sein!
Ich horche an der Tür – Ja, Stimmen höre ich. Exquisit, mein Weg war nicht umsonst! – Die Aufregung quillt wieder.
Klingeln. Ich höre jemanden kommen. Stelle mich etwas seitlich zur Tür, sonst müsste ich die Treppe noch einmal hochlaufen.
Kulle steckt seinen Kopf raus. »Heh Ente!«, ruft er überrascht. »Wie kommst denn du hierher?«
»Rüße zück!« Mühsam kommen die Worte heraus, denn ich bin schier überwältigt von Stolz und Zufriedenheit. Außerdem stimmt mich der Empfang optimistisch.
»Ichin gelaufn.« Jetzt habe ich mich wieder einigermaßen in der Gewalt.
»Komm rein, Ente! Musst ja ziemlich fertig sein.«
»Danke! Binichouch!«
Kulle kündigt in die Stube hinein meinen Auftritt an: »Heh Leute, wisst ihr, wer gekommen ist? Ente!«
»Waaas??«, schallt es von drinnen. Und dem folgt sofort ein hörbares Aufspringen und Heraneilen.
Mascha taucht auf, Steffen danach. Beide begrüßen mich verwundert. Steffen steht schon wieder unter Strom; aber das ist mir jetzt so egal wie einem Dieb sein Opfer.
»Ente, hat dich jemand hergebracht?«, will Mascha wissen.
»Nee, ich bin alleene gekomm.«
Staunen macht sich auf ihrem gar nicht so schlecht aussehenden Gesicht breit.
»Komm erst mal rein in die Stube, lass dich in den Sessel fallen!«, ordnet sie an.
Auf dem Weg dort rein will mir Steffen unter die Arme greifen.
»Lass nur, danke, nicht nötig«, will ich sagen.
Aber: »Faßni so hochan, du hebst mich ja aus!«, fordere ich ihn stattdessen auf.
Grunzend lässt er ganz los. Und meine Krücken müssen mir wieder zu Hilfe eilen.
In der Stube sitzen noch zwei: Eine »sie«, die mir irgendwoher bekannt ist, ich weiß nur nicht woher. Aber ihr Erscheinungsbild kann man nicht vergessen: So extrem negativ anzuschauen, hässlich? – Kehrt sich schon fast um. Rotblond, eine Frisur wie sie die Gischt in der Jauchegrube vorzeichnet; ihr Gesicht sieht aus wie ein vertrocknendes Hinterteil eines Pferdes, voll von Mitessern und Eiterpickeln; eine Figur wie eine zerdrückte, dickbäuchige Regentonne; ihre Schwimmringe finden bestimmt schon kein Versteck mehr, denn nicht einmal ihr Pullover kann sie verbergen – ein dicker, fetter, unansehnlicher Wulst quillt unter ihm hervor. Und etwas sagt mir, dass die Erinnerung, die ich an sie habe, nicht die Schönste ist.
Der zweite, ein »er«, dürfte ihr Macker sein. Ja, er ist es auf alle Fälle! Sie fallen sich nämlich andauernd um den Hals, lecken sich gegenseitig das Gesicht ab. Und die beiden haben sich echt gefunden, er ist die ideale Ergänzung für sie: Was sie so fett ist, ist er so dürre. Aber um das zu überspielen, scheint er einen Stapel Lexika unter den Oberarmen zu tragen. – Blond ist er, besitzt strähnige halblange Haare – die vom Design her aussehen wie die von Pumpernickel, als er gerade einen gruseligen Horrorfilm sah – sein Gesicht sieht so sympathisch aus wie das von Oma Erna, als sie zur Totenwache blieb; dazu ist er – soweit das Auge blicken kann – tätowiert; ich vermute mal, er hat schon mindestens ein Gastspiel im Knast gegeben.
»Ente, das sind Elsa und Qualle«, stellt mir Mascha die beiden vor.
»Hi Ente!«, tönt Qualle, »wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, musst du es uns nur sagen. Auf uns kannst du dich verlassen.«
Wunder, wunder! Er scheint sympathischer zu sein als er aussieht. Oder war das nur wieder eine Höflichkeitsfloskel??
»Ich grüß zück! Undu kannsdir sicher sein, ich kommdroff zurück, wenns sei muss!«
Dann darf ich feststellen, was hier stattfindet: eine kleine Fete. Jeder schluckt was in sich hinein. Dabei wird sich viel erzählt – wobei ich da nur ein kleines Mosaiksteinchen bin; aber mir ist dies recht, Hauptsache, ich werde re-integriert. – Weiterhin hören wir Musik – erleichtert stelle ich fest, dass es nicht so ein Schnulzenschwabbel aus Großvaters Zeiten wie bei meiner Mutter ist, und auch nicht so ein Dschungelpop wie der, mit dem mich Saskia immer nervt – bei der Steffen laufend testen will, ob ich die Musik von Neil Young noch kenne. Und so empfinde ich den Nachmittag als ganz vergnüglich und dass es eine gute Idee war, meinen eigenen Kopf durchzusetzen.
*
Draußen ist es dunkel geworden, fünf Uhr. Und da ich meine Tabletten nicht mithabe – mittlerweile habe ich auch Tremarid gegen die Wackelei – will ich wieder zurück, oder besser ich muss.
»Soll ich mitkommen?«, fragt Steffen.
»Das wärni schlecht.«
Unten vor der Haustür läuft Steffen mir voraus. Ich versuche, ihm zu folgen. Doch – Der dämliche Absatz! Hab doch gewusst, dass er mir noch Schwierigkeiten bereiten wird! – mein Gewicht ist zu weit über die Krücken gekommen. Das in dem Moment, als ich mich vom Absatz hinunterbewegen wollte. Und ich schaffe es nicht mehr, den Flug aufzuhalten! Auch Abrollen gelingt mir nicht! Darum lasse ich die Krücken fallen, fange mich mit den Händen auf. Liege aber trotzdem am Boden; weil ich noch nicht kräftig genug bin, mich mittels Liegestütz zu halten. Zwar habe ich es im Krankenhaus durchgesetzt, dass ich jeden Mittag allein in die Turnhalle der Physiotherapie kann, dort Liegestütze – zwei schaffe ich schon – Rumpfheben, Kniebeuge Klimmzüge trainiere – versuche, bis jetzt aber ohne Erfolg – habe aber – leider – noch nicht so viel Kraft, um meine beschleunigende Masse von immerhin 64 Kilogramm aufhalten zu können. Darum nehme ich den Erdboden wieder etwas genauer unter die Lupe.
Steffen kommt zurückgerannt: »Geht's? Was'n los?«
»Ach, der scheiß Asatz. Nigrad mei Liebespatz.«
Ich beäuge mich nach ernsthaften Verletzungen, kann aber außer ein paar Schrammen an den Händen nichts finden. »Okay, nischt passiert, kann weitergehn.«
Ein älteres Ehepaar kommt vorbei. »Hast du das gesehen«, wendet sie sich an ihn, »der gehört doch ins Krankenhaus.«
Während er irgendetwas Unverständliches zurückbrummt, steigt in mir wieder die kalte Aggressivität hoch: Nicht helfen, nein, rumpalavern, das können sie! Hätte ich es doch nur auch so gehalten, dann wäre ich jetzt kein Krüppel! Wenn ich könnte, wie ich wöllte, würde ich ihnen die Hölle auf ihrem Spaziergang bescheren! Aber das überlasse ich Steffen, dem ist es nämlich ebenfalls nicht entgangen, er scheint genauso aufgeladen zu sein wie ich.
»Verpisst euch, ihr dreckigen schleimigen Fotzen! Sonst feuere ich euch so eine, dass euch die Mitesser aus dem Gesicht fallen!« Er bewegt sich drohend in ihre Richtung. Das Ehepaar, das sich an die Ecke gestellt hat, um gaffen zu können, sieht zu, dass es wegkommt.
»Und, können wir weiter?«, richtet er sich nun an mich.
Ich nicke. »Aer soiche Stinkvotzn rägmioff! Wegn soichn Vöeln binch verkrüppelt!«
Nach einer Weile – wir sind schon ein Stück vorwärts gekommen – fange ich an, mir seinen Laufstil zu betrachten: Es ist unfassbar! Ich versuche, mich sicher und schnell vorwärts zu bewegen, während er bei dem Tempo schlendert! Okay, Steffen war schon immer schneller als ich. Aber so frappierend war die Differenz nun auch nicht. Da muss ich doch mal sehen, ob es bei mir auch schneller geht.
Scheiße, nee! Da komme ich aus´m Rhythmus, mein Gleichgewicht scheint dann unter Windstärke achtzehn oder mehr zu leiden.
Ich wanke. Habe Mühe, mich oben zu halten. Aber Steffen ist sofort da, stützt mich.
»Ente, du stellst dich jetzt an den Zaun, wartest auf mich. Ich renne schnell zu deiner Mutter, hole die Tabletten. – Oder willst du nach Hause?«
»Quatsch! Mich wieder inner Langeweile grilln lassn? Vergißes!«
Ich stelle mich an den Zaun, er rennt los. Aber nach einer Weile habe ich das Warten satt: Was mache ich? Ihm hinterhergehen? Nee, Blödsinn, der kommt doch sowieso zurück! Ich trabe zurück zu Mascha. Höchstwahrscheinlich holt er mich auch ein, ich werde kein Ras-Tempo einlegen.
*
Nach etlicher Zeit komme ich vor dem Haus, wo Mascha wohnt, an. Und treffe unten Kulle.
»He Ente«, ist er überrascht, »wo is'n Steffen?«
»Deris meie Tabettn holn. Ich binnurn Stück mitgeloufn. Dann ginger alleene weiter unichkam zurück. Aber wo willsn du hin?«
Er teilt mir mit, dass er was zu trinken hole. Und ich soll derweile hoch gehen.
Oben verkündet mir Mascha, dass auch sie schnell mal weg müsse. Ich solle derweile warten. Und in der Stube begrüßt mich ein Pärchen, das mir völlig unbekannt ist, das nicht mal mein Unterbewusstsein kennt. »Hallochen! Wer seidnihr?«, frage ich sie deswegen.
Sie schauen mich ganz verwundert an wie einen Wächter aus 'Ali Baba und die 40 Räuber'. »Hallo!«, antworten sie mir dann jedoch. »Wir sind Naschenka und Piepe. Was is'n mit dir, Unfall gehabt?«
»Richtig, Verkehrsunfall.«
»Und, schlimm?«
»Haha, begeisternd nicht gerade; aber es könnte schlimmer sein.«
Wirklich lachhaft! Das dürfte die dümmste Frage sein, die mir je gestellt wurde.
Nun will Naschenka noch wissen, was mir eigentlich genau passiert ist, ob ich jemals wieder ohne Krücken werde laufen können. Ich tische ihr meine Unfallversion auf, erzähle ihr vom Rollstuhl. Dann wartet sie mit einer auf von ihrem Cousin, der auch einen Verkehrsunfall hatte. Und da hat er das gemacht und dieses, ebenso jenes, und deswegen könne sie sich auch in meine Lage hineinversetzen. Aber es ist doch merkwürdig, dass manche Leute, wenn sie einen Verunfallten vor sich haben, die längst verschollenen Geschichten von Verwandten 12. Grades hervor kramen.
Während sie ihre Höflichkeitsstory fleißig herunterrasselt, fallen mir wieder meine Haare ein.
Pfleger Michael geht mir schon übelst auf den Geist wegen ihrer Länge. Allerdings die Länge hat zu bleiben, nur die Ohren müsste man mal wieder frei schaufeln und allgemein abstufen – die Haare, nicht die Ohren. Wenn ich dem keine Rechnung trage, so versprach ich Michael, kann er mir eine Glatze scheren. (Doch darauf bin ich nicht gerade scharf.) Also frage ich mal Naschenka: »Sammal, bringsdues, Hoare zu schneidn?«
»Ja. Wieso?«
»Na ja, meie Lodn müßtn mawiedr abestuft werdn.«
»Kein Problem, kann ich machen. Wann?«
»Morgn Nammittag.«
»Okay, also um vier. Ist recht?«
Ich nicke.
Sie schaut auf die Uhr, bemerkt plötzlich, dass sie los müsse. Und verschwindet zusammen mit Piepe auch.
*
Halb zwölf. Ich bin aufgebrochen in Richtung meiner Mutter. Steffen, der mit Tabletten und ohne Probleme bekommen zu haben kurz nach Naschenka und Piepe zurückkehrte, und Kulle, der sich auch kurz darauf wieder einstellte, begleiten mich. Und nachdem wir die Hälfte, ohne dass ich Balletteinlagen zeigte, geschafft haben, hat Steffen die Nase voll von meiner langsamen Wandelei und spikt los, um meine Mutter zu holen.
An der letzten Kurve treffen wir auf sie. Sie lächelt zwar, aber ihrem Gesicht sieht man an, dass sie verbittert ist. Folglich braut sich bei ihr ein Gewitter zusammen, das bald über mich hereinbrechen wird. Doch erst mal verabschiede ich mich von meinen zwei Begleitern.
»Holste mich Morgn umeens wieder ab?«, frage ich Kulle noch.
Er bejaht. Und verschwindet mit Steffen zusammen.
»Mike, weißt du, wie spät es ist?«, giftet dann meine Mutter, als wir losgezuckelt sind.
Aha, jetzt ist das Gewitter im Anmarsch!
»Also vorhin wars hal zwölfe, dann wirds jetzte nbissel spätter sein.«
»Ja, es ist um zwölf durch! Kranke haben um sechs daheim zu sein!«
Ich schweige dazu, denn ich finde es lachhaft.
»Demzufolge«, fährt sie fort, »kann ich auf die AOK gehen und erzählen, dass du dich nachts noch rumtreibst! Dann wird dein Krankengeld gesperrt!«
Schluck. Würde sie es machen? Zuzutrauen wäre es ihr! Aber wenn – Sie will wirklich einen Krieg provozieren, wie's ausschaut, überschätzt sich wiedermal maßlos. Ist die bescheuert? Ja. Trotzdem – den Krieg kann sie haben! Ich habe garantiert die besseren Nerven als sie!
Schweigend, nur innerlich kochend, trotte ich aber weiter, lasse sie ihr Lamento fortsetzen.