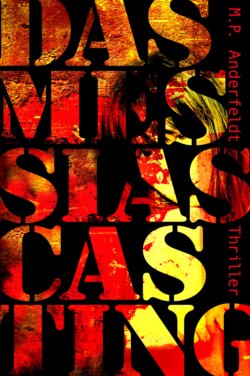Читать книгу Das Messias Casting - M.P. Anderfeldt - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hamburg
ОглавлениеIhr Gesicht wurde weltbekannt. Eine Ikone – zu vergleichen eigentlich nur mit berühmten Bildern, wie dem von Che Guevara oder dem Foto, auf dem Einstein die Zunge herausstreckt. Wirklich jammerschade, dass sie nichts mehr davon hatte, weil sie natürlich tot war. Naja, ich bin immerhin ziemlich sicher, dass auch Albert Einstein und Che Guevara keine Tantiemen für den Verkauf ihrer Fotos bekommen haben.
Im Gegensatz zu ihrem Gesicht war ihr Name übrigens praktisch unbekannt, wahrscheinlich, weil er zu exotisch war. Neben ihrem richtigen Namen, Satsuki (mit einem fast stummen »u«), waren mindestens ein halbes Dutzend falscher im Umlauf, am populärsten war aus irgendwelchen Gründen »Karen«. Nicht einmal im Wikipedia-Artikel war der korrekte Name genannt.
Das Foto war etwas unscharf, wahrscheinlich, weil es im Schatten aufgenommen worden war. Vielleicht, hatte ich mir mal überlegt, vielleicht müssen Fotos, die zur Legende werden sollen, technische Mängel aufweisen, damit sie authentisch aussehen. Nicht, dass an der Authentizität ein Zweifel bestanden hätte. Das abgebildete Mädchen hatte halblanges, dunkles Haar und die Augen lugten unter einem dichten Pony hervor. Hübsch, ja, aber nichts Besonderes eigentlich. In jeder Stadt der Welt gibt es haufenweise 16-jährige Mädchen wie sie. Vermutlich war es der Blick, der das Foto so berühmt gemacht hatte, dieser unendlich traurige, hoffnungslose Blick.
Der und natürlich die Tatsache, dass sie sich, wenige Sekunden, nachdem das Foto von einem namenlosen Passanten aufgenommen worden war, am Bahnsteig zwei des Bahnhofs Fujishiro vor den durchfahrenden Limited Express der Joban Line geworfen hatte; unmittelbar gefolgt von vier anderen Mädchen und zwei Jungen.
Wenn sich eine Person umbringt, ist das tragisch, aber nur eine kurze Meldung in der Lokalzeitung. Wenn sieben junge Menschen aus der Highschool gemeinsam Selbstmord begehen, dann ist das eine Top-Nachricht. Journalisten und Kamerateams aus der ganzen Welt reisten in den verschlafenen Tokyoter Vorort und berichteten, analysierten und spekulierten. Sicher wurde jeder Einwohner dieses Nests ein Dutzend Mal interviewt und jeder Jugendpsychologe und echte oder selbsternannte »Asien-Spezialist« konnte in aller Breite seine Vermutungen und Theorien zum Besten geben.
Das ging knapp zwei Wochen so. Mit Sondersendungen und langen Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften; man kennt das ja von Katastrophen aller Art, von Terroranschlag bis Überschwemmung.
Danach wusste auch Otto Normalfernsehzuschauer, dass japanische Kinder in der Schule unter enormem Leistungsdruck standen. Dazu waren ihre Eltern mit der Erziehung oft überfordert und die Zukunftsperspektiven der jungen Leute schienen angesichts einer seit Jahren stagnierenden Wirtschaft auch nicht so rosig. War das der Grund für den Selbstmord? Vielleicht. Dazu kam natürlich das Alter, klar. Wie alt war Goethes Werther, als er seinem Leben ein Ende setzte? Älter? Na ja, die jungen Leute sind heute eben schon reifer und machen so was früher.
Die Programmmanager kramten tief in der Filmkiste und hievten alte Dokumentationen über Kamikaze im zweiten Weltkrieg ins Programm, über Harakiri, Seppukku und wie das alles hieß. So wurde auch dem letzten klar: Japan, das ist eine andere Welt, das begreifen wir ja doch nicht. Etwas mit anderer Kultur und Mentalität, von uns Europäern nicht zu verstehen.
Die Leute langweilte es da schon lange, es passierte nichts mehr und neue Erkenntnisse gab es auch nicht. Die Berichterstattung einigte sich also darauf, dass das Ganze eine typisch japanische Sache war. Für uns im fernen Europa war das ja auch ganz bequem, denn damit war es nicht mehr unsere Sorge; genau wie Fukushima, Erdbeben oder Tsunamis. Naja, hatten sie eben ein Problem mehr in Fernost. So sorry, aber wir haben unsere eigenen Schwierigkeiten.
Die Kamerateams zogen ab und die kleine Vorstadt verfiel wieder in einen Dornröschenschlaf.
Ziemlich genau eine Woche später sprangen in Barcelona sechs junge Rucksacktouristen von einem Turm der Sagrada Familia. Das verwackelte, aber trotzdem schauderhafte Video war eines der meistgesehenen auf Youtube, bis es endlich gelöscht wurde (und gleich darauf auf dieser und ähnlichen Webseiten hundertfach wieder hochgeladen wurde, teilweise mit äußerst geschmackloser musikalischer oder akustischer Untermalung). Natürlich wurde das Bauwerk sofort gesperrt, aber die Selbstmorde beendete das nicht.
Dann ging es Schlag auf Schlag. Wenige Tage später schnitten sich in Freiburg fünf junge Menschen zwischen 17 und 20 Jahren gemeinsam in einem Auto die Pulsadern auf. Zum Glück gab es davon keine Bilder in den Nachrichten, es muss eine wahnsinnige Sauerei gewesen sein.
Acht Tote in Ohio, einer nach dem anderen hatte sich die Pistole in den Mund gesteckt und abgedrückt. Das gleiche, blutige Ding, das muss man sich mal vorstellen.
Und so ging es weiter: Selbstmorde auf der ganzen Welt. Bald sprachen die Medien von einem »Suizid-Virus«, denn es schien sich wie eine Epidemie auszubreiten. Es waren nicht nur junge Menschen, die sich umbrachten, aber die allermeisten waren unter zwanzig Jahre alt. Und das Gros lebte in den so genannten westlichen Industrieländern. Naja, zumindest die meisten, von denen bei uns berichtet wurde.
In Lyon versuchten sich drei Mädchen mit Rattengift umzubringen, überlebten aber. Als man sie befragte, behaupteten sie, nicht zu wissen, warum sie das getan hatten und zuckten nur ratlos mit den Schultern. Einer gelang es noch im Krankenhaus, sich aus dem Fenster zu stürzen, die beiden anderen wurden in geschlossene Anstalten gebracht. Seitdem habe ich nichts mehr über den Fall gehört.
Bald tauchten Poster von Satsuki auf, jenem Mädchen, das zu den Ersten gehört hatte. Sie hingen bald in jedem zweiten Teenager-Zimmer. Zum Missfallen der Eltern natürlich. Eine Untersuchung hatte zwar gezeigt, dass es keinen Zusammenhang gab zwischen der Tatsache, ob ein Bild von Satsuki an der Wand hing und einem möglichen Selbstmord, aber erzählen Sie das einer panischen Mutter! Die meisten Eltern rissen das Bild sofort herunter, wenn sie es im Zimmer ihrer Söhne oder Töchter entdeckten. Dieser Ruch des Verbotenen trug sicherlich entscheidend zu seiner Popularität bei. Hey, es sind Teenager, die würden sich auch keinen Popstar ins Zimmer hängen, den ihre Eltern toll finden. Ich denke, sie hätten das Poster kostenlos in allen Schulen verteilen sollen, wenn sie gewollt hätten, dass die Jugendlichen es so richtig uncool finden.
Manche Eltern versuchten, ihre Kinder Tag und Nacht zu überwachen, einige wohlhabende Mütter und Väter stellten sogar Bodyguards ein. Das brachte aber auch nicht immer den gewünschten Erfolg, bekannt wurde ein Fall, bei dem sich ein Leibwächter gemeinsam mit seinem Schützling umbrachte. Die ebenso bestürzten wie reichen Eltern verklagten daraufhin die Firma, bei der der Bodyguard angestellt gewesen war, auf Schadenersatz in Millionenhöhe. Ich weiß nicht, wie der Fall ausgegangen ist, wahrscheinlich gab es einen außergerichtlichen Vergleich.
Das Time Magazine beschäftigte sich unter der etwas euphemistischen Überschrift »A Generation Disappears« intensiv mit dem Thema. Die Headline war in einer nach unten verblassenden Schrift gesetzt, damit es auch jeder kapierte. Auf dem Titel war wieder das japanische Mädchen zu sehen. Natürlich.
Ich will nicht sagen, dass mir das alles am Arsch vorbei ging. Ich bin kein Schwein, auch wenn ich vielleicht manchmal so wirke. Wenn junge Menschen ihr Leben gewaltsam beenden, lässt das wohl niemanden kalt. Die Selbstmordserie hat mich auch betroffen gemacht. Aber ich habe nun mal kein Kind und der einzige Teenager, den ich persönlich kenne, ist die Tochter meines Bruders und die ist glücklicherweise ein richtiger kleiner Sonnenschein. Von daher sicher keine Selbstmordgefahr.
Ich dachte außerdem, dass die Sache mit den Selbstmorden eben eine Mode ist und dass das irgendwann wieder von selbst aufhört. Wie Tamagotchi oder Plateauschuhe.
Ich habe auch mal einen interessanten Artikel gelesen, der besagte, dass abgesehen von einem gewissen Nachahmungseffekt die Zahl der Selbstmorde nicht höher sei als früher. Aufgrund des aktuellen Hypes wird nur genauer hingesehen und über jeden Fall ausführlich in den Medien berichtet. Das war irgend so ein Effekt, ich habe den Namen vergessen. So wie nach einem Flugzeugabsturz immer so viel über Störungen oder Unfälle im Luftverkehr in den Nachrichten kommt, dass das Gefühl entsteht, es handle sich um eine »Serie«, was in Wirklichkeit aber überhaupt nicht zutrifft. Ich fand das damals sehr plausibel. Und damit war die Sache für mich gegessen.
Eher zufällig habe ich mich irgendwann nebenbei mit dem Foto beschäftigt, weil wir dazu eine Idee für eine Anzeige hatten, aber der Kunde hat abgewinkt, die Sache war ihm zu heiß. Höchst bedauerlich, denn es war eine klasse Idee und wäre ein echter Selbstläufer geworden. Virales Potenzial ohne Ende, danach schreien sie doch sonst immer – von den Kreativpreisen, die uns dadurch entgangen sind, will ich gar nicht anfangen. Schade, schade. Aber gut, so sind Kunden eben, oder? Immer gleich die Hosen voll. Nur nichts Neues riskieren, es könnte ja sein, dass irgendjemand das als nicht »p.c.« empfindet, einen kritischen Artikel in der Zeitung schreibt und dadurch ihre Marke beschädigt.
Die Lage schien sich wirklich beruhigt zu haben, eine ganze Weile hat man nichts mehr erfahren von weiteren Selbstmorden und ich dachte überhaupt nicht mehr daran. Vielleicht hatten die Leute auch einfach keine Lust mehr, etwas darüber zu hören und beschäftigten sich wieder mit wichtigen Dingen, wie dem Dschungelcamp oder dem Wolf, der angeblich irgendwo nördlich von Frankfurt sein Unwesen trieb.
Eines Tages ist mir ein Briefchen mit einem Jobangebot ins Haus geflattert. Als freier Werber bekommt man immer wieder Anfragen per Email oder Telefon, wenn eine per Post kommt, ist das schon sehr ungewöhnlich. Wenn ich mich recht erinnere, war das das erste Mal. Absender war eine bekannte Freelancervermittlung, von daher keine Überraschung, die hatten mir schon so manchen Job zukommen lassen. Das erstaunliche war die astronomische Strafe, die bei Verletzung der Geheimhaltung zu zahlen wäre: 1.500.000 Euro. Da musste ich zwei Mal hinsehen. Einein-fucking-halb Millionen Euro? Ich fragte mich, ob das nicht sittenwidrig war oder so. Ich habe natürlich trotzdem unterschrieben. Ich kann schweigen wie ein Grab.
Ich hatte mal einen Job, da ging’s um eine Kosmetikserie für Männer, die ganz neu auf den Markt kommen sollte. Was den Namen der Firma angeht, schweige ich immer noch, weil ich nicht ganz sicher bin, was eigentlich in dem Vertrag stand, den ich damals unterschrieben habe. Also sagen wir mal, es ging um eine Pflegeserie der Firma XYZ. Unter der neuen Bezeichnung sollten die Pflegeprodukte für die Herren der Schöpfung neu positioniert werden. Der streng geheime Name, den sich die Top-Kreativen in monatelangem Brainstorming überlegt hatten: XYZ Man. Wenn ich das irgendjemandem verraten hätte, bevor das Produkt im Handel war, hätte ich 100.000 Euro Strafe zahlen müssen. Ich habe damals gewitzelt, hoffentlich hat von der Konkurrenz niemand ein Englisch-Wörterbuch, sonst erraten sie am Ende noch unsere Namenskreation. Der Marketingchef fand das nicht so lustig. Wenn 100.000 Euro Strafe verrückt waren, was waren dann 1,5 Millionen? Irrwitzig?
Oder einfach nur verheißungsvoll? Meine Hoffnung war nämlich, dass es um ein richtig großes Ding ging. Ein Job, bei dem ich schön absahnen konnte und außerdem noch etwas für meinen Bekanntheitsgrad tun konnte. Letzterer hat in meiner Branche auch Auswirkungen auf das Bankkonto – wer bekannt ist, bekommt mehr und besser bezahlte Jobangebote.
Also unterschrieb ich die verrückte Geheimhaltungsvereinbarung und schickte sie zurück an die Freelancervermittlung. Noch am gleichen Tag streckte ich unauffällig meine Fühler aus und versuchte, herauszufinden, ob auf Facebook oder in einem der Freelancerforen jemand etwas von einem großen Projekt gehört hatte, in dem die Vermittlung ihre Finger hätte. Leider entdeckte ich nichts – das kann aber auch daran liegen, dass ich zu unauffällig geforscht habe. Ich hatte eben Schiss.
Nach ein paar Tagen fürchtete ich schon, dass das Ganze eine Ente gewesen war. Als ich mich endlich dazu durchgerungen hatte, bei der Freelancervermittlung anzurufen (natürlich taktisch geschickt: »Ich habe jetzt eine andere Anfrage, darum möchte ich wissen, ob ihr Angebot noch aktuell ist«), bekam ich Post. Eine Einladung zu einem Workshop. Absender war immer noch die Vermittlung. Angeblich ging es um eine neue Kampagne. Klasse, dachte ich, vielleicht handelt es ja um ein neues iPhone oder so etwas. Leider wusste ich immer noch nicht, für welchen Kunden ich tätig sein sollte, aber schlimmer als die Versicherung, für die ich neulich einen 24-seitigen Geschäftsbericht verfasst hatte, konnte es auch nicht sein. Zumal die Bezahlung, die sie mir anboten, wirklich erstklassig war, sage und schreibe drei mal mehr als das, was ich normalerweise verlange – und das, bevor ich mich herunterhandeln lasse. Stattfinden sollte das Ganze in Chicago. Warum nicht, ich hatte in den nächsten Wochen sowieso nichts vor. Zumindest nichts, was ich angesichts von so viel Geld nicht liebend gerne abgesagt hätte.