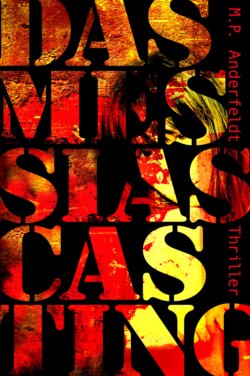Читать книгу Das Messias Casting - M.P. Anderfeldt - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Island
ОглавлениеAn dem Morgen, an dem ich nach Chicago fliegen sollte, rief mich meine Nichte an. Das arme Mädchen hat das Pech, die Tochter meines Bruders zu sein, schon allein dafür gebührt ihr mein ganzes Mitgefühl.
»Onkel Stefan?«
»Mia! Schön, dass du anrufst. Wie geht’s dir denn?«
»Ich hab dir doch von dem Jungen aus der Neunten erzählt …«
Angestrengt dachte ich nach. Verdammt, wie hieß der noch … »Sebastian, oder?«
»Bastian.« Sie machte eine Pause. Vor meinem inneren Auge sah ich, wie sie eine ihrer Locken mit dem Finger verdrehte. Das tat sie immer, wenn sie nachdachte oder verlegen war. »Jedenfalls … du hast doch gesagt, ich soll einfach mal auf ihn zugehen.«
Himmel, hatte ich das gesagt? Jetzt war wahrscheinlich trösten angesagt. »Und … das hast du getan?« Was gab ich da für Ratschläge? Ich würde das doch selbst nicht tun. Ich von allen Menschen am allerwenigsten.
Ich hörte, wie sie lächelte. »Ja! Und jetzt gehen wir miteinander.«
Was immer miteinander gehen in diesem Alter bedeutet. Ja, was heißt das eigentlich, wenn man 14 ist? Egal, das war nicht meine Sorge, damit sollten sich ihre Eltern beschäftigen. Mir fiel ein Stein vom Herzen. »Das ist ja klasse. Das freut mich für dich!« Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Ich musste wirklich langsam zum Flughafen. »Du, ich würde sehr gerne weiter mit dir quatschen, aber ich muss los. Ich fliege nach Chicago.«
»Wow, cool. Wegen dem Job?«
»Ja.«
»Wenn ich groß bin, will ich auch in die Werbung. Was du immer erzählst, mit Fernsehspots und Modelcastings und so was …«
»Das wirst du schön bleiben lassen. Ich verbiete es dir und werde dafür sorgen, dass du nicht einmal einen Praktikumsplatz bekommst.« Nebenbei gesagt war das so ziemlich das einzige Thema, bei dem ich zu 100% der gleichen Meinung war wie Mias Vater. Obwohl ich immer etwas beleidigt war, wenn er Mia allzu vehement von diesem Berufswunsch abzubringen versuchte. Als schlechtes Beispiel und gescheiterte Existenz dazustehen, ist auch nicht lustig.
»Für wen arbeitest du denn?«
Wenn ich das wüsste. »Ehrlich gesagt, so genau weiß ich das selbst nicht. Eigentlich weiß ich es nicht einmal ungefähr. Streng geheimes Geheimprojekt. Aber sie zahlen gut.«
»Dann pass bloß auf, dass sie dich nicht als Lustsklaven verkaufen oder so.«
Hey, die wird ja immer schlagfertiger, dachte ich. »So viel Glück werde ich wohl nicht haben.« Ich schluchzte theatralisch ins Telefon.
»Wir müssen echt mal eine Frau für dich suchen, Stefan. Du bist doch noch knackig, da finden wir bestimmt was.«
»Willst du mich verkuppeln – jetzt wo du in festen Händen bist?«
»Genau.« Sie glaubte vermutlich wirklich, dass sie die große Liebe ihres Lebens gefunden hatte, und war sicher, dass ihre Beziehung ewig halten würde. Wie beneidenswert, wenn man eine Romanze mit dieser Vorstellung beginnen konnte.
»Ich muss jetzt echt. Ich ruf dich an, ja? Oder schicke dir ’ne E-Mail, okay?«
»Klar. Ciao, Stefan. Und guten Flug.«
»Danke.« Ich machte eine dramatische Pause. »Eine Sache noch, Mia.«
»Ja?«
»Kondome schützen.«
»Onkel Stefan!«, schrie Mia empört. »Du bist–«
»Ich liebe dich auch, Mia.« Ich schmatzte in den Hörer und legte auf.
Ich nahm mir ein Taxi zum Flughafen. Ich hätte auch die S-Bahn nehmen können, angesichts der zu erwartenden Reichtümer glaubte ich aber, dass ich mir den Luxus eines Taxis leisten könnte. Die Rechnung behielt ich trotzdem, falls mein Auftraggeber sie bezahlen wollte – und wenn nicht, dann eben für die Steuer.
Wie ausgemacht stand in der Abflughalle ein Mann, der ein Schild mit meinem Namen hochhielt. Nein, es waren sogar zwei Männer, denn der daneben schien auch dazuzugehören. Zwei schweigsame Männer in dunkelgrauen Anzügen. Sie bugsierten mich aber nicht zum Abflugschalter, sondern durch etliche Türen mit der Aufschrift »Nur für Personal« und Sicherheitskontrollen, durch die wir einfach durchgewinkt wurden, direkt aufs Rollfeld, wo ein Learjet wartete.
Ich fragte den Mann mit dem Schild, was das zu bedeuten hätte, aber er antwortete nur: »Das werden Sie schon bald erfahren, kommen Sie einfach mit.«
Mir war das Ganze dann schon ein bisschen mulmig, aber dann dachte ich, hey, so lange der Kunde zahlt, darf er ruhig wunderlich sein. Außerdem war ich noch nie mit so einem Ding geflogen, mich interessierte, wie sich das anfühlte. Hatten so etwas nicht auch all die Milliardäre dieser Welt?
So toll war’s dann nicht. Ich hatte eine Art fliegendes Wohnzimmer erwartet, mit der neuesten Unterhaltungselektronik, Sofa, Bett, und selbstverständlich einer komplett ausgestatteten Cocktailbar. Pustekuchen. Als ich die Maschine betrat, präsentierte sich das Interieur ziemlich unspektakulär, mit zwei normalen Sitzreihen, einer links und einer rechts. Das war wohl nicht die Milliardärsausführung, höchstens Business-Class.
Schade eigentlich, denn Platz genug wäre gewesen – ich war der einzige Gast an Bord. Damit es nicht so langweilig war, bestellte ich Champagner und lud die Stewardess ein, mit mir gemeinsam zu trinken. Nach einiger Überredung willigte sie ein, »aber wirklich nur ein Glas«. Sie eröffnete mir, dass die Maschine nicht nach Chicago, sondern nach Island fliegen würde. Ich war nach dem dritten Glas schon etwas beschwipst, so dass mir das inzwischen ganz egal war. Na gut, ich hatte den Reisestecker-Adapter »USA« und den Marco Polo Reiseführer »Chicago und die Großen Seen« umsonst gekauft, aber das konnte ich verschmerzen.
Ich machte mir allerdings Sorgen, ob ich die richtigen Klamotten eingepackt hatte, und fragte die Stewardess nach dem Wetter am Zielort. Sie hieß übrigens Annika und mit jedem Schluck Champagner kam ihr sächsischer Akzent mehr zum Vorschein. Es soll ja Leute geben, die Sächsisch nicht sexy finden, aber die kannten Annika bestimmt nicht. Während ich mir die Chancen ausrechnete, »Im Flugzeug« zur beklagenswert kurzen Liste der ungewöhnlichen Orte hinzuzufügen, an denen ich Sex gehabt hatte, stand sie auf, um im Cockpit nach dem Wetterbericht zu fragen.
Leider ist sie dann nicht mehr wiedergekommen, erst kurz vor der Landung erschien sie wieder, räumte ab und forderte mich auf, meinen Gurt anzulegen. Dabei sah sie irgendwie immer an mir vorbei. Vielleicht zur Strafe für meine sündigen Gedanken. Oder ihre eigenen. Ich hoffte natürlich letzteres.
Ich hatte erwartet, dass wir in Reykjavik landen, weil das die einzige Stadt war, die ich auf Island kannte und ich mir nicht vorstellen konnte, dass es noch mehr Flughäfen gab. Aber mit so einem kleinen Flugzeug ist man natürlich nicht auf einen internationalen Flughafen angewiesen. Wir landeten auf einem winzigen Flugplatz, der außer einem Tower, der so niedrig war, dass er kaum als Tower zu erkennen war und einem Hangar, dessen Tor geschlossen war, keinerlei Gebäude vorweisen konnte.
Ich hatte mir vorgenommen, Annika beim Aussteigen noch einmal tief in die Augen zu sehen, aber ich war so zerknittert und es war so kalt und so nass, dass ich alle Hände voll zu tun hatte, dass ich nicht die paar Stufen hinunterfiel. Und blamieren wollte ich mich vor ihr auch nicht. Als ich mich zum Flugzeug umwandte, war Annika schon verschwunden. Naja, mit dem Akzent, das wäre sowieso nichts mit uns geworden.
Es gab keinerlei Sicherheitskontrollen. Ich fragte mich, ob ich nicht doch in etwas Illegales geraten war. Drogen? Naja, notfalls würde ich ihnen auch eine Werbekampagne für Kokain machen. Ich hatte in meiner Laufbahn schon Schlimmeres gemacht. Nicht viel, aber ein paar Sachen fielen mir schon ein.
Ein Mann mit einem blauen Anorak empfing mich und ließ mich in einen weißen Nissan-Minibus einsteigen. Daneben standen noch zwei weitere Minibusse. Ich wollte etwas von der Landschaft sehen, aber der dichter werdende Nebel verhinderte das und dann bin ich auch noch eingenickt. Der Champagner.
Als ich geweckt wurde, standen wir vor einem weißen Prachtbau mit vier Stockwerken. Ich musste mich kneifen, um sicherzugehen, dass ich nicht mehr schlief. Ein wunderbares Hotel, wie geschaffen als Kulisse für einen Werbespot, der in den 50ern spielen soll. Ein Gebäude, wie ich es mir an Orten wie Sankt Moritz oder Nizza vorstellen konnte, aber nicht auf Island.
Es war immer noch sehr neblig und ich konnte aufgrund der Geräusche der Brandung nur erahnen, dass auf der anderen Seite der Ozean sein musste. Ich war völlig verschlafen und auf den paar Metern bis zur Eingangstür fror ich erbärmlich.
Schlaftrunken stand ich an der Rezeption, wo ein würdevoll aussehender Portier mich aufforderte, ihm mein Handy auszuhändigen. Während meines Aufenthalts, erklärte er und zog bedauernd die Augenbrauen hoch, müsste ich darauf verzichten. Für mich Online-Junkie war das ein schwerer Schlag – ohne mein iPhone halte ich es normalerweise keine fünf Minuten aus. Aber ich fühlte mich noch so benommen, dass ich mich nicht einmal wehrte.
Dafür weinte ich innerlich. Wie soll ich wissen, ob ein Essen auch tatsächlich lecker ist, wenn ich keine Fotos davon auf Facebook posten kann? Kann ich ohne die Likes der anderen meinen Espresso im Straßencafé wirklich genießen? Wie soll ich ohne meine virtuellen Freunde entscheiden, welchen Film ich mir im Kino ansehen soll? Das würde eine harte Zeit werden.
Aber gut, ich dachte an die Kohle und biss die Zähne zusammen. Mir fiel Mias Warnung ein, dass ich als Lustsklave verkauft werden könnte, und fand sie auf einmal nicht mehr so lustig. Natürlich kam mir keinen Augenblick in den Sinn, dass irgendjemand so etwas vorhatte, aber was, wenn mir wirklich etwas passierte? Es wusste ja niemand, wo ich war oder mit wem ich mich da eingelassen hatte.
Der Portier hüstelte. »Das Telefon auf Ihrem Zimmer ist übrigens nur für die hausinterne Kommunikation geeignet.« Ich hatte beinahe vergessen, dass ich noch an der Rezeption stand.
Am liebsten hätte ich ihm die polierte Messingglocke auf den Schädel geschlagen, mir mein Handy geschnappt und wäre nach Hause gefahren, aber … richtig: Ich dachte an das Geld. Also fragte ich: »Und wie soll ich zu Hause anrufen?«
»Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Die Maßnahmen mögen Ihnen extrem scheinen, aber die Gründe für dafür wird man Ihnen beizeiten mitteilen. Bis dahin möchte ich Sie um Ihr Verständnis bitten.«
Ich wollte eine freche Erwiderung knurren, aber der Mann sah so vornehm aus, dass ich sie mir verkniff. Okay, die Wahrheit ist, dass mir keine Antwort eingefallen ist. Ich bin Texter, wenn ich länger nachdenke, fällt mir fast immer etwas sehr Schlagfertiges ein, das ich hätte sagen sollen. Aber eben erst eine halbe Stunde später. Ich wäre ein lausiger Stand-Up-Comedian.
War ich beunruhigt? Eigentlich hätte ich es sein sollen. Aber der Portier strahlte eine derartige Ruhe aus, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass mir hier etwas geschehen könnte.
Wenn mich jemand töten wollte, würde er mich dazu kaum mit dem Learjet nach Island fliegen und in einem historischen Luxushotel unterbringen. Aber sicher war das auch nicht. Vielleicht wollte mein Feind mich ja in einen Vulkan werfen oder in einer heißen Quelle garkochen. Oder ich würde dem Cthulhu geopfert werden.
Ich überlegte rasch, ob ich Feinde hatte, die mich vielleicht umbringen wollten. Ich kam zu dem Schluss, dass es sicher ein paar Typen gab, die mich nicht leiden konnten, aber ich vermochte mir nicht vorzustellen, dass die sich irgendetwas Originelles einfallen lassen würden, um mich loszuwerden. Ein Flug nach Island würde ihre Fantasie bereits bei Weitem übersteigen.
Das Hotel war alt, aber, wie es aussah, vor kurzem sehr gekonnt und zurückhaltend renoviert worden. Viel poliertes Messing, dicke, rote Teppiche und geruhsame Aufzüge, die ein mechanisches »Ding« hören ließen, wenn sie ein Stockwerk erreichten. Sehr nett, ich liebe so etwas. Man erwartete jeden Augenblick, Cary Grant oder Audrey Hepburn zu begegnen.
Außer mir waren offensichtlich viele andere Gäste gerade angekommen, viele schoben oder zogen Koffer und sahen sich verwirrt um. Ein paar der Gesichter kamen mir bei näherer Betrachtung bekannt vor, ich konnte sie nur nicht zuordnen. Ich denke aber, eher nicht aus der Werbebranche. Die meisten schienen ebenso ratlos zu sein wie ich, andere wirkten entschlossener, aber vielleicht versteckten sie ihre Hilflosigkeit nur besser. Immerhin war ich nicht der einzige Idiot hier. Die wissen auch nicht, was sie hier sollen, schloss ich messerscharf und war ein wenig beruhigt. Obwohl ich deswegen auch beunruhigt hätte sein können.
Was auch immer hier im Gange war, jemand hatte es sich viel Geld kosten lassen. Hatte unser Auftraggeber etwa das ganze Hotel gebucht? Diese Spinner. Diese reichen, großzügigen Spinner. So langsam wurde ich wirklich neugierig, um was es hier ging.
Für das Abendessen, »20 Uhr, seien Sie pünktlich«, wie der Portier mich beim Check-in noch väterlich-streng ermahnt hatte, wählte ich meinen Standard-Agentur-Look. Turnschuhe, Blue-Jeans, ein nicht zu neu aussehendes T-Shirt mit einem auffälligen Aufdruck (in diesem Fall Duffy Duck) und darüber ein Sakko. Damit macht man in einer Werbeagentur nie etwas falsch.
Hier aber schon, denn außer mir trugen alle Herren mindestens einen dunklen Anzug, einige sogar Smoking. Ich konnte vermutlich von Glück reden, dass ich nicht nach Hause geschickt wurde, weil ich keine Krawatte trug. Die – leider etwas dünn gesäten – Damen trugen teils festliche Abendkleider, teils elegante Business-Kostüme. So ähnlich stelle ich mir die Atmosphäre bei der Verleihung der Nobelpreise vor, nur dass die schwedische Königin fehlte. Zumindest hatte ich sie noch nicht gesehen.
Während des Essens unterhielt ich mich mit meinem Tischnachbarn. Er war ein Forscher aus den USA und arbeitete in einem Institut; es ging um irgendetwas mit Medizin, so ganz habe ich es nicht verstanden. Immer, wenn ich sicher war, ich hätte begriffen, was er eigentlich machte und es ihm stolz mitteilte, korrigierte er mich lächelnd. Naja, so sehr hatte es mich ohnehin nicht interessiert. Wie es aussah, hatte er ebenfalls keine Ahnung, warum er hier war. Er hatte ein Symposium erwartet und war einigermaßen perplex, dass er neben einem Werbetexter saß. Ich will ihm seinen Gesichtsausdruck zumindest mal als Verwirrung durchgehen lassen und nicht als Enttäuschung. Oder Empörung.
Mir war zumindest klar, dass ich nicht mit meinem forschenden Tischnachbarn an einer Werbekampagne arbeiten würde. Einer von uns beiden war ziemlich sicher fehl am Platze. Ich ging davon aus, dass ich das war. War ich am Ende nur aufgrund einer Verwechslung hier? Stefan Berger ist ja auch wirklich kein besonders ausgefallener Name. Meine Träume von Reichtum und Wohlstand schmolzen wie Schnee im Juli und in Gedanken sah ich mich schon um meinen Tagessatz prozessieren. Vielleicht hätte ich doch diese Berufsrechtsschutzversicherung abschließen sollen, von der ich alle 14 Tage eine Werbemail in meiner Inbox fand.
Nach dem Abendessen sollten wir endlich erfahren, warum wir hier waren. Ein schlanker, dunkelhaariger Mann betrat die kleine Bühne. Lässig hielt er ein schnurloses Mikrofon in der Hand und stellte sich als Dr. Anderson vor. Einer von diesen Typen, die unverschämt gut in ihren unverschämt teuren Anzügen aussehen. Beneidenswert, denn wenn ich Anzug trage, dann fühle ich mich nicht nur wie bei meiner Konfirmation, ich sehe auch aus wie ein 14-jähriger, völlig verunsicherter Teenager.
Zum Glück kann ich ganz gut Englisch, aber ich bemerkte, dass ein paar der anderen Gäste Kopfhörer aufsetzten, die unter dem Tisch befestigt waren. Simultanübersetzer? Das ist ja wie bei der UN-Vollversammlung. Die hatten wirklich an alles gedacht.
Dann ging’s endlich zur Sache. »Ladies und Gentlemen, Sie wundern sich natürlich, warum wir Sie hierher gebeten haben.« Er lächelte gewinnend, ich hatte das Gefühl, dass er die Situation in vollen Zügen genoss. Und wir hingen ja auch an seinen Lippen. »Bei dieser Gelegenheit erinnere ich Sie daran, dass alles, was Sie im Zusammenhang mit diesem Projekt erfahren, strengster Geheimhaltung unterliegt. Wenn auch nur ein Wort davon nach außen dringt, zahlen Sie die Vertragsstrafe. Bis zum letzten Cent. Und nicht nur das: Wir machen Sie fertig.« Er lächelte und sah seine Zuhörer an. Ich war angesichts der unverhohlenen Drohung unangenehm berührt und ich sah auch andere nervös mit den Füßen scharren und auf ihren Stühlen herumrutschen.
»Wir haben die Mittel, glauben Sie mir.« Dr. Anderson lächelte immer noch und von da an konnte ich ihn nicht mehr leiden. Zum Glück ist es mir als Freelancer scheißegal, ob mein Auftraggeber sympathisch ist oder nicht. Ein echter Vorteil, wenn man frei ist. Ein paar Tage halte ich es auch mit einem Idioten aus, aber für eine Festanstellung würde ich mir einen anderen Chef wünschen.
»Doch nun zu unserem Thema«, fuhr er fort. Wie durch Zauberhand erschien das Gesicht des Mädchens auf der Wand hinter ihm. Sasoko, nein: Setsuko, erinnerte ich mich. »Natürlich kennen Sie das Gesicht und Sie haben von der Selbstmordserie gehört, die auf diesen ersten Gruppenselbstmord folgte.« Viele Zuhörer nickten. »In letzter Zeit haben sie vermutlich kaum noch etwas darüber in den Medien gefunden. Vielleicht denken Sie, dass das nun zu Ende ist oder zumindest nachgelassen hat.«
Wieder blickte er in die Runde. Wieder nickten einige, andere zuckten gleichgültig die Schultern. Ich dachte: Das Thema ist durch, Mann, komm zur Sache.
»Ich versichere Ihnen: Das trifft nicht zu. Es geht weiter, dramatischer denn je.« Auf der Leinwand wurde eine nach oben zeigende Kurve sichtbar. »Wir unterdrücken nur jegliche Information zu diesem Thema, weil wir eine Panik befürchten.« Ein Raunen ging durch den Saal. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Naja, ich zumindest nicht.
»Überrascht? Das freut mich, denn das bedeutet, dass wir einen guten Job gemacht haben. Das ist aber eine unserer leichtesten Übungen«, sprach er weiter. »Denken Sie also genau nach, bevor Sie jemandem von diesem Treffen erzählen.« Der Beamer verlosch und Anderson schien allein im dunklen Raum zu stehen, von einem einzelnen Scheinwerfer angeleuchtet. Durchaus effektvoll.
»Jetzt fragen Sie sich, was Sie damit zu tun haben.« Er stieg elegant von der Bühne und spazierte zwischen den Tischen herum. Der Spot folgte ihm wie angenagelt. »Sie, Ladies und Gentlemen,« er nickte einigen seiner im Halbdunkel verborgenen Zuhörer zu, »wurden ausgewählt, weil irgendjemand glaubt, Sie könnten eine Antwort finden. Eine Lösung für dieses womöglich größte Problem der Menschheit. Vielleicht hat einer von Ihnen eine Idee, wie wir das Töten stoppen können. Bevor es zu spät ist … und wir eine ganze Generation verlieren.« Na, das war jetzt aber starker Tobak. Das war übertrieben, oder? Jetzt hatte er mich verunsichert. Der letzte Satz hatte gesessen.
Schweigend ging er weiter. Obwohl die Menge im Dunkel lag, erkannte ich Kopfschütteln, Schulterzucken und andere Gesten der Verwirrung. Deswegen waren wir hier? Das war doch völliger Unsinn. Ich bin Werbetexter, von mir aus auch Konzeptioner oder Creative Director. Und ich soll die Welt retten? Dann doch eher der Forscher neben mir. Vielleicht konnte der eine Pille erfinden, die alle Menschen glücklich machte. Aber bestimmt fiel das auch nicht in sein Metier.
Anderson wartete nicht, bis sich die Verwunderung seiner Zuhörer gelegt hatte, und sprach weiter: »Auf Ihren Zimmern finden Sie jede Menge Material zu den Vorfällen. Material, von dem Sie sich keine Vorstellung machen. Außerdem eine Liste der übrigen Teilnehmer. Treffen Sie sich, sprechen Sie miteinander. Finden Sie Antworten. Wenn Sie Hilfe brauchen, werden wir Ihnen jede erdenkliche Unterstützung geben. Jede. Meine Damen und Herren, es geht um das Überleben der Menschheit. Wir zählen auf Sie.« Das Licht verlosch und für ein paar Sekunden war der ganze Saal dunkel.
Das Licht ging an und ich sah mich unauffällig um. Ich wusste nicht recht, wie ich reagieren sollte und so beschloss ich, zu beobachten, was die anderen machten. Pathos ist mir zuwider. Wir zählen auf Sie – dass ich nicht lache. Wenn der Typ so eine Rede in einer Werbeagentur abgelassen hätte, hätte bestimmt jemand unauffällig ein paar Takte einer dramatischen Musik aus seinem Smartphone hervorgezaubert. Independence Day oder so etwas. Ja, Werbeagenturen und Pathos, das verträgt sich nicht.
Mein Tischnachbar hatte seine Brille abgenommen und strich sich mit der Hand übers Gesicht. Meine weiteren … soll ich sie Kollegen nennen? Mitgefangenen? Auserwählten? Sie verhielten sich jedenfalls ruhig. Ich sah jede Menge betroffene Gesichter und nur wenige ungläubige Mienen. Einen Tisch weiter sah ich auch eine ausgesprochen attraktive junge Dame. Schlank, dunkler Teint, fein geschnittenes Gesicht, blond gefärbte, schulterlange Haare. Schwer einzuschätzende Ethnie, aber das sind ja oft die hübschesten. Vielleicht Mittelmeerraum oder Südamerika, sie könnte aber auch einen asiatischen Einschlag haben. Ihre schlichte, weiße Bluse war aufregend weit aufgeknöpft. Sorry, dass ich mich von einer schönen Frau ablenken ließ, wo ich mich doch auf die Rettung der Welt konzentrieren sollte, aber ich bin eben auch nur ein Mann.
Alle Männer sind übrigens so, die meisten sind nur zu verlogen, um es zuzugeben. Ich wette, sogar der edle Offizier auf der Titanic, der einer Dame ins letzte Rettungsboot geholfen hat, hat dabei in ihren Ausschnitt geschielt, bevor er wieder auf selbstloser Held umgeschaltet hat und auf dem sinkenden Schiff zurückgeblieben ist. Wir Männer sind so programmiert. Ich beschloss jedenfalls, dass ich es irgendwie einfädeln musste, die Blonde näher kennenzulernen. Und das möglichst noch vor dem Ende der Welt. Was auch immer ihr Metier war, ich war sicher, es würde sich hervorragend mit meinem ergänzen. Und wenn alle Stricke rissen und wir »eine Generation verlieren«, würden wir die Welt eben wieder mit unseren hübschen Babys füllen.
Die Veranstaltung war zu Ende. Uns wurde gesagt, dass wir uns ausruhen sollten, die meisten hätten eine lange und anstrengende Anreise gehabt. Am nächsten Tag werde dann die Arbeit losgehen. Wer es aber nicht erwarten könne, der dürfe sich selbstredend jederzeit in das Thema einarbeiten, das Material stehe selbstverständlich schon bereit.
Ich wollte mir lieber noch an der Hotelbar einen kleinen Absacker genehmigen, aber zu meiner Enttäuschung war die Bar geschlossen. Ich hoffte inständig, dass das kein Dauerzustand war.
Mein Zimmer spiegelte leider nichts vom gediegen-antiquierten Charme der Lobby wider, sondern war so funktional und fantasielos eingerichtet wie jedes andere, x-beliebige Hotelzimmer der westlichen Welt.
Zunächst interessierte mich der Inhalt der Minibar. Ich trinke nicht gern allein, aber ich hatte das Gefühl, dass ich mir jetzt ein Schlückchen verdient hatte. Schließlich sollte ich die Welt retten. Leider fand ich in der Minibar nur Säfte, Mineralwasser und Cola. Super, wie bei einem Pfadfinderausflug. Wie sollte ich mich da entspannen? Auf dem Schreibtisch stand ein gut ausgestatteter PC (leider kein Mac) mit einem prächtigen Flachbildschirm, einer etwas seltsamen, ergonomischen Tastatur, aber natürlich ohne Internetanschluss. Ich schaltete die Kiste ein und klickte lustlos herum. Vielleicht könnte ich ja eine Partie Reversi spielen, oder welche Spiele auch immer heutzutage bei Windows vorinstalliert waren.
Der Server, auf den ich Zugriff hatte, war vollgepackt mit Dokumenten, Statistiken, Videos und Analysen zu den Selbstmorden. Vielleicht nicht ganz das Richtige, um danach gut zu schlafen, aber meine Neugier war geweckt. Ich überflog einige Dokumente und sah, dass das Phänomen wirklich ein globales Problem war, wobei es aus manchen Ländern natürlich kaum zuverlässige Zahlen gab. Alles konnten diese Typen also auch nicht organisieren.
Ich fand unzählige wissenschaftliche Artikel, die versuchten, die Ursache der Selbstmorde aufzudecken. Zum Glück stand bei jedem der Artikel eine auch für Laien verständliche Synopsis. Die meisten stellten fest, was die Selbstmord-Epidemie nicht war. Es war kein Virus, keine Epidemie. Eine Verbreitung durch Krankheitserreger irgendeiner Art schien ausgeschlossen. Aber auch der Nachahmer-Effekt spielte nur eine geringe Rolle, es kam auch zu Selbstmorden von Jugendlichen, die kaum etwas über das Phänomen gehört haben dürften, etwa im Iran und auf einer entlegenen Insel in der Südsee. Ich fand Alterspyramiden, danach waren die meisten Opfer zwischen 14 und 21, mit der Spitze bei 17 bis 18 Jahren. Etwas mehr junge Frauen als Männer töteten sich, aber, auch das wurde erklärt, das dürfte daran liegen, dass Selbstmorde junger Männer mitunter aus der Statistik fielen, weil sie häufiger wie Unfälle aussahen, z.B. wie eine Motorradkarambolage oder ein Sturz beim Klettern. Bis jetzt wenig Überraschendes. Ich hatte mich bisher zwar nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt, aber all diese Fakten hatte ich schon mal irgendwo gehört. Ich fragte mich, wo nun das Exklusivmaterial war.
Unter »Original_Media/Incident_No_1« fand ich Dutzende von Videos. Ich klickte auf das oberste. Das klare, aber wenig flüssige Video einer Sicherheitskamera erschien. Das musste den Selbstmord der ersten Gruppe zeigen, damals in Japan. Fujishiro hieß das Kaff, es war, soweit ich mich erinnern konnte, ein Vorort von Tokyo. Ich stellte es mir als richtig öde Schlafstadt vor, aber vielleicht traf das auch nicht zu. Das Video zeigte natürlich nur den Bahnsteig. Er sah sauber aus, geradezu wie geleckt. Die Kamera nahm nur ein paar Bilder pro Sekunde auf, dadurch wirkten die Bewegungen seltsam abgehackt. Die Menschen standen ordentlich in Zweierreihen an einer Markierung an. Würde der Zug etwa genau an der Markierung anhalten? Das wäre praktisch, warum schafft die Deutsche Bahn das eigentlich nicht?
Aber, nein, dieser Zug würde nicht anhalten, das wusste ich schon. Ein paar Mädchen in grauen Schuluniformen steckten die Köpfe zusammen, wenige Schritte entfernt alberten Jungs herum, die die männlichen Pendants der Uniform trugen. Ich sollte mir das nicht ansehen, dachte ich. Aber ich konnte nicht wegsehen. Am oberen Bildrand sah man einen Mann, der gerade aus einer Dose Cola oder etwas ähnlichs trank. Bewegung kam in die Menschen, vielleicht näherte sich der Zug, aber das ließ sich von der Perspektive, aus der das Video aufgenommen worden war, nicht erkennen. Doch, jetzt kam ein Zug, er war sehr schnell, vermutlich ein Expresszug, der nur durchfuhr; jedenfalls viel zu schnell, um anzuhalten.
Eines der Mädchen, das auf einem Mäuerchen gehockt hatte, stand plötzlich auf und sprang mit zwei großen Schritten auf die Schienen. Sie musste ein sportliches Mädchen gewesen sein. Beinahe sofort sprangen auch die anderen Jungen und Mädchen hinterher. Sie folgten ihr einfach, als gäbe es kostenlos Eiscreme oder so etwas. Das Video hatte keinen Ton, aber ich glaubte dennoch, das Kreischen der Bremsen des Zugs zu hören und das Geschrei der anderen Wartenden. Dann flogen Körperteile herum und ich hielt das Video an. Ach, du Scheiße, was für eine Sauerei. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wie konnte ein Mensch so viel Energie aufbringen, nur um sein Leben zu beenden? Sollte man, wenn man lebensmüde war, nicht irgendwie schwach und matt wirken? Das war ein Sprung, mit dem sie auf jedem Sportfest geglänzt hätte – aber sie würde nie wieder zu einem Sportfest … Fuck.
Ich bin bestimmt nicht zimperlich, aber es ist eben doch ein Unterschied, ob ich einen Horrorfilm ansehe, oder ob ich weiß, dass sich etwas wirklich zugetragen hat. Um mich abzulenken, wollte ich schnell etwas anderes anschauen. Ich scrollte ein paar Videos nach unten und fand ein untertiteltes Interview mit Satsukis Mutter, die immerzu nur weinte und ihrem Vater, dem die Aufmerksamkeit anscheinend in erster Linie unangenehm war. Beide schienen keine Ahnung zu haben, warum Satsuki sich das Leben genommen hatte. Warum sie so plötzlich die Lust am Leben verloren hatte. Wie es aussah, hatten sie aber nicht wirklich viel über das Mädchen gewusst. Ein entgeisterter Blick auf die Frage, ob Satsuki einen Freund gehabt hätte, dann vorsichtiges Nachfragen und entschiedenes Verneinen. Völliges Entsetzen schließlich, als gefragt wird, ob ihre Tochter vielleicht Drogen genommen hätte. Naja, so sind Eltern eben. Darum waren die Aussagen, dass es »keine Anzeichen« gegeben habe und Satsuki »ein ganz normales Mädchen« gewesen sei, sicher mit Vorsicht zu genießen.
Wesentlich interessanter fand ich ein Gespräch mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester. Sie war Satsuki wie aus dem Gesicht geschnitten und automatisch überlegte ich, wie sich diese Ähnlichkeit nutzen ließe. Nochmal sorry, aber ich kann eben nicht aus meiner Haut. Fünfzehn Jahre in der Werbung gehen nicht spurlos an einem Menschen vorüber. Die Schwester verstand überhaupt nicht, was passiert war und wusste nichts über die Gründe für den Selbstmord ihrer Schwester. Sie rutschte unbehaglich auf dem Stuhl hin und her, während sie sich so tapfer und so völlig erfolglos bemühte, nicht zu weinen, wenn sie von ihrer großen Schwester sprach, dass es selbst mich rührte und ich mir über die Augen wischte. Ich erkannte, dass sie die gleiche Uniform wie ihre Schwester trug. War sie gerade erst aus der Schule gekommen?
»Wie war dein Verhältnis zu deiner großen Schwester?«
Sie schien die Frage nicht zu verstehen. »Sie ist meine große Schwester.«
»Mochtest du sie?«
Sie presste die Lippen zusammen und hielt sich die Hand vor dem Mund. Dann nickte sie. Glücklicherweise beharrte der Interviewer nicht auf einer verbalen Antwort und fuhr fort: »Ist dir an Satsuki irgendetwas aufgefallen in letzter Zeit?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf.
Dem Interviewer war die Antwort wohl zu schnell gekommen. »Denk noch einmal darüber nach.« Das Mädchen errötete und sah zu Boden. Ich fand es unverschämt, die Aussage des Mädchens in Zweifel zu ziehen. Sie war doch kein kleines Kind mehr. Gut, sie war auch nicht erwachsen, aber dieses Nachfragen war respektlos.
»Nun?«
Ratlos sah sie an der Kamera vorbei, vielleicht suchte sie Hilfe bei einem für uns unsichtbaren Kameramann.
Nach einer kleinen Ewigkeit fuhr der Interviewer fort. »Sie war also wie immer.«
Sie presste die Lippen so fest zusammen, dass sie ganz weiß waren.
»Hat sie mit dir jemals über Selbstmord gesprochen?«
Keine Antwort. Ich wollte den unbarmherzig Fragenden anschreien, dass er das arme Kind endlich in Ruhe lassen sollte. Doch der hatte wohl eine Liste, die er abarbeiten musste.
»Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dich umzubringen?«
Ein entsetzter Blick. Entschieden schüttelte sie den Kopf.
»Bist du glücklich?«
Ich konnte nicht glauben, dass der Interviewer diese Frage gestellt hatte. Das Mädchen hatte gerade seine Schwester verloren und dann so eine Frage.
Mit leerem Blick sah das Mädchen in die Kamera, eine Träne rann aus ihrem Auge. Schnell, als müsse ihr das peinlich sein, wischte sie sie weg. Dann nickte sie, aber ihre gesamte Körpersprache sagte das genaue Gegenteil. Vielleicht fühlte sie sich zum Glücklichsein verdammt.
Ich spürte den unwiderstehlichen Drang, den Interviewer zu schlagen und das Mädchen in den Arm zu nehmen. Da beides nicht ging, beendete ich den Videoplayer. Als ob ich dadurch das furchtbare Interview ungeschehen machen könnte.
Danach hatte ich wirklich keine Lust mehr auf etwas Trauriges und schaltete den Fernseher ein. Offensichtlich gewährte man uns nicht einmal Zugriff auf das normale Fernsehprogramm, sondern stellte uns zu Unterhaltungszwecken lediglich eine Filmbibliothek zur Verfügung. Hatten sie Angst, dass uns eine Nachrichtensendung aus dem Gleichgewicht bringen könnte? Mir war’s erst einmal egal und so wählte ich Charlie Chaplins »Gold Rush« aus der Bibliothek. Den Streifen hatte ich sowieso schon lange mal wieder sehen wollen. Ich fläzte mich in den Sessel und muss dabei eingeschlafen sein.