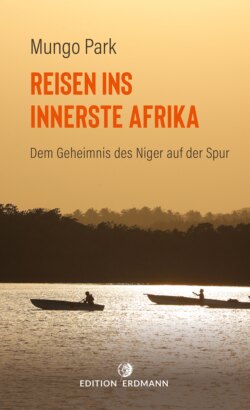Читать книгу Reisen ins innerste Afrika - Mungo Park - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DRITTER ABSCHNITT
ОглавлениеEINIGE NACHRICHTEN VON DEN EINWOHNERN TALLIKAS.
ANKUNFT IN KURKERANY. FISCHEREI AM FLUSS FALEMEH.
ANKUNFT IN FATTEKONDA.
UNTERREDUNG MIT ALMANI, KÖNIG VON WONDU.
ZWEITER BESUCH BEI DEM KÖNIG UND SEINEN FRAUEN.
ANKUNFT IN DSCHOHG.
Tallika, die Grenzstadt von Wondu gegen Wulli, wird von mohammedanischen Fullah bewohnt. Die durchziehenden Karawanen pflegen sich hier mit Lebensmitteln zu versehen und Elfenbein einzukaufen; denn die Einwohner sind geübte Elefantenjäger. Ein Verwalter des Königs residiert hier, der dem Herrscher von der Ankunft jeder Karawane rechtzeitig Nachricht geben muss. Der Zoll, den die Karawanen hier entrichten, wird nach Esels-Ladungen berechnet, d.h. für jeden beladenen Esel ist eine Taxe zu entrichten. Ich nahm meine Wohnung in dem Haus des Zolleinnehmers und vereinbarte mit ihm, dass er mich für fünf Barren nach Fattekonda, der Residenz des Königs, begleiten solle. Vor meiner Abreise schrieb ich einige Zeilen an Dr. Laidley und gab meinen Brief dem Führer einer Karawane, die eben nach dem Gambia abging. Sie bestand aus fünf mit Elfenbein beladenen Eseln. Von den großen Zähnen trägt der Esel zwei auf jeder Seite, die kleineren sind in Häute eingewickelt und mit Stricken befestigt.
Am 14. Dezember verließen wir Tallika und ritten ungefähr zwei Meilen weit ruhig fort, als auf einmal ein heftiger Wortwechsel zwischen dem Schmied und einem meiner anderen Begleiter entstand. Es ist merkwürdig, dass der Afrikaner eher Schläge vergibt als ein Schimpfwort auf seine Voreltern. »Schlage mich, aber schimpfe meine Mutter nicht« ist ein gewöhnlicher Ausdruck bei den Sklaven. Diese Art von Beleidigung hatte den einen so aufgebracht, dass er seinen Säbel gegen den Schmied zog, und der Streit wäre gewiss schlimm ausgegangen, wenn nicht die anderen ihm den Säbel aus der Hand gewunden hätten. Auch ich mischte mich ein, gebot dem Schmied Stillschweigen und drohte dem andern, der unrecht hatte, ihn wie einen Räuber auf der Stelle zu erschießen, wenn er in Zukunft wieder seinen Säbel ziehen oder mit einem meiner Leute Händel anfangen würde. Diese Drohung wirkte, und wir ritten verdrießlich den ganzen Nachmittag, bis wir in eine angebaute Ebene gelangten, in der mehrere kleine Dörfer lagen. In einem übernachteten wir. Eine gute Abendmahlzeit und kleine Geschenke beendeten alle Feindseligkeiten unter meinen Begleitern. Es war schon ziemlich spät, ehe wir an den Schlaf dachten. Wir unterhielten uns mit einem umherziehenden Sänger, der kleine Geschichten erzählte und Lieder spielte, indem er über eine gespannte Saite blies und sie zugleich mit einem Stäbchen strich. Diese umherziehenden Barden singen aus dem Stegreif das Lob derer, die sie bezahlen.
Am Morgen des 15. Dezember verabschiedeten sich meine beiden Slatihs mit vielen Gebeten für meine Sicherheit von mir. Eine Meile von Ganado entfernt setzten wir über einen Seitenarm des Gambias. Die Ufer sind steil und mit Mimosen bedeckt. Im Schlamm des Flusses gibt es eine Menge großer Muscheln, die aber von den Eingeborenen nicht gegessen werden. Gegen Mittag, als die Sonne fürchterlich brannte, ruhten wir zwei Stunden in dem Schatten eines Baumes, hielten unsere Mahlzeit mit Milch und gestoßenem Korn, das wir von einem Hirten kauften. Bei Sonnenuntergang erreichten wir Kurkerany, wo der Schmied einige Verwandte hatte. Hier machten wir ein paar Tage Rast.
Kurkerany ist eine mohammedanische Stadt mit einer hohen Mauer und einer Moschee. Ich bekam hier sogar eine Anzahl arabischer Handschriften zu sehen. Am Abend des 17. Dezember brachen wir wieder auf. Ein junger Mann, der Salz von Fattekonda holen wollte, begleitete uns. Gegen Abend erreichten wir ein kleines Dorf ungefähr drei Meilen von Kurkerany entfernt. Hier versahen wir uns mit Lebensmitteln, die so wohlfeil waren, dass ich ein schönes Rind für sechs kleine Stücke Bernstein kaufte; denn ich merkte, dass meine Reisegefährten sich vermehrten oder verminderten, je nachdem ihnen die Kost behagte.
Am folgenden Morgen setzten wir unsere Reise weiter fort. Da sich noch einige Fullahs zu uns gesellten, gewann unser Zug ein recht wehrhaftes Ansehen, und wir mussten nicht befürchten, in den Wäldern geplündert zu werden.
Die Neger haben eine eigene Art, die widerspenstigen Esel zum Gehorsam zu bringen. Sie spalten einen Baumzweig, geben dem Esel das gespaltene Ende wie das Gebiss eines Zaums ins Maul und binden die Enden davon über dem Kopf wieder zusammen. Das andere Ende des Zweiges hängt vom Maul zur Erde herab. Es muss so lang sein, dass es den Boden berührt, wenn das Tier den Kopf sinken lässt. Schlägt der Zweig an Steine oder Wurzeln an, verursacht das ihm einen heftigen Stoß gegen die Zähne. Der Esel merkt dies bald, trägt den Kopf aufrecht und geht sehr ruhig und gravitätisch. Das Ganze sieht lächerlich aus, hat sich aber bewährt und ist bei den Händlern allgemein üblich.
Die Nacht verbrachten wir in einem Dorf in einer elenden Hütte auf Stroh. Am nächsten Tag ritten wir bis zum Mittag einen dürren, steinigen, mit Mimosen bedeckten Hügel entlang. Dann senkte sich das Land nach Osten, und wir stiegen in ein tiefes Tal hinab, in dem ich viel weißen Quarz fand. Der Weg verlief in einem ausgetrockneten Flussbett immer nach Osten, bis wir ein großes Dorf erreichten, in dem wir anhalten wollten. Hier fanden wir viele Eingeborene in dünnen französischen Flor gekleidet, den sie Biqui nennen. Das ist ein leichter luftiger Anzug, der den Wuchs des Körpers durchscheinen lässt und deshalb vermutlich von Frauen besonders geschätzt wird. Das Betragen der Frauen passte indes keineswegs zu dem eleganten Gewand; denn sie sind im höchsten Grad zudringlich. Sie versammelten sich um mich und forderten Bernstein, Korallen und was sie nur bei uns sahen mit solchem Ungestüm, dass ich einfach nachgeben musste. Sie zerrissen mir den Mantel, schnitten meinem Bedienten die Knöpfe vom Rock, und wir mussten weiterziehen, um ihren Zudringlichkeiten nicht länger ausgesetzt zu sein. Ein Schwarm dieser Harpyien verfolgte uns eine halbe Meile weit.
Am Abend erreichten wir Subruduka. Da unsere Gesellschaft inzwischen auf vierzehn Personen angewachsen war, kaufte ich ein Schaf und hinreichend Korn zum Abendbrot. Nachdem wir es verzehrt hatten, legten wir uns bei unserem Gepäck nieder und brachten im starken Tau eine sehr unangenehme Nacht zu.
Am 20. Dezember brachen wir von Subruduka auf und erreichten um zwei Uhr ein Dorf an den Ufern des Falemehs, der hier in einem felsigen Bett reißend dahinströmt. Die Einwohner waren mit der Fischerei beschäftigt. Die großen Fische fangen sie in Körben aus gespaltenem Rohr, von denen einige mehr als zwanzig Fuß lang sind. Diese Körbe verwenden sie wie wir die Reusen. Zu diesem Zweck führen sie quer durch den Fluss einen Damm von Steinen auf und lassen hin und wieder Öffnungen darin, durch die das mit Gewalt sich durchdrängende Wasser die Fische in die dahinter aufgestellten Körbe führt, während die starke Strömung es verhindert, dass sie wieder herausschwimmen. Die kleinen Fische, von der Größe unserer Sardellen, werden in großen Netzen gefangen, die sie sehr geschickt zu bedienen wissen. Sie machen einen Handelsartikel daraus, zerstampfen sie in hölzernen Mörsern und lassen sie danach in großen Klumpen geballt an der Sonne trocknen. Die Mauren aus den Gegenden nördlich von Senegal, die in ihrer Heimat fast gar nichts von Fischen wissen, finden dieses getrocknete Fischmus, so übel riechend es auch ist, doch köstlich und bezahlen es sehr teuer. Die Eingeborenen schneiden ein Stück von diesem schwarzen Klumpen ab, kochen es im Wasser und vermischen es mit ihrem Kuskus.
Ich fand es sonderbar, dass in dieser Jahreszeit an den Ufern des Flusses überall das Korn im schönsten Wachstum stand. Bei genauer Untersuchung zeigte es sich aber, dass es nicht die übliche Kornart war, die am Gambia angebaut wird, sondern der Holcus cernuus, den die Eingeborenen Manio nennen. Er trägt sehr reichlich, wächst in der trockenen Jahreszeit und wird im Januar reif.
Bei meiner Rückkehr in das Dorf begegnete ich einem alten maurischen Scherif, der mir seinen Segen erteilte und mich um ein wenig Papier für Safis bat. Er bettelte auch den Schmied an, der es ihm willig gab, denn es ist Sitte, dass die jungen Mohammedaner den alten etwas schenken, wofür diese ihnen in arabischer Sprache den Segen erteilen, der mit großen Demutsbezeugungen empfangen wird.
Um drei Uhr nachmittags setzten wir unsere Reise am Flussufer entlang nach Norden fort und erreichten am Abend Nayimow, wo uns der vornehmste Mann der Stadt freundlich empfing und mit einem jungen Rind beschenkte. Ich erwiderte diese Freigebigkeit durch etwas Bernstein und Korallen.
Am 21. Dezember ließen wir unser Gepäck mit einem Boot über den Fluss schaffen. Ich selbst ritt hindurch, obschon das Wasser mir bis ans Knie ging. Es ist so klar, dass man von den höchsten Ufern des Flusses den Grund erkennen kann. Gegen Mittag erreichten wir Fattekonda, die Hauptstadt von Bondu. In Afrika gibt es keine öffentlichen Wirtshäuser, deshalb gehen die Fremden zum Bentang und warten dort, bis sie in die Behausung eines Einwohners eingeladen werden. Ein angesehener Kaufmann lud uns zu sich, und wir nahmen das Anerbieten an. Kaum waren wir aber eine Stunde dort, kam ein Bote, um mich zum König zu holen, der, wie er sagte, sehr begierig sei, mich sogleich zu sehen, wenn ich nicht allzu müde wäre.
Ich nahm meinen Dolmetscher mit und folgte dem Boten. Als mich dieser aber zur Stadt hinaus und über die Kornfelder führte, fürchtete ich, dass Hinterlist im Spiel sei. Ich blieb also stehen und fragte den Führer, wohin er gehe. Er zeigte mir daraufhin in einer kleinen Entfernung einen Mann, der unter einem Baum saß, und sagte, dass dies der König sei, der oft an diesem entfernten Ort Audienz gebe, um das Hinzudringen des Volkes zu vermeiden. Jetzt dürfe niemand zu ihm als ich und mein Dolmetscher. Als ich mich ihm näherte, nötigte er mich neben sich auf eine Matte zum Sitzen. Nachdem er sich meine Geschichte hatte erzählen lassen, fragte er, ob ich Sklaven oder Gold kaufen wolle. Als ich erwiderte, dass ich weder dies noch irgend sonst etwas einkaufen wolle, wunderte er sich sehr und verlangte, ich solle am Abend wieder zu ihm kommen, dann wolle er mir Lebensmittel geben.
Dieser Fürst hatte den maurischen Namen Almani, war aber doch ein Heide. Ich hatte gehört, dass er Major Houghton unfreundlich begegnet sei. Sein über alles unerwartet freundliches Benehmen beruhigte mich daher nicht, sondern ließ mich nur desto mehr Hinterlist vermuten. Ich glaubte daher, es sei das Beste, ihn durch einige Geschenke zu gewinnen, und nahm zu diesem Zweck beim zweiten Besuch am Abend eine Büchse Schießpulver, etwas Bernstein, Tabak und meinen Sonnenschirm mit. Für den Fall, dass man mein Gepäck durchsuchen würde, verbarg ich einiges davon unter dem Dach der Hütte, die ich bewohnte, und zog vorsichtshalber meinen besten Rock an.
Alle Häuser, die dem König oder seiner Familie gehören, sind mit einer hohen Lehmmauer umgeben, die ihnen das Ansehen einer Zitadelle verleiht. Das Innere ist in verschiedene Höfe geteilt. Am ersten Eingang stand ein Mann mit einer Flinte auf der Schulter. Der Weg führte dann durch mehrere Gänge, und an jeder Tür stand wieder eine Schildwache. Als wir an den Eingang der eigentlichen Wohnung kamen, in der sich der König aufhielt, zogen mein Führer und mein Dolmetscher der Sitte gemäß ihre Sandalen aus, und der Erstere rief den Namen des Königs so laut, bis aus dem Inneren geantwortet wurde. Wir fanden den König auf einer Matte sitzend und zwei von seinen Gefolgsleuten bei ihm. Ich wiederholte, was ich ihm schon über meine Reise erzählt hatte, doch schien er nicht völlig befriedigt. Die Idee, dass man aus bloßer Neugier eine Reise unternehmen könne, war ihm völlig neu. Es scheine ihm gar nicht denkbar, sagte er, dass ein Mensch bei Sinnen eine so gefährliche Reise unternehme, bloß um das Land und dessen Bewohner kennenzulernen. Als ich mich aber erbot, ihm meinen Mantelsack zu öffnen und alles vorzuweisen, was ich bei mir führte, zum Beweis, dass es keine Handelswaren seien, glaubte er mir endlich. Die Vorstellung, dass jeder Weiße ein Kaufmann sei, hat ihm ohne Zweifel den Argwohn beigebracht, ich könne die Wahrheit verhehlen. Er freute sich über meine Geschenke, besonders aber über den Sonnenschirm, den er zum Erstaunen seiner Bedienten, die den Gebrauch dieser wunderbaren Maschine gar nicht begriffen, immer auf- und zumachte. Als ich mich beurlauben wollte, bat er mich, noch ein wenig zu bleiben, und hielt eine Lobrede auf die Weißen, indem er ihren Reichtum und ihre Gutmütigkeit rühmte. Dann bewunderte er meinen blauen Rock, dessen gelbe Knöpfe ihm besonders zu behagen schienen, und endlich schloss er mit der Bitte, ich möge ihm denselben schenken. Zum Trost für meinen Verlust versprach er mir dagegen, ihn bei jeder feierlichen Gelegenheit anzuziehen und jedem, der ihn sehen würde, meine Freigebigkeit zu rühmen. Die Bitte eines afrikanischen Fürsten in seinem eigenen Reich an einen Fremden ist nicht viel weniger als ein Befehl. Da er sich mit Gewalt hätte nehmen können, was er sich von mir ausbat, zog ich ruhig meinen besten Rock aus und legte ihn zu seinen Füßen nieder. Zum Gegengeschenk erhielt ich einen großen Vorrat an Lebensmitteln.
Am anderen Morgen musste ich wieder zu ihm kommen. Ich fand ihn in seinem Bett sitzen. Er sei krank, sagte er mir, und wünsche, dass ich ihn zur Ader ließe. Kaum aber hatte ich ihm den Arm gebunden und die Lanzette herausgenommen, als er den Mut verlor, mir für meine Bereitwilligkeit dankte und mich bat, die Operation bis zum Nachmittag zu verschieben, da er sich jetzt auf einmal weit besser fühle. Dann bat er mich, seine Frauen zu besuchen, die sehr begierig wären, mich zu sehen. Man führte mich zu ihnen, und kaum war ich in den Hof getreten, als das ganze Serail sich um mich herdrängte. Einige baten um Arzneien, andere um Bernstein, alle aber wollten das große afrikanische Universalmittel versuchen und zur Ader gelassen werden. Es waren zehn oder zwölf Frauen, alle jung und schön, mit viel Korallen und Bernstein in ihrem Kopfputz.
Sie spotteten und lachten besonders über meine weiße Haut und über die hervorstehende Nase und behaupteten, dass beides erkünstelt sei. Die Farbe sei dadurch entstanden, dass man mich als Kind in Milch gebadet habe, und die Nase wiederum sei solange gekniffen worden, bis sie diese hässliche, unnatürliche Form habe annehmen müssen. Statt meine Hässlichkeit zu bestreiten, pries ich ihre Schönheit. Ich lobte das glänzende Schwarz ihrer Haut und die eingedrückten Nasen. Sie sagten mir aber, dass Schmeichelei oder – wie sie sich ausdrückten – ein Honigmund in Bondu nicht geachtet sei. Für meinen Besuch und für das Schöne, das ich ihnen gesagt hatte (wogegen sie also doch nicht so unempfindlich waren, wie sie vorgaben), beschenkten sie mich mit einem Krug Honig und einigen Fischen, die nach meiner Behausung gebracht wurden. Vor Sonnenuntergang musste ich abermals zum König.
Da es Sitte ist, beim Abschied eine Kleinigkeit zu schenken, so nahm ich Korallen und einige Bogen Schreibpapier mit, für die der König mir fünf Drachmen Gold gab. Das sei zwar nur eine Kleinigkeit, sagte er, er schenkte sie mir aber aus echter Freundschaft und ich könne mir doch unterwegs Lebensmittel dafür kaufen. Er erhöhte seine Wohltat noch durch die Erklärung, es sei sonst zwar eingeführt, das Gepäck der Reisenden zu durchsuchen, mich wolle er aber für dieses Mal damit verschonen, und es stehe mir nun frei abzureisen.
Am Morgen des 23. verließen wir Fattekonda und erreichten um elf Uhr ein kleines Dorf, in dem wir den Rest des Tages ruhen wollten. Am Nachmittag sagten mir meine Reisegefährten, dass wir jetzt an der Grenze zwischen Bondu und Katschaaga seien und diese Gegend als unsicher gelte. Es empfehle sich daher, erst mit Einbruch der Dunkelheit aufzubrechen. Ich mietete mir also zwei Führer, die uns durch den Wald bringen sollten. Sobald alles im Dorf schlief, brachen wir bei Mondschein auf. Das Geheul der wilden Tiere und der öde Wald machten einen schauerlichen Eindruck auf mich. Wir sprachen leise miteinander. Meine Gefährten zeigten mir einer nach dem anderen die Wölfe und Hyänen, die wie Schatten von einem Dickicht zum anderen schlichen. Gegen Morgen gelangten wir in ein Dorf, wo unsere Führer einen ihrer Bekannten aufweckten. Hier hielten wir an, um unsere Esel zu füttern und uns einige Erdnüsse zu rösten. Bei Tagesanbruch setzten wir unsere Reise fort und kamen am Nachmittag nach Dschohg im Königreich Katschaaga.