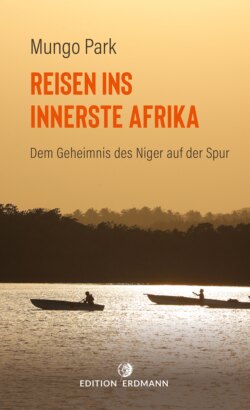Читать книгу Reisen ins innerste Afrika - Mungo Park - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIERTER ABSCHNITT
ОглавлениеNACHRICHT VON KATSCHAAGA. DIE SERAWULLIHS.
NACHRICHT VON DSCHOHG.
DER VERFASSER WURDE AUF BEFEHL DES KÖNIGS BADSCHERI
GEPLÜNDERT. GUTMÜTIGKEIT EINER SKLAVIN.
BESUCH BEIM NEFFEN DES KÖNIGS. ANKUNFT IN SAMI.
ANKUNFT IM KÖNIGREICH KASSON.
Das Königreich Katschaaga, in dem ich nun angekommen war, nennen die Franzosen Gallern. Ich wähle aber den Namen, den es in der Landessprache führt. Luft und Klima schienen mir rein und gesünder als irgendwo weiter gegen die Küste zu. Das Land ist voller Hügel und Täler, durch die sich der Senegal schlängelt, und die einen abwechslungsreichen, reizenden Anblick bieten. Der Senegal kommt aus dem Innern des Landes, strömt über felsige Höhen und hat hier schöne, malerische Ufer.
Die Einwohner heißen Serawullihs, und sie sind von glänzend schwarzer Farbe. Die Regierungsform ist monarchisch und – wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann – ziemlich uneingeschränkt. Indes klagt das Volk nicht über Bedrückung und unterstützte den König willig, als er mit dem König von Kasson Krieg führen wollte. Die Serawullihs sind ein Handel treibendes Volk, das früher viel Verkehr mit den Franzosen hatte, denen es Gold und Sklaven zuführte. Noch jetzt treiben sie mit den britischen Faktoreien am Gambia einigen Sklavenhandel. Wenn ein serawullihscher Handelsmann von einer Geschäftsreise nach Hause kommt, so versammeln sich sogleich die Nachbarn und wünschen ihm Glück zur Ankunft. Bei dieser Gelegenheit zeigt der Reisende seinen Reichtum und seine Freigebigkeit, indem er seinen Freunden kleine Geschenke macht. Ist aber seine Spekulation missglückt, so ist das Fest bald vorbei, jeder hält ihn für einen unverständigen Menschen, der eine große Reise unternehmen konnte und (wie sie sich ausdrücken) nichts mitbringt als das Haar auf dem Kopf!
Am 24. Dezember kamen wir nach Dschohg, der Grenzstadt dieses Königreichs, und kehrten beim ersten Beamten ein, der hier nicht mehr Alkaid, sondern Duti genannt wird. Er war ein eifriger Mohammedaner, aber sehr gastfrei. Die Stadt hat ungefähr zweitausend Einwohner und ist mit einer hohen Mauer umgeben. Ebenso ist jedes einzelne Gehöft mit einer Mauer umzogen, sodass man nichts als kleine Zitadellen sieht; denn eine solche Mauer ist hier, wo man nichts von Artillerie weiß, eine vollkommen hinreichende Befestigung.
Am Abend besuchte Madibu, der mich von Pisania aus begleitet hatte, seine Eltern in der benachbarten Stadt Dramanet, und ich erlaubte dem Schmied, ihn zu begleiten. Mit Einbruch der Nacht wurde ich eingeladen, die Belustigungen der Einwohner mitanzusehen, durch die sie Fremde bei ihrer Ankunft zu unterhalten pflegen. Umringt von einer zahlreichen Versammlung, tanzten beim Schein einiger großer Feuer mehrere Personen zum Schall von vier Trommeln, die regelmäßig und gleichförmig geschlagen wurden. Zum Tanz gehört hierzulande aber weder Kraft noch Geschmeidigkeit der Muskeln, sondern bloß eine üppige Gestikulation. Besonders wetteiferten die Weiber miteinander in den wollüstigsten Bewegungen.
Am 25. Dezember kam um zwei Uhr morgens ein Trupp Reiter in die Stadt. Sie weckten meinen Wirt und sprachen mit ihm. Dann stiegen sie ab und kamen zu meinem Lagerplatz. Einer der Reiter versuchte, die Flinte, die neben mir auf der Matte lag, zu stehlen, bemerkte aber bald, dass ich wachte. Nun setzten sich die Fremden bei mir nieder und blieben bis zum Tagesanbruch. Mein Dolmetscher gab mir durch sein Benehmen bald zu verstehen, dass wir nichts Gutes zu erwarten hätten. Es befremdete mich auch, dass Madibu und der Schmied schon wieder von ihrer Reise zurückkamen. Madibu erklärte mir aber das Rätsel. Kurz nach ihrer Ankunft in Dramanet sei des Königs zweiter Sohn mit neuen Reitern angekommen und habe sich nach dem Weißen erkundigt. Auf die Nachricht, ich sei in Dschohg, seien sie sogleich wieder aufgebrochen, und er und der Schmied hätten sich deshalb ebenfalls auf den Rückweg gemacht, um mir dies zu melden. Er hatte seine Erzählung noch nicht geendigt, als die zehn Reiter ankamen. Sie stiegen ab und schlossen mit den anderen zusammen einen Kreis um mich. Jeder hielt dabei seine Flinte in der Hand. Ich sagte nun meinem Wirt, dass ich Serawullihsch nicht verstünde und sie Mandingo sprechen müssten, wenn sie etwas mit mir zu verhandeln hätten. Nun trug ein kleiner Mann die Sache mit einer weitläufigen Rede vor. Ich sei in die Stadt des Königs gekommen, ohne vorher den Zoll erlegt oder dem König ein Geschenk gebracht zu haben. Nach den Gesetzen des Landes werde daher alles, was ich bei mir hätte, Bediente, Lasttiere und Gepäck, konfisziert. Sie hätten Befehl vom König, mich nach seiner Residenz Mahna zu fahren und mich notfalls mit Gewalt fortzubringen, wenn ich mich weigere. Bei diesen Worten standen sie alle auf und fragten, ob ich bereit sei. Es mit einer solchen Schar aufzunehmen, wäre vergebens und unklug gewesen. Ich bat sie daher bloß, so lange zu warten, bis ich mein Pferd gefüttert und meinen Wirt abgefunden hätte. Mein ehrlicher Schmied merkte nicht, dass diese Nachgiebigkeit nur Verstellung war. Er nahm mich beiseite und sagte, er habe mir immer mit der Treue und dem Gehorsam eines Sohnes gedient, ich würde ihn doch nicht so unglücklich machen und nach Mahna gehen. Es gäbe gewiss bald einen Krieg zwischen Kasson und Katschaaga, dann würde er nicht nur seine kleine Habe verlieren, die er in vier sauren Jahren erworben habe, sondern noch als Sklave verkauft werden, wenn seine Freunde nicht zwei Sklaven für ihn stellen könnten. Ich erbot mich deshalb dem Sohn des Königs gegenüber, ihn zu begleiten, wenn er dem Schmied, der Einwohner eines entfernten Königreichs sei und mit mir in keiner Verbindung stehe, gestatten wolle, bis zu meiner Rückkehr in Dschohg zu bleiben. Das war aber umsonst. Sie erklärten, wir hätten insgesamt gegen die Gesetze gehandelt und seien alle gleichermaßen verantwortlich. Nun ging ich mit meinem Wirt beiseite, schenkte ihm etwas Schießpulver und erbat mir seinen Rat. Er meinte, ich solle nicht zum König gehen; denn wenn dieser unter meinen Sachen irgendetwas von einigem Wert fände, so würde er es mir abnehmen. Es schien also am ratsamsten, mich mit des Königs Leuten abzufinden. So erklärte ich, nicht aus Mangel an Ehrfurcht gegen den König gehandelt zu haben, sondern bloß aus Unwissenheit als Fremder, der mit den Gesetzen des Landes nicht vertraut gewesen sei. Selbstverständlich wolle ich gern einen Zoll erlegen. Bei diesen Worten reichte ich ihnen zum Geschenk für den König die fünf Drachmen Gold, die mir der König von Bondu gegeben hatte. Sie nahmen sie an, bestanden aber trotzdem darauf, auch noch mein Gepäck zu durchsuchen. Alle Gegenvorstellungen halfen nichts. Sie öffneten die Bündel, fanden aber bei Weitem nicht so viel Gold und Bernstein, wie sie erwartet hatten. Dafür nahmen sie dann alles, was ihnen gefiel, zankten und stritten mit mir bis Sonnenuntergang und zogen endlich mit der Hälfte meiner Habseligkeiten ab. Meine Leute hatten durch diesen Vorfall allen Mut verloren. Wir hatten den Tag über noch nichts gegessen und bekamen nur ein kärgliches Abendbrot. Madibu bat mich, wieder umzukehren. Der Dolmetscher lachte darüber, dass ich ohne Geld weiterreisen wollte, und der Schmied ließ sich weder sehen noch hören, aus Furcht, man möchte ihn für einen Eingeborenen aus Kasson erkennen. So brachten wir die Nacht bei einem schwachen Feuer zu. Aber welche Verlegenheit am folgenden Tage! Ohne Geld konnte ich mir keine Lebensmittel verschaffen, holte ich aber etwas Bernstein hervor, musste ich fürchten, dass mir der König auch das wenige, was ich versteckt hatte, noch würde abnehmen lassen. Wir kamen also überein, den Tag über ohne Essen zu verbringen und abzuwarten, bis wir heimlich Lebensmittel kaufen oder uns etwas als Almosen erbetteln könnten.
Gegen Abend, als ich auf dem Markt saß und etwas Stroh kaute, ging eine alte Sklavin mit einem Korb auf dem Kopf vorüber und fragte mich, ob ich schon gegessen hätte? Ich dachte, sie spotte meiner, und gab ihr keine Antwort. Mein Negerjunge aber, der neben mir saß, sagte ihr, des Königs Leute hätten mich ausgeplündert und mir nichts gelassen. Bei dieser Nachricht sah mich die gute Alte mitleidig an, nahm gleich den Korb vom Kopf herunter, zeigte mir, dass Erdnüsse darin waren, und fragte, ob ich essen möchte. Als ich es bejahte, gab sie mir einige Hände voll und ging fort, ohne mir Zeit zu lassen, ihr zu danken. Es war eine Kleinigkeit, die aber meinem Herzen sehr wohltat. Diese Sklavin, so arm und unwissend sie war, fragte nicht erst nach meinem Stand oder nach meiner Lage, sondern tat auf der Stelle, was ihr das Herz zu tun gebot.
Kaum war die Alte fortgegangen, erhielt ich die Nachricht, dass ein Neffe des Mandingo-Königs von Kasson mich besuchen wolle. Er war als Gesandter zum König von Katschaaga geschickt worden, um Streitigkeiten zwischen diesem und seinem Oheim zu schlichten. Nachdem er das vier Tage lang fruchtlos versucht hatte, befand er sich auf dem Rückweg, und dabei trieb ihn die Neugier, den Weißen in Dschohg zu sehen. Den gutmütigen Mann rührte meine Lage so sehr, dass er mir seinen Schutz anbot und mich sicher nach Kasson zu geleiten versprach, wenn ich am anderen Morgen aufbrechen wollte. Mit Dank nahm ich dies an und machte mich mit meinem Gefolge bei Tagesanbruch am 27. Dezember auf den Weg.
Mein Beschützer – er hieß wahrscheinlich nach seinem Oheim Demba Sego – hatte zahlreiche Begleiter. Als wir Dschohg verließen, waren wir etwa dreißig Personen und führten sechs beladene Esel mit uns. Als wir einige Stunden ziemlich frohen Mutes geritten waren, ohne dass etwas Merkwürdiges geschah, kamen wir an einen Baum, nach dem mein Dolmetscher schon oft gefragt hatte. Wir hielten, und er zog ein weißes Huhn hervor, das er zu diesem Zweck in Dschohg gekauft hatte, band es mit den Füßen an einen Zweig und sagte, nun könnten wir sicher fortreiten, es werde uns nichts Übles begegnen. Ich erwähne dies bloß als einen Charakterzug der Neger. Sieben Jahre war dieser Mann in England gewesen und hatte sich doch nicht von den Vorurteilen seiner Kindheit befreien können. Das Huhn, sagte er, sei ein Opfer für die Geister des Waldes. So töricht dieser Wahn ist, so sah ich doch, wie gut er es mit mir meinte.
Mittags kamen wir nach Gungadi, einer großen Stadt, in der wir eine Stunde lang hielten, bis einige von unseren Eseln, die nicht so gut zu Fuß waren wie die übrigen, wieder zu uns stießen. Ich fand hier viele Dattelbäume und eine aus Lehm erbaute Moschee mit sechs Türmen, auf deren Spitzen Straußeneier befestigt waren. Kurz vor Sonnenuntergang kamen wir in der Stadt Sami am Ufer des Senegals an, der hier ein schöner, aber seichter Strom ist und langsam über einen kiesigen Boden hinfließt. Die Ufer sind hoch mit Gras bewachsen; das Land ist eben und angebaut.
Am Nachmittag des 28. Dezember gelangten wir von Sami nach Kayi, einem großen Dorf, das halb auf der Nord-, halb auf der Südseite des Flusses liegt. Etwas weiter flussaufwärts ist ein großer Wasserfall, wo der Strom über die Felsen herabstürzt. Gerade an dieser Stelle sollten unsere Lasttiere den Fluss passieren. Wir gaben deshalb durch Rufen und durch einige Flintenschüsse den Einwohnern jenseits des Flusses ein Zeichen. Endlich bemerkten sie uns und brachten einen Nachen für unser Gepäck herüber. Da das Ufer hier mehr als vierzig Fuß hoch ist, hielt ich es für unmöglich, die Tiere hinabzubringen, aber die Neger ergriffen die Pferde und ließen sie in einer ausgegrabenen Bahn, die anscheinend durch häufigen Gebrauch schon geglättet war, beinahe senkrecht hinabgleiten. Sobald sie auf diese Art in das Wasser getrieben waren, suchte auch ein jeder von uns so gut er konnte hinabzukommen. Der Fährmann zog einige Pferde am Strick ins Wasser und ruderte mit dem Nachen etwas vom Ufer ab. Dann wurden die übrigen Pferde in den Strom gedrängt. Einige junge Leute, die ihnen nachschwammen, begossen sie mit Wasser, wenn sie umkehren wollten, und nötigten sie auf diese Weise, geradeaus zu schwimmen. So glückte es uns, sie in etwa fünfzehn Minuten alle sicher an der anderen Seite zu sehen. Aber desto mehr Zeit und Mühe erforderte es, die widerspenstigen Esel hinüberzubringen. Erst nach vielen Stößen und Schlägen wagten sie sich ins Wasser. Kaum waren sie aber in der Mitte des Flusses, so kehrten sie trotz aller Mühe, die wir anwandten, wieder um. Drei Stunden dauerte es, bis alles vorüber war, und erst gegen Abend kam der Nachen zurück, um Demba Sego und mich zu holen. Es war ein missliches Fahrzeug, das bei der leichtesten Bewegung umzuschlagen drohte. Ausgerechnet da wollte der Neffe des Königs eine zinnerne Büchse betrachten, die mir gehörte und im Vorderteil des Bootes stand. Als er die Hand danach ausstreckte, geriet das Fahrzeug aus dem Gleichgewicht und schlug um. Glücklicherweise befanden wir uns noch nicht weit vom Ufer und konnten es ohne viel Schwierigkeiten wieder erreichen. Nachdem wir das Wasser aus unseren Kleidern gewrungen hatten, setzten wir über und landeten bald in Kasson.
Schwarze im Senegal