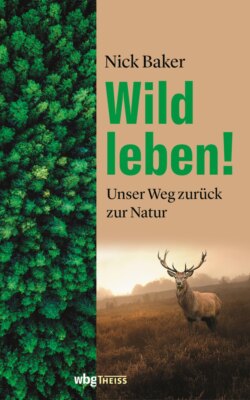Читать книгу Wild leben! - Nick Baker - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Im Auge des Affen
ОглавлениеDank Aristoteles und den anderen großen Denkern seiner Zeit werden die meisten, die man auf der Straße fragt, wie viele Sinne sie haben, mit „fünf“ antworten: Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Fühlen – diese Vorstellung ist sehr tief in uns allen verwurzelt, das haben wir in der Schule gelernt. Die fünf Sinne entsprechen natürlich den fünf großen anatomischen Merkmalen, mit denen wir ausgestattet sind und durch die wir den Großteil unserer Sinneseindrücke aufnehmen.
Sieht man jedoch etwas genauer hin – oder, wenn wir schon dabei sind, benutzt einen anderen, passend erscheinenden Sinn –, scheint es plötzlich nicht mehr ganz so einfach.
Die fünf traditionellen Sinne, an die wir heute denken – Sehsinn, Hörsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn und Tastsinn – leiten sich aus einem viel älteren Konzept ab.
Im Mittelalter beispielsweise hatten wir noch zehn Sinne. Man glaubte, es gebe sowohl innere als auch äußere Sinne. Die äußeren entsprechen den fünf Sinnen, die wir alle kennen, und zusätzlich gab es für die Menschen des Mittelalters noch fünf innere Sinne: Gemeinsinn, Vorstellungskraft, Einbildungskraft, Urteilskraft und Gedächtnis. Der Gemeinsinn ist das, was wir heute als gesunden Menschenverstand bezeichnen würden, die Urteilskraft würden wir heute wohl als Instinkt bezeichnen.
Im mittelalterlichen Englisch waren die Begriffe wit (Verstand) und sense (Sinn) ziemlich austauschbar. Wie auch immer Sie darüber denken – nur fünf Arten, die Welt zu verstehen, scheinen doch eine grobe Vereinfachung unseres Zartgefühls zu sein.
Selbst wenn man berücksichtigt, was wir aktuell über unsere Fähigkeiten wissen, scheint die Vorstellung von nur fünf Sinnen einfach nicht plausibel. Wir wissen definitiv, dass wir andere Sinne haben, und nicht nur den unerklärlichen „sechsten Sinn“, der schon immer auf eine Art übernatürliche, außersinnliche Wahrnehmung mystischer Qualität hindeutete. Das können wir besser. Wie wäre es mit einem siebten, achten, neunten und zehnten Sinn – uns stehen reichlich andere sensorische Modalitäten zur Verfügung, von denen wir einige gerade erst zu verstehen beginnen. Vielleicht müssen wir die großen Fünf hinter uns lassen. Indem wir glauben, das sei unser Los, könnten wir uns tatsächlich selbst bremsen, wenn es um ein sensorisches Eintauchen in unsere lebendige, natürliche Umgebung geht.
Vieles von dem, was Sie an diesem Punkt glauben und verstehen, lässt sich wohl auf die Semantik zurückführen – was macht einen Sinn eigentlich aus? Es lässt sich nicht bestreiten, dass nur wenige von uns die Sinne, von deren Existenz wir wissen, in vollem Umfang nutzen, und da sie alles sind, was wir haben, um dieser Welt einen „Sinn“ zu entlocken, ist es leicht, uns durch den Seesack zu wühlen.
Sehen wir uns die großen Fünf an, die wir gut kennen. Was sie sind, wie sie funktionieren, und, noch wichtiger im Kontext dieses Buches, wie wir jeden einzelnen effektiver nutzen können.
Rumms! „Au!“, machte das eine Kind, als es direkt in einen Baum lief, gefolgt von dem Geräusch eines anderen, das über einen Baumstumpf gefallen war, und dann, nach einer kurzen, bedeutungsvollen Ruhepause ganz ohne Geräusche, eine Kakophonie aus Jammern, Stöhnen und den Geräuschen, die bei Kindern in der Regel Missfallen ausdrücken. All das zerriss die friedliche Stille der Nacht.
Mein Experiment eines nächtlichen Sinnesspaziergangs klang nicht nur nach einem Fehlschlag – als ich die Taschenlampe einschaltete, sah es auch verdächtig danach aus. Einige Kinder wälzten sich auf dem Boden und umklammerten schmerzerfüllt ihre Beine und Arme; einige steckten in Brombeerdickichten fest und konnten weder vorwärts noch zum Weg zurück, den sie eingeschlagen hatten; andere standen wie angewurzelt da und zeigten verschiedene Schweregrade und Symptome von Nyktophobie. Das Ziel des Spiels, denn das sollte es eigentlich sein, bestand darin zu beweisen, dass es im Dunkeln nichts gibt, wovor man Angst haben muss. Doch das war auch genau der Moment, in dem mir klar wurde, dass meine Nachtsicht deutlich besser war, als mir bewusst gewesen war. Die Frage war nur, warum? War das eine angeborene Fähigkeit? Hatte ich einfach bessere Augen als alle anderen? Hatte mein Alter damit zu tun – sind Erwachsenenaugen besser als Kinderaugen? Hatte ich mehr Möhren gegessen oder mich unwissentlich auf diese Aktivität vorbereitet? Damals verstand ich nicht wirklich, was in dieser katastrophalen Nacht passiert war. Offenbar hatte ich mehr Probleme unter meinen jungen Teilnehmern geschaffen, als ich anfangs hatte lösen wollen. Aber erst viel später, nachdem ich mit einem anderen Naturforscher gesprochen hatte, begann ich einen Teil des wissenschaftlichen Hintergrunds zu verstehen.
Diese frühe Lektion in menschlicher Sinneswahrnehmung öffnete mir auf mehr als eine Art die Augen darüber, wie wir leben, welche Erwartungen wir an unsere Sinne haben und, noch wichtiger, wie wir uns beibringen können, sie besser zu nutzen.
Weil wir in unserem Innersten (oder vielmehr in unserem Kopf, da irgendwas zwischen 30 und 50 Prozent der Verarbeitungskapazität des Gehirns für die visuelle Verarbeitung genutzt werden) sehr stark visuell orientierte Affen sind, scheint dieser Sinn ein guter Ausgangspunkt für die allmähliche „Renaturierung“ unseres Ichs zu sein. Der erste Teil dieser Aussage gilt für alle Affen. Es ist eine Tatsache, dass die Augen das primäre Sinnesorgan für uns und für alle die anderen Affen und Menschenaffen sind, die an unserem speziellen Ast des phylogenetischen Baums hängen. Sie sind im Verhältnis zu unserem Körper auch ziemlich groß; unsere Augen sind mit etwa 2,5 Zentimeter Durchmesser und sieben Gramm Gewicht die größten. Zu verdanken haben wir das wahrscheinlich den nächtlichen Aktivitäten unserer frühesten Vorfahren.
Während ich hier sitze und schreibe, wird gerade eine 3,2 Millionen Jahre alte Geschichte bekannt. „Lucy“, der berühmteste fossile Hominide der Welt, entdeckt von Donald Johanson in den 1970er-Jahren in der Olduvai-Schlucht in Tansania, starb wahrscheinlich nach einem Sturz von einem Baum. Als ich das hörte, kam ich ins Nachdenken.
Sich bei einem Sprung zu verschätzen, würde das Individuum und alle seine Gene ziemlich schnell aus dem Genpool entfernen, während diejenigen, die darin besser waren, vielleicht wegen größerer, besserer und mehr nach vorn ausgerichteter Augen, eine deutlich bessere Überlebenschance hatten und damit auch eine größere Chance, sich zu vermehren und die siegreichen Merkmale weiterzugeben.
Offensichtlich war Lucys Unfall ein Unglück; sie hatte bereits unsere Augen und einige Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass die frühen Hominiden sogar bessere visuelle Fähigkeiten hatten als moderne Menschen, aber soweit wir wissen, hätte sie die Hand ausstrecken und ohne viel Herumgetaste ein Objekt vor ihr ergreifen können, genau wie Sie und ich. Unser ausgezeichneter Sehsinn hat zum Teil mit dem Leben unserer Vorfahren in den Bäumen zu tun und ist etwas, das wir mit Lucy und vielen anderen Primaten teilen.
Eine der Theorien für unseren hervorragenden Sehsinn hat mit genau diesem Umstand zu tun – unsere Augen zeigen nach vorn und sorgen für ausgezeichnetes Binokular- oder stereoskopisches Sehen. Wenn Sie durch einen Zoo schlendern oder durch eine Tierenzyklopädie blättern, können Sie die Tiere darin in zwei große Kategorien einordnen: Tiere, deren Augen vorn am Kopf sitzen, und Tiere, bei denen sie seitlich angeordnet sind.
Es leuchtet ein, dass bei der allmählichen Verschiebung der Augen nach vorn die Überlappung des Gesichtsfelds beider Augen immer größer wird. In diesem Überlappungsbereich sieht jedes Auge dieselbe Szene aus einem leicht unterschiedlichen Winkel von einigen Grad, was diesen Tieren, also auch uns, das sogenannte Binokularsehen ermöglicht: die Fähigkeit, präzise Entfernungen zu beurteilen und Raumtiefe wahrzunehmen. Zum Ausgleich wird unser Gesichtsfeld insgesamt kleiner, je besser unser Binokularsehen wird. Mit anderen Worten, wir können Entfernungen besser beurteilen als beispielsweise ein Kaninchen, aber wir haben nur ein Gesichtsfeld von knapp 180°, während ein Kaninchen über 360° verfügt und fast sein gesamtes Umfeld beobachten kann, vor ihm und auch hinter ihm.
1922 stellte der britische Augenarzt Edward Collins fest, dass frühe Primaten ein visuelles System brauchten, mit dem sie „mit Präzision von Ast zu Ast schwingen und springen … Nahrung mit den Händen ergreifen und damit zum Mund führen konnten“. Als unsere Vorfahren in die Bäume zogen, mussten sie ihren Fressfeinden entkommen und fliehende Beute ergreifen können; es ist absolut logisch, dass der Evolutionsdruck auf diese frühen Primaten ein visuelles System mit ausgezeichneter Tiefenwahrnehmung begünstigte.
Diese Theorie erscheint sehr plausibel, bis man Eichhörnchen ins Spiel bringt. Eichhörnchen sind ebenso zu todesverachtenden Sprüngen in der Lage wie Affen, und doch sitzen ihre Augen seitlich am Kopf! In Reaktion auf das Eichhörnchenhaar in Collins Theoriesuppe entstand eine weitere Theorie.
2005 stellte der biologische Anthropologe Matt Cartmill eine andere Idee vor: Räuber brauchen nach vorn ausgerichtete Augen, um sich mit größter Genauigkeit auf ihre Beute zu stürzen. Denkt man an Eulen und Katzen, ist das plausibel. Frühe Primaten waren vermutlich Insektenfresser und jagten wie die heutigen Buschbabys und Koboldmakis eher mit den Augen als mit der Nase. Sie waren vorwiegend nachtaktiv und diese Abhängigkeit von den Augen bedeutete, dass in der Evolutionszeit, in der die Augen und alle zugehörigen neurologischen Verknüpfungen nach vorn wanderten, der physische Platz für eine Nase und die verschiedenen Nervenverbindungen, die zur Übermittlung dieser Informationen ans Gehirn nötig sind, verdrängt wurden, und damit ein Primärsinn gegen einen anderen ausgetauscht wurde.
Es gibt jedoch auch Räuber, die nicht in dieses spezielle Modell passen, hauptsächlich tagaktive Jäger wie die Manguste.
Die Theorie musste also noch weiter verfeinert werden. Der Neurobiologe John Allman warf in die Debatte, dass diese Theorie sich am besten durch Räuber erklären ließ, die sich im Laufe der Evolution auf die Jagd bei Nacht spezialisiert haben. Er argumentierte, dass nach vorn ausgerichtete Augen wesentlich besser das Licht sammeln als seitlich positionierte. Unsere frühen Vorfahren waren wahrscheinlich nachts aktiv, also könnte diese Theorie den Ist-Zustand sehr wohl erklären. Eine weitere hübsche Ergänzung dazu war die „Röntgenblick-Theorie“ eines weiteren Neurobiologen namens Mark Changizi. Er erklärte, dass unser ausgezeichnetes stereoskopisches Sehen darauf zurückzuführen sei, dass unsere Vorfahren durch dichtes Laubwerk spähen mussten, daher die Anspielung auf Superkräfte im Namen dieser Theorie.
Sie können sich diesen „Röntgenblick“ selbst demonstrieren, indem Sie einfach einen Finger vor Ihrem Gesicht hochhalten und auf einen Punkt dahinter sehen – Sie werden zwei Bilder Ihres einzelnen Fingers bemerken und wegen des Abstands Ihrer Augen erscheinen beide transparent. Sie können also durch Ihren Finger hindurchsehen – jawohl, offenbar haben Sie einen Röntgenblick!
Übertragen Sie dieses Phänomen nun auf ein anderes Szenario, in dem ein scheuer, nervöser Halbaffe nicht einen Finger vor seinen Augen hochhält, sondern in dichtem Laubwerk kauert und versucht, unentdeckt zu bleiben, gleichzeitig aber seine dreidimensionale Welt nach Beute absucht – schon hat die Fähigkeit, durch das Durcheinander eines dichten, üppigen tropischen Waldes hindurchblicken zu können, einen konkreten Sinn.