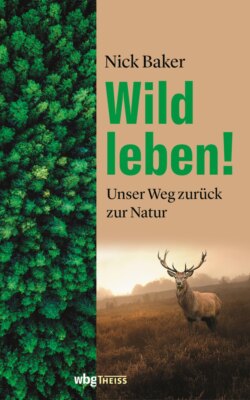Читать книгу Wild leben! - Nick Baker - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Natur hinzufügen oder Kultur abziehen?
ОглавлениеStellen Sie sich folgende Szene vor: Die blutrote Hornscheide eines Schnabels vor einer leuchtend grünen Grasnarbe; das lebhafte zweifarbige Auge beobachtet alles. Abgesehen vom kaum wahrnehmbaren Lidschlag und dem vom Wind zerzausten Gefieder sitzt es bewegungslos da.
Dreht man den Ton ab, erscheint die Szene ganz normal, fast wie ein Beispiel für Komplementärfarben auf dem Farbkreis. Das Austernfischerweibchen sitzt auf seinem Nest auf vier granitgrauen, braun gefleckt-gesprenkelten Eiern. Diese Eier sind ihr Ein und Alles, ihr Polarstern; vielleicht sind sie ihr einziger Beitrag zur nächsten Generation. Nicht, dass man sie sehen könnte, sie sitzt fest darauf, hingekauert auf einem einfachen schalenförmigen Nest, und schützt und nährt die Saat des Lebens darin, indem sie den begehrlichen Blick der Silbermöwe und die Kälte des schottischen Windes von ihrer matten Oberfläche fernhält.
Gehen wir nun aus diesem Mikrokosmos frühlingshafter Ruhe in die Totale, vorbei an den nickenden Grasnelken über der Zistrose, vorbei an den Kaninchen, die die Grasnarbe fest und elastisch halten, vorbei an der aufgemalten weißen Linie, der Chipstüte und der zerdrückten Getränkedose, dem Asphalt, den zerschmetterten Überresten eines jungen Kaninchens, und schalten wir den Ton wieder an: ein unablässiges Getöse, die Dissonanz von Motorrad, Bus, LKW und Auto, Lärm und Dreck rund um die Uhr.
Das ist die moderne Wildnis. Eine kreisrunde Wildnis, ein Fragment der Highlands auf einer Verkehrsinsel in Inverness.
Es funktioniert einstweilen für die Tausenden von uns, die sie umfahren, und für diejenigen mit den Füßen auf ihrem Boden. Es ist ein Fragment von etwas, das sich für Austernfischer und Kaninchen richtig anfühlt, ebenso für unzählige andere wilde Tierarten, die sich zweifellos dieses Atoll auf der A9 mit ihnen teilen, aber im Augenblick unsichtbar bleiben. Sie sind in Sicherheit vor Räubern und haben alle Annehmlichkeiten, die sich ein nistender Austernfischer oder ein Kaninchen wünschen könnte, bis sie fortmüssen, und das werden sie eines Tages.
Zuerst schien mir diese Szene wie ein Sinnbild für die zurückschlagende Natur, für das Leben, das sich immer durchsetzt. Aber nicht weit entfernt, in den Glens und Straths, durchleben Austernfischer genau wie dieser gerade denselben Lebenszyklus. Das war kein Beispiel dafür, wie Vögel in unsere Nähe gezogen sind, sondern eher dafür, wie wir uns in ihren Lebensraum gedrängelt, unser Leben über ihres gestülpt haben ohne Rücksicht auf ihre Bedürfnisse. Wir hatten blind immer weitergemacht, immer weiter Asphalt verlegt, der sich ausdehnte und ausbreitete, bis er die ganze Landschaft bedeckte.
Es schien unvereinbar und unbequem: ein Tier aus wilden, windzerzausten Weiten, umtost vom Luftzug der LKW, von Staub und Dieseldämpfen. Doch auch wenn mich dieses Bild wegen der extremen Gegenüberstellung seiner Elemente traf wie ein Faustschlag, war das Ergreifende daran das, woran es mich erinnerte: Natur neben, aber getrennt von der Zivilisation.
Ein ähnliches Szenario offenbart sich überall auf dem Land und im Übrigen auch überall auf der Welt.
Während der Austernfischer und die Kaninchen im Augenblick zufrieden waren, in Sicherheit in ihrem, wenn auch lauten, Zufluchtsort, beunruhigte mich der Gedanke daran, was passieren würde, wenn die tapsigen Küken schlüpften und begannen umherzutaumeln, oder wenn die Kaninchen, nachdem sie sich arttypisch vermehrt hatten, sich verteilen mussten. Was auf dieser Verkehrsinsel passierte, war eine Miniversion davon, wie die meisten Naturschutzgebiete funktionieren (oder auch nicht). Eine parzellisierte Idylle, ein umzäuntes, abgeschottetes Fragment dessen, wie es früher in der gesamten Umgebung war. Etwas zu „konservieren“ bedeutet, es im selben Zustand zu erhalten, etwas Erwünschtes zu bewahren, wie Konfitüre in einem Schraubglas. Aber während ein zuckerhaltiges Mus aus Früchten unbegrenzt lange konserviert im Regal stehen kann, funktioniert das mit der Natur nicht so einfach.
Der bewahrende, konservative Naturschutz wird seit seiner Entstehung im 18. und 19. Jahrhundert hauptsächlich als Unterteilung der Landschaft verstanden, ein verzweifelter Griff nach Landstücken, um rasch verschwindende Lebensräume und die darin enthaltenen Arten festzuhalten.
Über 99 Prozent ihrer Existenz als Art waren die Menschen Jäger und Sammler, nomadische Affen mit einem großen Kopf. Einem großen Kopf auf einem Körper, der sich letztendlich niederlassen und weniger seinem Abendessen hinterherlaufen wollte.
Vor rund zehntausend Jahren dann begann jemand mit dem, was wir Landwirtschaft nennen – ein Verfahren, durch das sich die ermüdende Notwendigkeit abschaffen ließ, andere Lebewesen zu jagen.
Seitdem geht es uns als Art gut. Nahrung zu finden, ist nun vorhersagbarer, einfacher. Wir haben die Lebewesen eingezäunt, die wir essen wollen, und sie am Weglaufen gehindert, damit wir sie nicht mehr energiezehrend verfolgen müssen. Ebenso haben wir Methoden entwickelt, die Pflanzen wachsen zu lassen und zu kultivieren, die wir neben die Lebewesen auf den Teller legen wollen.
Dieser Ehrgeiz, uns das Leben leichter zu machen, ist ein wenig zur Besessenheit geworden, dank der wir die Natur kontrollieren, manipulieren und formen, damit sie unsere Bedürfnisse erfüllt. Uns von der Wildnis und unserem natürlichen ökologischen Zustand zu distanzieren, ist zum menschlichen Fortschrittsmodell geworden. Das Verfahren der Landwirtschaft, mit dem wir erstmals im Fruchtbaren Halbmond im alten Mesopotamien experimentierten, hat es uns ermöglicht, sesshaft zu werden und irgendwann schließlich Städte und Kulturen zu erschaffen. Das wiederum verschaffte uns reichlich Zeit, nachzudenken und neue Dinge zu entwerfen, die uns das Leben noch einfacher machten und durch die wir andere Probleme überwinden konnten, die wir zwangsläufig selbst erschaffen haben. Bald folgten die Kanalisierung von Wasser, Handelsnetzwerke, Straßen und Boote. Dieser Prozess der Kontrolle und Ausbeutung für unsere eigenen Bedürfnisse setzte sich ununterbrochen bis in den ersten Teil des 19. Jahrhunderts fort. Wir haben uns ausgebreitet wie eine Plage. Wo wir früher zwischen den Bäumen hindurchschlüpften und uns lautlos durch das Gras bewegten, suchen wir nun nach Herrschaft; wir haben die Bäume versetzt und entfernt, sind über ganze Ökosysteme getrampelt und haben sie zerstört, während wir zum Schaden fast aller anderen Arten und der Lebensräume, die sie brauchen, die Welt nach unseren eigenen Bedürfnissen umgestaltet haben.
Es gab jedoch einige, die diesen Landverbrauch klugerweise infrage stellten, und so entstand eine Gegenkultur. 1821 baute der englische Exzentriker Charles Waterton für 9.000 Pfund eine fünf Kilometer lange, drei Meter hohe Mauer um sein Anwesen Walton Hall in Yorkshire, um die wilden Vögel und andere Wildtiere, die ihm am Herzen lagen, vor den Aktivitäten der Wilderer zu schützen. Damit schuf er unwissentlich das erste Naturschutzgebiet (dieser Vordenker wird auch als Erfinder des Vogelhäuschens genannt). Kurz darauf unterschrieb Präsident Grant auf der anderen Seite des Atlantiks 1872 eine Verfügung für den ersten Nationalpark; Yellowstone wurde gegründet, um seine einzigartigen geologischen, geothermalen und landschaftlichen Merkmale vor Ausbeutung und Zerstörung zu schützen. Die Naturschutzbewegung nahm an Fahrt auf.
Traditionell sollten Naturschutzgebiete, Nationalparks und Wildtierschutzgebiete Rückzugsorte für die Natur sein, in dem sie abgeschottet und geschützt wird und die Art ausgeschlossen wird, die sich zuvor so verheerend auf sie ausgewirkt hatte – wir.
Was jedoch als verzweifelte Maßnahme begann, Orte angesichts der fast sicheren anthropogenen Zerstörung zu retten, funktionierte zwar kurzfristig, griff aber langfristig zu kurz. Während Naturschutzgebiete in einigen Fällen als nützliche Schutzräume für gefährdete Arten und Lebensräume dienen, als aus der Verzweiflung geborene Rückzugsorte, sind sie tatsächlich selten groß genug, um langfristig zu funktionieren.
Yellowstone mit seinen 9000 Quadratkilometern Wildnis erscheint vielleicht groß genug, um auf natürliche Weise zu funktionieren, aber nichts könnte der Wahrheit ferner liegen. Zwar mag es einem Menschen groß vorkommen, der ein paar Kilometer am Tag wandert oder in einer Welt aufgewachsen ist, in der wichtige Dinge fehlen, doch für einen einzelnen Wolf, Bär oder Vielfraß ist es eine Insel.
Sicher, eine Insel, die eine Weile funktioniert, aber genau wie eine Maschine mit unzähligen Einzelteilen kommt sie ohne mechanische Wartung irgendwann knirschend zum Stillstand. All die komplizierten Mechanismen, die wir gerade erst zu verstehen beginnen, müssen nämlich gepflegt werden. Wölfe oder Biber oder andere Schlüsselarten sind die ökologischen Ingenieure; wenn ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden und sie dem System verloren gehen, arbeitet das System früher oder später nicht mehr richtig und es bleibt nur noch eine unzusammenhängende Sammlung von Arten übrig, die nicht mehr miteinander in Beziehung stehen. Das ist das, was in recht starker Vereinfachung das natürliche Gleichgewicht genannt wird.
Wenn Wölfe oder Biber keinen Artgenossen aus benachbarten Populationen mehr begegnen können, was für die langfristige Erhaltung der Population ebenso notwendig ist wie ausreichend Lebensraum und Nahrung für ihre kurzfristige Erhaltung, dann ist das Spiel vorbei. Wenn ein Wolf, Bär oder Bison Yellowstone verlässt, trifft er unweigerlich irgendwann auf einen Menschen und wird erschossen. Denken wir nur an die Austernfischerküken zurück, die am Rand der Verkehrsinsel umhertorkeln: der Maßstab ist ein anderer und es geht nicht um ein Naturschutzgebiet, aber der Grund für die Bewegung und das Ergebnis sind genau dieselben.
Dieses größere Bild haben wir bis vor relativ kurzer Zeit nicht gesehen. Eine Philosophie der Topfpflanzen oder von Noahs Arche beherrschte bisher unsere Beziehung zu Tieren und Pflanzen, eine Art Zweierreihen-Mentalität, immer eine Art nach der anderen. Der traditionelle zoologische oder botanische Garten ist ein Sinnbild dafür, wie wir Naturschutz oft wahrnehmen – einige dieser Einrichtungen nennen sich denn auch Naturschutzorganisationen. Aber selbst diese gefangenen Populationen können isoliert nicht bestehen – darum geht es in den Zuchtregistern: eine Art von genetischer Integrität zu bewahren, so gut wir können, soweit unser etwas arrogantes Verständnis solcher Dinge eben reicht. Vor nicht allzu langer Zeit dachten wir noch, die 9000 Quadratkilometer in Yellowstone seien reichlich, aber inzwischen haben uns neue Technologien ein besseres Verständnis für die dynamische Natur und die umfassenden Raumanforderungen der Populationen vieler großer Tiere ermöglicht.
Die Wölfin Pluie war ein berühmtes Beispiel dafür. Mit fünf Jahren wurde sie eingefangen und mit einem Peilsender versehen. In nur neun Monaten durchstreifte das Tier mit dem Senderhalsband ein Gebiet, das über zehnmal größer war als Yellowstone, rund 100.000 Quadratkilometer, und überquerte drei Staatengrenzen, bevor es von einem Jäger getötet wurde. M65, ein junges Vielfraßmännchen mit Peilsender, wanderte über 800 Kilometer und durchquerte mindestens vier Bundesstaaten, bevor es ebenfalls durch die Hand eines Mannes den Tod fand, der es für eine Bedrohung für sein Vieh hielt. Hier handelt es sich um große, unübersehbare Lebewesen, und solange sie nicht ins Visier eines Jagdgewehrs geraten oder am Kühler eines Lasters enden, schlagen sie sich irgendwie durch. Sie suchen sich Räume, die für sie funktionieren, sie haben eine natürliche Veranlagung, sich zu zerstreuen, zu wandern, bis sie ein freies Revier, neue mögliche Partner und natürlich die Nahrungsquellen finden, die sie brauchen. Dank Wildtier-Telemetrie und GPS-Systemen begreifen wir allmählich die Schwächen unserer bisherigen Anschauungen. Viele dieser großen Tiere – Bären, Wölfe, Luchse, Vielfraße und Elche – können auf der Suche nach einem Dinner und einem Date endlos viele Kilometer zurücklegen.
Wie ein schlechter Witz oder ein wiederkehrender Albtraum wiederholt sich genau diese Situation fast überall auf der Welt, wohin man auch blickt. Hungrige Tiere mit hohem Platzbedarf werden auf zunehmend fragmentierte Lebensräume beschränkt. Sie sind eingeschlossen, manchmal wortwörtlich, manchmal durch für uns unsichtbare Grenzen wie grüne Wüsten von Ackerland, offene Weiden, Straßen und Erschließungen. Tiger, Jaguare, Elefanten, Löwen, Eisbären, Mähnenwölfe, Riesengürteltiere, suchen Sie sich eins aus. Sieht man nur genau genug hin, findet man immer Konflikte. Es gibt keinen Platz für diese ökologischen Riesen.
Aber wenigstens haben viele dieser Tiere Fans, die für ihre Rechte eintreten. Es ist einfach, einen Menschenaffen auf ein Poster oder in eine Anzeige in einer Zeitschrift zu drucken und Sympathie für ihre Sache zu erzeugen. Die Macht feuchter Augen darf man nicht unterschätzen. Deshalb besteht ein kulturelles Bewusstsein für solche Tiere – aber was ist mit anderen, kleineren Arten, die auf ihre Weise genauso wichtig sind? Sie sind vielleicht keine Schlüsselarten, aber bringen genauso viele Punkte für die Artenvielfalt, also für genau das, was unsere Welt interessant macht.
Kennen Sie die Bauchige Windelschnecke? Wenn Sie sich nicht zufällig an die Schlagzeilen erinnern, die 1996 vom „Krieg in Newbury“ und dem Bau der Newbury-Umfahrung berichteten, wahrscheinlich eher nicht.
Dieses kleine, drei Millimeter lange braune, gezwirbelte Weichtier stoppte den Bau einer großen Straße, bis man es wortwörtlich aus dem Weg räumte und an einen anderen Ort versetzte. Die Bedingungen für sein Überleben waren dort jedoch nicht optimal und es starb aus: traurig, aber auf traurige Weise auch vertraut.
Obwohl wir in Großbritannien 15 Nationalparks, 224 staatliche Naturschutzgebiete und Tausende weitere in Privathand oder im Besitz von nichtstaatlichen Naturschutzorganisationen haben, und dazu noch Naturschutzgesetze, stellen wir ein deprimierendes Versagen der ursprünglichen Idee fest. Immer noch lassen wir die Artenvielfalt mit erbärmlicher Geschwindigkeit ausbluten und schaffen es nicht, irgendeins der Ziele zu erreichen, die wir uns selbst setzen, also funktioniert unser derzeitiges Modell ganz offensichtlich nicht.
Naturschutzgebiete, ganz gleich in welcher Form, erfüllen ihre grundlegende Aufgabe nicht, und genau wie in Nordamerika und anderen Teilen der Welt sind dafür die wachsenden Bevölkerungszahlen und der stetige Ausbau unserer Zivilisation mit allem Drum und Dran wie der Fragmentierung von Lebens räumen und dem Auf- und Ausbau kultureller Infrastrukturen ohne Rücksicht auf die Natur verantwortlich.
Das Leben, ob in Form von Wolf, Vielfraß, Käfer oder Schmetterling, Eisenhut oder Espe, hat Schwierigkeiten zu existieren, wenn seine Populationen voneinander getrennt werden. Eine Weile hinkt es noch weiter, aber irgendwann verliert es seine genetische Vielfalt und auch seine Widerstandsfähigkeit gegen Umweltveränderungen. Und die gibt es weiß Gott – der Klimawandel ist für einige Wissenschaftler die größte Herausforderung, der die Menschen und damit auch das restliche Leben auf der Erde jemals gegenüberstanden.
Viele Tier- und Pflanzenarten sind Teil wesentlich größerer Metapopulationen, die zwar scheinbar isoliert voneinander existieren, aber dennoch auf einen Fluss angewiesen sind – ein gewisses Maß an Auswanderung und Einwanderung zwischen den Populationen, um sie robust und gesund zu erhalten. Unsere Städte, Häuser, Straßen, Autobahnen und andere Erschließungen, Ziegelsteine, Mörtel, Asphalt und Monokulturen stehen zwischen diesen zunehmend fragmentierten Populationen. Sie verlieren und damit auch wir. Kurz gesagt, sie funktionieren nicht, sie sind zu klein, um nachhaltig zu sein. Wo die Schlüsselarten verschwunden sind, aus welchem Grund auch immer, führen der Verlust der Biosphäre und die negativen ökologischen Auswirkungen zum allmählichen Niedergang des gesamten Systems, Art für Art, wenn das Ökosystem zusammenbricht, auseinanderfällt und altert.
Aber haben Sie etwas Geduld mit mir. Das alles klingt zwar nach schwerer Kost und vielleicht möchten Sie inzwischen mich, dieses Buch, die Menschheit, ja die Welt einfach aufgeben – bitte tun Sie es nicht. Es gibt viele Gründe zur Freude, und zu denen komme ich gleich. Einer davon heißt Y2Y, ein eingängiges Akronym für die „Yellowstone to Yukon Conservation Initiative“.
Diese großartige Partnerschaft von rund dreihundert Einzelpersonen und Organisationen auf beiden Seiten der Grenze zwischen den USA und Kanada begann 1993 in Anerkennung genau der Dinge, die ich gerade erwähnte.
Y2Y erstreckt sich rund 3000 Kilometer vom Territorium Yukon am Rand der Beaufortsee und weit im Polarkreis über die Rocky Mountains bis zu ihrem südlichen Vorposten, dem Yellowstone-Nationalpark. Das Gebiet deckt einige der letzten verbliebenen Regionen der amerikanischen Wildnis ab. Es wurde eingerichtet, weil es nicht nur über eine nahezu intakte Ökologie verfügt mit einer reichen Auswahl an großen Pflanzenund Fleischfressern und allen ökologischen Helfern, auf deren Schultern sie stehen, sondern auch über viele geschützte Gebiete verfügt – über insgesamt 44 Nationalparks. Diese Parks dienten zwar als nützliche Ankerpunkte, waren aber einfach nicht groß genug für die natürlichen Wanderungen der Wildtiere.
Die Dynamik der Natur aus erster Hand zu beobachten, ist ein Erlebnis, das sich nur schwer in Worte fassen lässt. Als ich Zehntausende von Karibus aus der Entfernung erblickte, sahen sie so zahlreich aus wie die Mücken, die versuchten, sich durch meine Kleidung zu bohren. Und doch wurde jedes dieser 200 Kilogramm schweren Tiere von dieser scheinbar öden Tundra am Leben gehalten. Als ich näherkam, wurde mir klar, dass sie aus demselben Grund umherzogen, aus dem ich mit den Armen wedelte und mir ins Gesicht schlug. Auch sie wurden von Mücken gequält – und von den Mücken ernährten sich viele Vögel unterschiedlicher Arten, von munteren kleinen Watvögeln, die zwischen ihren Hufen umherliefen, bis zu Stelzen und durch die Luft sausende Raubmöwen.
Ich war mit Karsten Heuer (einem Wildtierbiologen) und Leanne Allison (Umweltschützerin) zusammen, die ein Jahr lang mit 120.000 dieser Tiere gelebt hatten und ihnen gefolgt waren, um Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Y2Y zu lenken und in kleinem Maßstab gegen die mögliche Erschließung des Arctic National Wildlife Refuge zu protestieren, dem wichtigsten Kalbgebiet für die Herde. Sie waren rund 1500 Kilometer durch eins der interessantesten Gelände der Welt gereist, hatten geschlafen, wenn die Tiere schliefen, und waren weitergezogen, wenn sie weiterzogen. Sie hatten alles gesehen und miterlebt; sie waren zwölf Monate alte Ehrenkaribus.
Sie erzählten mir, ihre wichtigste Erkenntnis hätte darin bestanden, dass es nicht nur die Mücken und die Vögel waren, die von diesem endlosen Mahlstrom aus Rentierfleisch und -blut abhingen. Es war vielmehr eine ökologische Prozession. Die Karibus „zogen ein ganzes Ökosystem hinter sich her“. Wenn es nicht Bären waren, dann Wölfe, die die Herde ständig peinigten, die Schwachen von den Starken trennten, die Spreu vom Weizen. Die 1500-Kilometer-Reise der etwa 197.000 Tiere ist die längste Wanderung aller Landsäugetiere und das intakte nördliche Äquivalent dessen, was ich am Ende meiner Reise in den Süden sehen sollte.
In Yellowstone stehen alle Bisons, die aus den großen Herden im Mittleren Westen übriggeblieben sind, in Gruppen herum. Ich hatte meinen Oberkörper aus dem Sonnendach meines Mietwagens gezwängt, um diese gigantischen Kühe zu beobachten, die stoisch im beißenden Wind standen, während sich Schneeflocken in ihrem Fell und ihren Wimpern fingen, gleichzeitig eisern und zart. Da ich meine Gebühr bezahlt hatte, fühlte sich die Natur an wie eine Ware. Es war natürlich notwendig; die Ökologie und die Ökonomie und das Bestreben, Mensch und Umwelt möglichst gesund zu erhalten, hatten dazu geführt, dass sich beides unentwirrbar miteinander verzahnte. Hier hatte die Natur einen Wert, während oben im Norden die Karibus außer für ein paar indigene Völker eher ein Ärgernis für die Ölkonzerne darstellten, weil sie an die fossilen Brennstoffe unter den gespaltenen Hufen der kalbenden Karibus wollten. Zwei Extreme derselben Beziehung. Diese 8000 Kilometer lange Reise (die Ironie des Umstands, dass ich mit dem Auto fuhr, entging mir dabei nicht) von Norden nach Süden war gleichzeitig eine Zeitreise aus der nahezu unberührten Wildnis mit einer einzigen Straße, dem Dempster Highway, in eine Wildnis, in der der beklemmende Einfluss von Einkaufsmeilen und 24-Stunden-Läden und Fast-Food-Ketten unsere moderne Lebensweise verkörperte. Unterwegs traf ich Ureinwohner, moderne Wildtiermanager, Jäger, Künstler und Naturschützer, die alle hoffnungsvolle Hymnen auf die ehrgeizige Y2Y-Naturschutzinitiative sangen.
Hoffnung besteht auf beiden Seiten des Zauns, wortwörtlich. Auf dem Trans-Canada Highway ist viel los. Er ist die Hauptroute zwischen Calgary und Alberta und jeden Tag befahren mehr als 15.000 Fahrzeuge seine vier Spuren. In der Nähe von Banff steht auf einem 45 Kilometer langen Abschnitt auf beiden Seiten ein 2,4 Meter hoher Zaun, um die große Zahl von Verkehrsunfällen unter Beteiligung großer Wildtiere einzudämmen. Das bringt zwar kurzfristig für Menschen und Wildtiere Vorteile, aber das Problem ist auch hier wieder die Fragmentierung. Obwohl die Straße seit ihrem Bau in den 1950er-Jahren für die Wildtiere immer eine Art von Grenze war, gelang es einigen Tieren dennoch, sie zu überqueren. Der Zaun jedoch machte daraus eine selbst für den entschlossensten Elch unüberwindliche Barriere.
Jedoch – und genau das macht das Wesen des Y2Y-Modells aus – wurde dank einer progressiven Mischung aus Wissenschaft und Aufklärung ein Netzwerk aus Unter- und Überführungen errichtet mit dem Ziel, die Populationen auf beiden Seiten dieses vielgenutzten und wichtigen Transportkorridors miteinander zu verbinden.
Als ich inmitten der kopfhohen Nadelbäume, des dichten Buschwerks und des Gewirrs von kniehohen Gräsern und Kräutern stand, konnte ich kaum glauben, dass ich dort war. Meinem GPS-Gerät zufolge stand ich mitten auf dem Highway; hier sollten vier Spuren in den Norden und weitere vier in den Süden führen, aber es war nur ein gelegentlicher krächzender Vogelruf zu hören und das Singen des Windes in den Kiefern. Es war, als sei die Landschaft die Hügel hinabgerutscht wie ein loser Treppenläufer und hätte den Trans-Canada Highway in ihren üppigen, grünen Flauschteppich eingehüllt – als sei die Ökofantasie eines Naturforschers wirklich geworden.
Ich hatte die Karte richtig gelesen und mein GPS-Gerät funktionierte tadellos – es log nicht. Ich war genau dort, wo es mich verortete, nur darüber.
Wenn ich mich konzentrierte, sobald der Wind kurz abflaute und der Vogel in seinem ziemlich melodiefreien Gesang pausierte, konnte ich das sanfte Schnurren des Verkehrs hören. Genau darum geht es. Ich stand mitten auf der fünfzig Meter breiten Wildtierüberführung – ein kurzer Korridor, der die wilden Lebensräume auf beiden Seiten des tödlichen schwarzen Bandes verbindet. Es war einer von zwei Überführungen auf diesem Abschnitt des Highways; dass ich keine Kanten, Hecken, Mauern oder Zäune sah, sollte dafür sorgen, dass auch die scheuesten Arten sich hinübertrauten.
Die Überführungen im Bow Valley bei Banff sind beispielhafte Wildtierkorridore und dazu noch spektakulär gut sichtbar, aber sie sind nur ein winziges Beispiel für die Gesinnung hinter der Y2Y-Vision. Es geht nicht darum, Wildtiere und Menschen voneinander zu trennen, sondern um Integration und Verbindung, damit beide Seite an Seite leben und gedeihen können.
Für mich war das ein Schritt in Richtung Zukunft und auch wenn immer noch Förster, Viehtreiber und Interventionen nötig sind, wo Wildtiere in die Enge getrieben werden, besteht doch allgemein ein Bewusstsein und eine Sympathie für die Wildnis und man schätzt die Würze, die sie in den Alltag bringt. Selbst ein Opfer eines beinahe tödlichen Bärenangriffs sagte nonchalant zu mir: „Ich war ja in seinem Revier, er hat nur getan, was Bären eben tun.“
Auch wenn es in diesem Beispiel weniger um Renaturierung als um Wiederverbindung geht, passt es zum Thema dieses Buches: Das Wichtige ist unsere Beziehung zur Natur und wie wir unseren Platz neben ihr neu bewerten müssen.