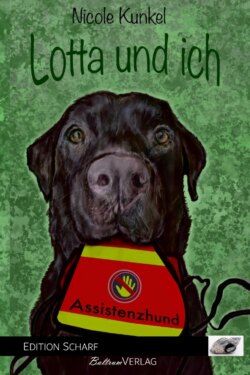Читать книгу Lotta und ich - Nicole Kunkel - Страница 10
Оглавление2
Und täglich grüßt der ganz normale Ausnahmezustand
Nicole – Sommer 2019
Gleich geht die Sonne auf und ich habe keine Minute geschlafen. Die Nacht hat sich wie Kaugummi gezogen. Jede Sekunde davon eine einzige Qual. Ich habe aufgegeben, die Panikattacken zu zählen, die sich, wie fast immer, nahtlos aneinanderreihen, als ob sie sich wie grausame Nachtwächter zum Tor der Hölle gegenseitig ablösen.
Ich stürze ins Bad, wo der Eimer schon vor der Toilette bereitsteht. Rechtzeitig schaffe ich es, die gewohnt, verhasste Position einzunehmen, in der ich verkrampft auf der Kloschüssel hocke, den Eimer umarme und das Gefühl habe, meine kompletten Eingeweide herauszuwürgen, die nicht untenrum in die Keramik platschen. Einige Strähnen rutschten mir bei der Aktion in die bittersaure Gallensuppe. Wie Slimer von den Ghostbusters kleben sie dort, weil ich es wieder einmal nicht rechtzeitig geschafft habe, meine Mähne zu bändigen.
Duschen. Ich muss duschen, dringend.
Ich ignoriere bewusst mein Spiegelbild. Dieses zitternde Elend, das mehr einem ES oder einem gruseligen Zombie ähnelt als einer Frau, möchte ich jetzt nicht sehen, auf gar keinen Fall. Ich muss mich beruhigen. Atme. Nicole, atme. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ausatmen. Nein, du musst jetzt nicht schon wieder kotzen. Atme und denk an was Schönes und riech auf gar keinen Fall an deinen Haaren!
Ich schleppe mich unter die Dusche und versuche ein- und auszuatmen, ohne dass mir dabei der säuerliche Geruch meiner besudelten Strähnen in die Nase weht.
Das viel zu heiße Wasser läuft an mir herunter. Ich werde das aber erst später an den roten Flecken auf der Haut bemerken.
Mein Körpergefühl hat sich schon lange ins Nirwana verabschiedet, falls ich es überhaupt jemals besessen habe.
Ich kämpfe gegen die Übelkeit, die in meinem Bauch zu einer weiteren Runde ruft: »Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Auf geht der Spaß.«
Eine neue Riesenwelle der Panik rollt in mir an. Zu blöd, dass Erbrechen sowie die Angst davor seit meiner frühesten Kindheit Trigger sind, die die ganze Panikkugel erst lostreten. Was für ein beschissener Kreislauf.
Ich greife mir ein Handtuch und hechte aus der Dusche zum Klo. Triefendnass rutsche ich mehr, als dass ich sitze mit dem Eimer im Arm auf dem Toilettensitz hin und her. Es fühlt sich an, als würde meine gesamte Speiseröhre in Flammen stehen, während ich Benzin hochwürge, das den Brand in Schach hält.
Es muss ein sehr einladendes Feuer in mir sein, denn nun stoßen auch noch Blase und Unterleib in die lustige Runde am Lagerfeuer dazu.
Sie krampfen und brennen alle zusammen um die Wette, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich sterbe, denke ich und mir fällt die äußerst aufbauende Bemerkung meines letzten Psychiaters wieder ein:
»An einer Panikattacke ist noch keiner gestorben.«
Stimmt. Ich lebe noch, aber eine gruselige Sehnsucht nach dem Tod, nach einer Erlösung, danach, dass das alles endlich aufhört, wabert in meinem Kopf wie erstickender Rauch.
Ich kann nicht mehr. Alles um mich herum dreht sich und vor lauter Tränen und Schweiß sehe ich nur verschwommen. Trotzdem erkenne ich sowohl das alte als auch das hellrote, frische Blut in der Kloschüssel, als ich das kurze Abebben der Würge- und Schmerzflut nutze und mich aufrappele.
»Sehr wahrscheinlich hat die Endometriose Ihren Darm befallen«, schießen mir die letzten Worte meines Frauenarztes in den Kopf, bei dem ich schon wieder viel zu lange nicht mehr zur Kontrolle war. Aber die Darmspiegelung hatte doch nichts Besorgniserregendes zu Tage gebracht.
»Das heißt gar nichts«, hatte mein Arzt gesagt. »Die Wucherungen können von außen am Darm liegen. Das sieht man dann nicht in der Koloskopie. Genau das ist das Heimtückische an dieser Erkrankung.« Natürlich lässt sich dieser Verdacht nur in einer weiteren Operation ergründen, bei der sie dann direkt in einem Abwasch die neuen Herde mit samt betroffenem Gewebe – in diesem Fall Darmstücke – entfernen. Schlimmstenfalls würde ich mit einem künstlichen Darmausgang aufwachen. »Nein, daran will ich nicht denken!« Ich drücke die Spülung.
Da ist sicher wegen der ganzen Anstrengung und Würgerei nur ein Äderchen geplatzt, beruhige ich mich. Jeder Gedanke in die andere Richtung würde wieder eine weitere Panikattacke folgen lassen. Ich schaffe es ja nicht einmal mehr zu meinem einfühlsamen Gynäkologen, nach dem ich so lange gesucht habe. Wie soll ich da eine weitere Operation überstehen?
Außerdem kommen diese blöden Wucherungen ohnehin kurz darauf wieder. Wozu das alles?
Ich schiebe diese Gedanken in meinem Kopf so weit nach hinten, wie ich kann, und schleiche in die Küche.
Inzwischen ist es sieben Uhr und mein Magen hat sich so weit beruhigt, dass ich es mit einem Tee versuchen will.
Vielleicht mildert der die schlimmsten Krämpfe und das erdrückende Schwindelgefühl etwas ab.
Ich warte darauf, dass das Wasser kocht. Ein Schmerz, der mir den Atem raubt, schießt durch meinen Unterleib, gefolgt von einem Flashback-Gewitter in meinem Kopf aus längst vergangenen Bildern, die schlimmer sind als jeder Horrorfilm.
Es ist vorbei. Dir passiert nichts. Du bist hier in Sicherheit. Atme, Nicole, atme. Das geht vorbei, wiederhole ich in meinem Kopf das Mantra, das ich in der Traumatherapie gelernt habe und das mir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber es hat keinen Zweck. Unnötig mich zu fragen, warum. Mein Mund wird immer trockener, ich zittere, als ob Starkstrom durch meinen Körper jagt und spüre, wie sich ein Tsunami aus Panik in meinem Inneren formiert.
Hilfe. Ich brauche Hilfe. Verzweiflung lähmt jeden anderen Gedanken. Ich stolpere durch die Wohnung. Vor und zurück. Hin und her. Wie ein Tiger im Käfig, der nach einer Fluchtmöglichkeit sucht. Doch es gibt keine. Inzwischen meldet sich eines der Kinder in meinem Kopf und übernimmt die Kontrolle. Ich bin im Kleinkindmodus, schluchze, weine und hätte ich nicht so eine Angst vor fremden Menschen, würde ich jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit runter zur Nachbarin rennen, um sie anzuflehen »Bitte mach, dass das aufhört. Bitte hilf mir!« Nichts wünsche ich mir mehr als eine tröstende Umarmung, jemanden, der mich einfach nur festhält und mein verrücktes Nervensystem beruhigt. Dabei weiß der erwachsene und erfahrene Teil in mir genau, dass ich eben das gar nicht aushalten kann. Ich würde es nicht zulassen, selbst wenn es eine solche Person gäbe, die das tun würde.
Wenn du zu oft die Erfahrung gemacht hast, dass du keinem Menschen vertrauen kannst, dann ist das so.
Es gab Menschen, die für mich verantwortlich waren und für die ich meine Hand ins Feuer gelegt hätte. Genau das wurde mir zum Verhängnis und sogar lebensgefährlich. Sowas brennt sich ein.
Es ist ein langer Weg, andere Erfahrungen zuzulassen und ein noch viel längerer zur Heilung. Ich gehe ihn auf wackligen Beinen, auch wenn ich das Ende des Weges nicht sehen kann.
Das Kind in mir greift zum Telefon und ruft Chris, meinen Lebensgefährten, an. Vor lauter Schluchzern, die ihm durch den Hörer ins Ohr plärren, muss er mehrfach nachfragen und legt fast wieder auf. »Nici? Beruhige dich. Du musst dich beruhigen.«
»Ich kann nicht. Bitte komm. Du musst heimkommen. Bitte. Bitte hilf mir doch«, jammere ich ins Telefon und kann förmlich sehen, wie er mit den Augen rollt. Ob er genervt ist oder überfordert, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht ist er nur in seiner eigenen Ohnmacht und Hilflosigkeit gefangen. Er seufzt. »Das geht nicht. Ich muss arbeiten. Beruhige dich.«
»Hab solche Angst. Mir ist so schlecht. Bitte, ich kann nicht mehr«, schluchze ich und fühle mich immer verlorener. Gleichzeitig schäme ich mich, kann aber nicht anders und höre mich flehen: »Bitte komm doch nach Hause. Ich brauche dich.«
Er seufzt diesmal eine Oktave lauter. »Du schaffst das schon. Mach dir was zu Essen. Du musst etwas essen, dann beruhigt sich dein Magen. Und dann schnappst du dir eine Katze und legst dich hin. Versuche einfach zu schlafen. Du musst dich beruhigen.«
Ich lege auf, ohne noch etwas zu sagen. Das Gefühl, allein und vollkommen hilflos zu sein, schwappt in eine neue Dimension.
Ich schlucke den riesigen Kloß aus Scham runter und schwöre mir, ihn in solch einer Situation nie wieder anzurufen. Verhalte dich nicht wie ein Baby. Du bist erwachsen, verdammt, beschimpfe ich mich und fühle mich dabei unsagbar unfähig und einsam. Warum ist das alles so schwer? Einfach beruhigen. Einfach atmen. Einfach nur leben. Einfach. Ja, alles easy peasy, denke ich und komme mir saublöde vor.
Tiere! Mit denen ist's leichter und sie sind immer für mich da. Ich suche die Wohnung nach einer meiner drei Katzen ab. Wo liegen die nur wieder herum? Ich finde keine meiner Fellnasen. Katzen eben. Ich spüre diesen brennenden Kloß im Hals und wünsche mir, Lara wäre noch da. Das war meine Seelenkatze.
Damit hier keine Missverständnisse aufkommen: Ich liebe jede meiner schnurrenden Fellknäuel mehr als mich selbst. Jede ist auf individuelle Art etwas Besonderes. Ich schätze Katzen vor allem wegen ihrer Unabhängigkeit und ihrem eigenen Kopf, auch wenn es oft Situationen gibt, in denen ich es mir anders wünsche, weil ich Trost brauche. Genau dann vermisse ich Lara am meisten, meine wuschelige, graue Maunz-Kugel. Sie war vom Charakter her mehr Hund als Katze, immer an meiner Seite und doch eigensinnig speziell. Still war es mit ihr nie, da sie immer etwas zu erzählen hatte und lautstark genau die Liebe von mir eingefordert hat, die sie mir entgegenbrachte. Sie hat mich sogar aus Albträumen geweckt, liebevoll abgeschleckt, beruhigt und wieder in den Schlaf geschnurrt. Sie wäre eine gute Assistenzkatze gewesen, wenn es so etwas gäbe. Leider ist sie 2018 mit fast 16 Jahren über die Regenbogenbrücke gegangen und ich vermisse sie seitdem jeden einzelnen Tag.
Mein Magen krampft und ich spüre eine neue Welle aus Übelkeit in mir anfluten.
Ganz ruhig. Atmen. Nicole, atme. Ein, aus.
Mein Bauch grummelt. Hunger spüre ich keinen, nur Angst und neue Wellen, die sich zur nächsten Panikattacke formieren. Ablenkung. Muss mich ablenken. Essen, hat er gesagt. Ja. Ich sollte versuchen, etwas zu essen.
Ich suche in der Küche und im Vorratsschrank nach irgendetwas Essbarem, von dem ich denke, es im Magen behalten zu können.
Ein Nutella-Brötchen ist da eine eher schlechte Wahl. Cornflakes auch. Vielleicht Zwieback oder eine Banane. Nichts. Nicht einmal Knäckebrot ist da. Stimmt, heute ist Dienstag – Einkaufstag. No way. Das schaffe ich nicht. Nicht allein. Vor die Tür zu gehen ist undenkbar. Ich fühle mich verloren. Und da ist sie wieder, diese beschämende Hilflosigkeit. Sie macht sich in mir breit und droht mich innerlich zu zerreißen.
Und dann ist der Panik-Tsunami da und reißt binnen Sekunden all diese Gefühle mit sich.