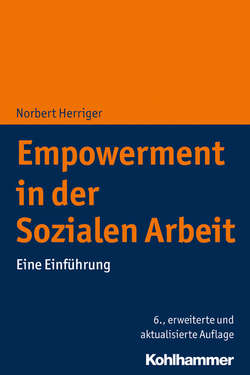Читать книгу Empowerment in der Sozialen Arbeit - Norbert Herriger - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 Klientenbilder im Wandel: Auswege aus der Entmutigung 3.1 Biographische Nullpunkt-Erfahrungen: Der Verlust von Lebensregie und erlernte Hilflosigkeit
ОглавлениеAusgangspunkt von Empowerment-Prozessen ist stets das Erleben von Machtlosigkeit und Fremdbestimmung – die Erfahrung also, ausgeliefert zu sein, mit dem Rücken an der Wand zu stehen, die Fäden der eigenen Lebensgestaltung aus der Hand zu verlieren. Die Alltagserfahrungen der sozialen Praxis bestätigen dies Tag für Tag aufs Neue: Ob nun in der Arbeit mit strafentlassenen Menschen, mit dissozialen Straßenkindern, mit langzeithospitalisierten Patienten psychiatrischer Einrichtungen oder mit alleinstehenden wohnungslosen Menschen – stets ist es die schmerzliche Erfahrung des Verlustes von Selbstbestimmung und Autonomie, die den biographischen Nullpunkt der Lebensgeschichten dieser Menschen markiert und die Ausgangspunkt für die Suche nach Auswegen aus der Ohnmacht ist. Schon klassisch ist die Definition von Seeman (1959): Er definiert Machtlosigkeit als die generalisierte (auf alle Lebensbereiche, Lebenssituationen und Lebenszukünfte verallgemeinerte) »Erfahrung des Individuums, daß man durch eigenes Handeln das Eintreten gewünschter Ergebnisse nicht beeinflussen kann« (Seeman 1959 zit. n. Kieffer 1984, S. 15). Ähnlich auch die Begriffsbestimmung von Freire (1973): Machtlosigkeit entsteht nach seiner Erfahrung immer dort, wo der einzelne lernt, sich als Objekt zu begreifen, das von Umweltgegebenheiten abhängig ist, nicht aber als Subjekt, das die Lebenswelt aktiv und produktiv zu gestalten vermag. Mit der Einübung in diese Objekt-Rolle aber verliert die Person alle tauglichen Werkzeuge für eine eigengesteuerte Konstruktion sozialer Wirklichkeiten. Machtlosigkeit, so Freire, spiegelt sich so in der passiven Hinnahme repressiver sozialkultureller Gegebenheiten und in der Verneinung der eigenen Ansprüche auf Lebenssouveränität in einer »Kultur des Schweigens« (culture of silence). Diese Kultur des Schweigens wird auch in den folgenden Zitaten deutlich. In ihnen geben Menschen, mit Blick zurück auf die dunklen Flecken der eigenen Biographie, ihrer Erfahrung von Machtlosigkeit Ausdruck und Sprache.
»Mein ständiger Begleiter war das Gefühl, nur ein ›geborgtes Leben‹ zu leben. Oder anders ausgedrückt: Das Leben erschien mir wie ein Fluß, der mich mit sich reißt, ohne daß ich je festen Boden unter die Füße bekommen hätte. Sicherheit und Glücklich-Sein – das schien mir eine Sache der anderen, der ›da oben‹, die es – wie auch immer – geschafft hatten, auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen… Ich habe mich nie getraut, eine eigene Meinung zu haben. Eine Situation, die mehr als ein ›Von-der-Hand-in-den-Mund-Leben‹ gewesen wäre, erschien mir ein utopischer Traum, die Zukunft nur ein schwarzes Loch« (ehemaliger Patient einer Langzeitklinik für Depressionskranke).
»Solange ich mich zurückerinnern kann, war unser Familienleben ein einziger ›Full-Time-Job‹ ums Überleben. Es fehlte an allen Ecken und Enden: Nie waren wir Kinder sicher, daß sich der Kühlschrank wieder füllte. Unsere bescheidenen Kinderwünsche wurden immer wieder vertagt. Manchmal blieb die Wohnung über Wochen kalt, und ich weiß noch, daß ich schon als Kind manchmal nachts nicht schlafen konnte – aus Angst, daß wir die Wohnung verlieren, weil die Miete wieder einmal unbezahlt geblieben war… Wenn ich zurückschaue, dann bleibt vor allem eines: das Gefühl, hilflos – wie ein Spielball – den anderen ausgeliefert zu sein« (Bewohnerin in einem selbstorganisierten Wohnprojekt).
»Ich habe – schon von Kindheitstagen an – immer mit dem Gefühl gelebt, daß ich nicht mitreden kann, daß meine Meinung nichts wert ist und von den anderen eher als Zeichen für Unwissenheit beurteilt wird. Mein Leben war immer ein Leben im Rückwärtsgang, im Rückzug – angefüllt mit der Angst, mit einer unangepaßten Überzeugung anzuecken. Ich habe erst spät gelernt, eine eigene Überzeugung zu haben, die es wert ist, daß ich für sie eintrete und sie mit Argumenten verteidige« (Aktivistin in einem Nachbarschaftsprojekt zur Verkehrsberuhigung im Stadtteil).
Diese Selbstaussagen markieren recht deutlich biographische Nullpunkt-Erfahrungen. Zum Ausdruck kommt in ihnen die schmerzliche Erfahrung, »im eigenen Leben nicht zu Hause zu sein«. Von hier ist der Weg nicht weit zu einer frühen Arbeit, die in der Empowerment-Debatte breite Rezeption gefunden hat. Charles Kieffer, Gemeindepsychologe und Leiter eines gemeindebezogenen Kriseninterventionszentrums in Michigan, unternahm Anfang der 1980er Jahre eine Reise in die Lebensgeschichten von Menschen, die für sich (und für andere) Hintertüren aus der Machtlosigkeit gefunden hatten. Transportmittel seiner ethnographischen Reise »nach innen« waren die Lebenserzählungen von Frauen und Männern, die die Schwerkraft entmutigender Nullpunkt-Erfahrungen hinter sich gelassen hatten und zu Aktivposten innerhalb von lokalräumlich gebundenen Selbsthilfe-Initiativen (grassroots-organizations) geworden waren (vgl. Kieffer 1981; 1984). Empowerment-Geschichten sind nach Kieffer dynamische Entwicklungsprozesse in der Zeit, in deren Verlauf Menschen »ein Set von Einsichten und Fähigkeiten entwickeln, das man am besten mit dem Begriff ›partizipative Kompetenz‹ charakterisieren kann« (Kieffer 1984, S. 18). Empowerment ist für ihn eine biographische Reise des sozialpolitischen »Erwachsen-Werdens«. Kieffer beschreibt das Gefühl der Ohnmacht, das die Summe wiederholter und tagtäglich aufs Neue beglaubigter Erfahrungen von Unterlegenheit ist, in folgenden Kürzeln (Kieffer 1984, S. 15ff.):
• eine Zweiteilung der Welt entlang der Achse von Macht und Gestaltungskraft (»die dort oben, wir hier unten«);
• eine Weltsicht, in deren Licht die Strukturen der alltäglichen Wirklichkeit unverrückbar und dem eigenen Handeln nicht mehr zugänglich erscheinen; das resignative Akzeptieren des alltäglich Gegebenen;
• die Geringschätzung des Wertes der eigenen Meinung;
• das generalisierte Mißtrauen gegenüber einer Umwelt, die als unwirtlich, abweisend und feindlich gesonnen erlebt wird;
• die Selbst-Attribution von Schuld und Verantwortlichkeit für Lebensmißlingen;
• das Gefühl des Aufgeliefert-Seins und die Erfahrung der eigenen sozialen Verletzlichkeit;
• das Gefühl des Abgeschnitten-Seins von Ressourcen der sozialen Einflußnahme und das fehlende Vertrauen in die Möglichkeiten des eigenen Sich-Einmischens;
• das Gefühl der Zukunftsverschlossenheit.
Ein Lebenskonto, auf dem vielfältige Erfahrungen von Ausgeliefert-Sein, Hilflosigkeit und Verlust von Umweltkontrolle abgebucht sind – dies also markiert die Nullpunkt-Erfahrungen von Menschen. Freilich: Die oben zitierten Selbstbeschreibungen und Selbstbilder verbleiben noch im Bereich der Deskription. Gehen wir deshalb einen Schritt weiter und fragen nach den Lebensereignissen und Lebenserfahrungen, die an derartige biographische Tiefpunkte führen. Welche Enttäuschungen und Verletzungen sind es, die zu einem signifikanten Verlust von Lebensregie führen? Wie ist der Weg in eine »Kultur des Schweigens«? Gibt es hinter der Idiographie biographischer Ereignisse gemeinsame Muster, die das Entstehen von Machtlosigkeit und scheinbar grenzenloser Hilflosigkeit zu erklären vermögen? Antworten auf diese Fragen gibt uns ein Theoriemuster, das wohl wie kein anderes die psychologische Forschung zu Krisenerleben und Krisenbewältigung angeregt hat: die Theorie der »erlernten Hilflosigkeit« (learned helplessness) des klinischen Psychologen und Depressionsforschers Martin Seligman (zuerst 1975). Das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit wurde ursprünglich in tierexperimentellen Untersuchungen zur Angstkonditionierung entdeckt. Hunde wurden in einer Versuchsanordnung zum klassischen Konditionieren aversiven Stimuli (Elektroschocks) ausgesetzt, denen sie weder durch Explorations- noch durch Vermeidungsverhalten entkommen konnten. Die aversive Stimulation war für sie also unkontrollierbar. Wurden die Situationen der Unkontrollierbarkeit wiederholt, so vollzog sich in raschen Schritten ein dysfunktionaler Lernprozeß. Die Versuchstiere lernten, daß sie keinen produktiven Einfluß auf ihre Umwelt nehmen konnten; sie entwickelten eine generalisierte Erwartung auch zukünftiger Hilflosigkeit, die von gravierenden Mängeln in den Bereichen Motivation, Lernen und Emotion begleitet war (zum experimentellen Design der Untersuchung vgl. Seligman 1995, S. 19ff.; Meyer 2000, S. 30ff.). Seligman und seine Mitarbeiter entwickelten in der Übertragung dieser experimentellen Befunde in den Humanbereich ein »Erwartungsmodell der erlernten Hilflosigkeit«. Ausgangspunkt sind hier Lebenskrisen und belastende Lebensereignisse, die sich einem gelingenden Bewältigungsmanagement der betroffenen Person entziehen. Erlernte Hilflosigkeit – so die theoretische Kernaussage – nimmt ihren Ausgang in der wiederholten Erfahrung der Person, daß alle Anstrengungen, belastende Ereignisse und Situationen ihrer Umwelt zu beeinflussen, fehlschlagen. Wenn auch wiederholte Versuche, die Kontrolle über die Umwelt zurückzugewinnen, sich als erfolglos erweisen, so führt dies zu einer spezifischen Verletzlichkeit: Die Motivation der Person, Einfluß auszuüben und gestaltend zu handeln, vermindert sich; die zukunftsgerichteten Erfolgserwartungen im Hinblick auf das eigene Kontrollhandeln färben sich negativ; das Vertrauen in die eigenen Handlungsfähigkeiten und Bewältigungsressourcen schwindet; sozialer Rückzug, Depressivität und Hoffnungslosigkeit kehren ein. Mit dieser Theorie der erlernten Hilflosigkeit, die in mehr als 25 Forscherjahren immer wieder neue Stufen konzeptioneller Revision und empirischer Erprobung durchlaufen hat, gewinnen wir ein griffiges Interpretationsraster, das es uns möglich macht zu erklären, auf welche Weise Nullpunkt-Erfahrungen entstehen (zur Entwicklungsgeschichte der Theorie erlernter Hilflosigkeit vgl. einführend Meyer 2000; Petermann 1995).
Ausgangspunkt des paradigmatischen Modells des Entstehens erlernter Hilflosigkeit ist das Eintreten eines belastenden Lebensereignisses. Etwas Unverhofftes, Nichtgeplantes, Unkalkuliertes tritt bedrohlich in den Lebensplan von Menschen – die Organisation alltäglicher Lebensvollzüge zerbricht, die Kontinuität des Erlebens und Handelns wird unterbrochen. Belastende Lebensereignisse markieren einen Einschnitt, eine Lebenszäsur, einen Wendepunkt im individuellen Lebenslauf. Sie produzieren eine emotionale Betroffenheit (Niedergeschlagenheit; Ängstlichkeit; Selbstzweifel) und eröffnen eine biographische Phase des relativen Ungleichgewichtes, in der es notwendig wird, Lebenszuschnitte neu zu organisieren und ein in Unordnung geratenes Person-Umwelt-Gefüge in eine neue Ordnung zu bringen. Menschen sind diesen Lebensbelastungen nun nicht passiv-hilflos ausgesetzt – sie verfügen vielmehr über ein spezifisches (lebensgeschichtlich gewachsenes) Repertoire von Strategien der Bearbeitung und der Bewältigung (Coping-Strategien). Treten belastende Lebensereignisse in die Biographie von Menschen, so sind diese Ereignisse die Auslöser spezifischer Versuche der (kognitiven, emotionalen und handelnden) Bewältigung, die darauf gerichtet sind, die negativen Folgen erfahrener Bedrohungen, Belastungen und Einschränkungen zu mindern und Lebensungleichgewichte neu auszubalancieren.
Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit setzt nun dort ein, wo diese Bewältigungsversuche ins Leere laufen, fehlschlagen, immer wieder abbrechen und ein personales Bewältigungsmanagement nicht gelingt. An diesen Orten entstehen Erfahrungen der Unkontrollierbarkeit eines Ereignisses. Mit diesem Begriff der Unkontrollierbarkeit gewinnen wir das Herzstück der Theorie der erlernten Hilflosigkeit. Unkontrollierbar ist ein Lebensereignis nach Seligman dann, wenn zielgerichtet-intentionale Handlungen die Auftretenswahrscheinlichkeit dieses Ereignisses nicht beeinflussen. Was auch immer eine Person tut oder tun könnte, unterläßt oder unterlassen könnte, es bleibt ohne Wirkung. Gelangt die Person am Ende immer wieder fehlschlagender Versuche der Bewältigung zu der Überzeugung, daß sie durch keine der ihr zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten einen positiven Einfluß auf die Umwelt nehmen und angestrebte Ziele erreichen kann, so lernt sie, daß sie hilflos ist. Diese Hilflosigkeitserfahrung bestimmt nicht nur das Hier und Jetzt, sondern wirkt auch in die Zukunft hinein. Mit dem Fortdauern von Unkontrollierbarkeitserfahrungen kommt es zu einer Generalisierung von Hilflosigkeitserwartungen. Eine Person, die in einer Lebenssituation Unkontrollierbarkeit erlebt hat, läuft – so Seligman – ein erhöhtes Risiko, ihre Hilflosigkeitserfahrung zukünftig auch auf andere Lebensbereiche zu übertragen. Anforderungen und Aufgabenstellungen, welche zuvor erfolgreich bewältigt wurden, können nach Hilflosigkeitserfahrungen als unüberwindbare Lebensschranken erlebt werden. Verbleibende Möglichkeiten, Kontrolle auszuüben, werden nicht wahrgenommen und bleiben ungenutzt. Strategien der aktiven Gegenwehr und der Suche nach Lebenskontrolle vermindern sich Schritt für Schritt und münden in eine Haltung durchgreifender Passivität. Die Person gerät so in ein immer schneller sich drehendes Karussell der »Entsozialisierung« von Kompetenzen, Motivationen und Selbstregulierungsfähigkeiten, das auf der Ebene der Emotionalität von einer Begleitmusik der Niedergeschlagenheit, Resignation und Depressivität begleitet wird.
Diese erste (nach einem einfachen Reiz-Reaktions-Modell gestrickte) Fassung der Theorie erlernter Hilflosigkeit erwies schon bald ihr empirisches Ungenügen. Die Gleichung »Erfahrung von Unkontrollierbarkeit« = »Verlust von Handlungsfähigkeit« = »erlernte und generalisierte Hilflosigkeit« erwies sich als zu einfach, um komplexe Wirklichkeiten jenseits des psychologischen Labors einzufangen. Vielfältige empirische Befunde verweigerten sich diesem theoretischen Modell: So können z. B. Erfahrungen der Nichtkontrolle – entgegen den Modellannahmen – vermehrte, aktive und vielfach auch produktive Kontrollbemühungen auslösen. Und umgekehrt: Das Modell kann nicht erklären, warum in vielen Fällen die Hilflosigkeitserfahrungen mit signifikanten Verlusten von Selbstwertgefühl verbunden waren (denn: Warum sollte man sich für ein Ereignis verantwortlich fühlen, das weder in der eigenen Macht noch Kontrolle steht?). Widerständige Befunde und blinde Erklärungsflecken wie diese führten zu Revisionen und Neuformulierungen der Theorie erlernter Hilflosigkeit. Der gemeinsame Nenner dieser neuen Erklärungsangebote: die Integration attributionstheoretischer Konzepte in die Hilflosigkeitstheorie. Die wohl folgenreichste Neukonzipierung der Theorie formulierten Seligman und Mitarbeiter in der Neuauflage ihres Buches von 1978 (vgl. Meyer 2000, S. 70ff.). In ihr führen die Autoren eine neue, zusätzliche Variable ein, die zwischen der Erfahrung von Nichtkontrolle und der erlernten Hilflosigkeit moderiert: die Attributionen (Prozesse der subjektiven Interpretation, Bewertung und Erklärung der Nichtkontrolle), in denen die Person eine Antwort auf die Frage nach den Ursachen der Nichtkontrolle gibt. Attribution richtet den Blick auf den »inneren Dialog« einer Person, auf ihr Bemühen, sich (und anderen) Erklärungen für die Nichtkontrolle zu liefern. Wir alle teilen diese Alltagserfahrung: Menschen, in deren Leben ein unerwünschtes Ereignis tritt, gehen auf die Suche nach Sinn. Sie stellen die Fragen nach dem »Warum?« und dem »Warum gerade ich?«. Die Frage nach dem Warum zielt zunächst auf Konsensus-Information ab: Die Person fragt sich im interindividuellen Vergleich, warum ausgerechnet ihr und nicht jemand anderem das kritische Ereignis passiert ist. Zugleich transportiert diese Frage Unglauben ob des Geschehenen, Wut, Gegenwehr. Die Antwort, die die Person (sich selbst und anderen) gibt, ist eine Art Schlüssel-Attribution, die dem weiteren Bewältigungsprozeß den Kurs vorgibt. Attribution bezieht sich also auf die Sinnkonstruktionen, die Interpretationen und die Ursachenerklärungen, in die Menschen die nichtkontrollierbaren Ereignisse »einpacken«. Diese Sinngebungsmuster, mit deren Hilfe Menschen sich das kausale Zustandekommen von (belastenden und bedrohlichen) Umweltereignissen zu erklären versuchen, ihre Kausalattributionen also, sind in der Reformulierung der Theorie erlernter Hilflosigkeit die entscheidenden Determinanten, von denen abhängt, in welcher Weise Nichtkontrollerfahrungen verarbeitet werden. Kausalattributionen beeinflussen die Einschätzung der Belastung, die Planung von Bewältigungsstrategien wie auch die Bewertung von Bewältigungsversuchen. Sie sind ein Selektionsfilter, an dem sich der Grad der erfahrenen Hilflosigkeit bemißt. Seligman unterscheidet drei analytische Dimensionen von Attributionen, die anhand von Fragebogen-Inventaren (Attribution Style Questionnaire) vermessen werden können (vgl. Seligman 1991, S. 40–51):